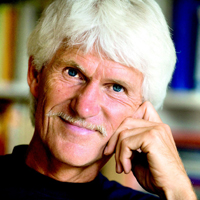Michael Hartmann: Die Exzellenzinitiative – ein Paradigmenwechsel in der deutschen Hochschulpolitik
Als im Januar 2004 die rot-grüne Bundesregierung unter Gerhard Schröder erstmals über ein Programm zur Schaffung von Eliteuniversitäten in Deutschland sprach, löste sie einen enormen Medienwirbel aus. Die Tatsache, dass ausgerechnet die Sozialdemokratie – auf dem Bildungssektor traditionell für das Prinzip der Chancengleichheit zuständig – den Begriff der Elite enttabuisierte, sorgte für größte Verwunderung. Die Reaktionen führten schnell zur offiziellen Umbenennung der geplanten Initiative. Sie hieß fortan „Exzellenzinitiative.“ Damit sollte signalisiert werden, dass es keinesfalls um die Privilegierung einzelner Universitäten, sondern um einen allgemeinen Leistungswettbewerb gehen solle. Alle Hochschulen hätten im Grundsatz die gleichen Chancen; jede Universität, die in der ersten Runde des Wettbewerbs verliere, könne in der zweiten zu den Gewinnern zählen, so die öffentlich immer wieder zu hörenden Äußerungen von den Befürwortern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.
Der Eliteforscher Michael Hartmann hat uns diesen Beitrag, der in der Zeitschrift für Sozialwissenschaft „Leviathan“ abgedruckt ist, zur Verfügung gestellt.
Schon ein erster genauerer Blick auf die etymologischen Wurzeln des Wortes Exzellenz muss jedoch skeptisch stimmen. „Excellentia“, der lateinische Ursprung steht sowohl für herausragende Leistung bzw. Qualität als auch für eine herausgehobene höhere Stellung. Diese Doppelbedeutung hat sich im französischen „excellence“ über all die Jahrhunderte erhalten. Mit dem Wort „excellence“ werden in Frankreich auch heute noch ausgezeichnete Leistungen und hohe Würdenträger in Diplomatie wie Kirche gleichermaßen bezeichnet. Die Nähe zum Elitebegriff ist hier auch sprachlich unübersehbar. Elite bedeutet aber gerade nicht, dass alle die gleiche Chance haben; gemeint ist damit vielmehr eine dauerhafte Absonderung einer kleinen Gruppe vom Rest, von der Masse, eine Absonderung, die nicht ausschließlich, ja nicht einmal überwiegend auf Leistung zurückzuführen ist, sondern in hohem Maße auf Herkunft und die damit verknüpfte Einbindung in Macht- und Herrschaftsstrukturen (Hartmann 2002, 2004).
Wird die Entwicklung im Hochschulbereich hierzulande ebenfalls in diese Richtung laufen? Wird einer kleinen Zahl von Universitäten die Kennzeichnung Exzellenz oder Elite und der damit verbundene Status dauerhaft zuteil werden, ohne dass das offizielle Kriterium Leistung dafür allein oder auch nur vorrangig ausschlaggebend ist? Was bedeutet das für die soziale Zugänglichkeit und die Leistungsfähigkeit des deutschen Universitätssystems? Diesen Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden.
Elite- und Massenuniversitäten
Wenn im universitären Kontext von Exzellenz die Rede ist, so ist zunächst nur eines klar. Begrifflich bedeutet Exzellenz den Abschied von der das deutsche Universitätssystem traditionell prägenden Vorstellung, dass alle Universitäten im Grundsatz gleich sind. Wenn man einige heraushebt, so ist das nur möglich um den Preis, dass die anderen herabgestuft werden. Die einen sind exzellent, die anderen nicht. Nicht mehr hohe Qualität in der Breite ist das wesentliche Ziel der Hochschulpolitik, sondern „Weltklasse“ bei einzelnen Institutionen, den sog. „Leuchttürmen“ der Wissenschaft. Noch vor Bekanntgabe der ersten Ergebnisse des Exzellenzwettbewerbs hat die ZEIT vom 17. November 2005 in einem Artikel dessen zentrale Wirkung mit dem treffenden Satz beschrieben: „Der Wettstreit wird das auf Gleichheit beruhende Universitätssystem endgültig zerschlagen.“
Zu diesem Zeitpunkt waren solche Feststellungen allerdings die Ausnahme. Einige Monate später sah das schon anders aus. Nachdem die Exzellenzinitiative politisch durchgesetzt war und die Ergebnisse der ersten Runde eine massive Konzentration erfolgreicher Anträge auf relativ wenige Universitäten zeigten, wurden auch die öffentlichen Stellungnahmen zusehends deutlicher. So hat der scheidende DFG-Präsident Ernst-Ludwig Winnacker in seiner Abschiedsrede auf der Jahresversammlung der DFG am 31. Mai 2006 den aus seiner Sicht entscheidenden Effekt der Exzellenzinitiative klar benannt, indem er sagte, die Initiative sei mit den bisherigen Förderungen überhaupt nicht zu vergleichen, da sie die gesamte deutsche „Hochschul- und Forschungslandschaft in ungeahnter Weise verändern“ werde. Der von Ex-Bundespräsident Herzog 1997 geforderte „Ruck“ habe in Hochschulen und Wissenschaft „nun in Form eines Erdbebens stattgefunden.“ Die zwischen den Universitäten bereits bestehenden Qualitätsunterschiede würden durch die Exzellenzinitiative weiter wachsen. Neben „reinen Forschungsuniversitäten, die sich auch in der Ausbildung an den Anforderungen moderner wissenschaftlicher Forschung ausrichten, wird es solche geben, die dies nur ansatzweise und in einzelnen Fächern versuchen, solche, die diesen Anspruch erst gar nicht anstreben, und solche, die ihre Stärke eher in der Praxisorientierung suchen“, so Winnackers Resümee (Winnacker 2006: V, IXf.).
Der Prorektor der Universität Heidelberg, Jochen Tröger, hat denselben Sachverhalt in einem Interview mit der Heidelberger Studentenzeitung „ruprecht“ im Juni 2006 plastisch an einem Beispiel verdeutlicht: „Eine Universität wie München macht Top-Forschung, eine Universität wie Oldenburg macht fachbezogen Hochschulausbildung von Leuten, die auch gebraucht werden“, so sein knappes Fazit. Die Wortwahl lässt erkennen, welche Vorstellungen bei den voraussichtlichen Gewinnern in diesem Wettbewerb vorherrschen. Es gibt exzellente Wissenschaftler und „Leute, die auch gebraucht werden“, sprich eine Elite und das Fußvolk. Sein Vorgänger hat das vor zwei Jahren in seiner Begründung harter universitätsinterner Auswahlverfahren genauso ausgedrückt, als er davon sprach, dass „Elite“ und „Masse“ eben nicht zusammenpassen.
Welches Grundprinzip die Exzellenzinitiative dominiert, war vor Verkündung der Wettbewerbsresultate schon unmissverständlich in dem bereits erwähnten ZEIT-Artikel zu lesen. Dort hieß es: „Im Zuge der Exzellenzinitiative wird das Matthäus-Prinzip künftig so stark in der Wissenschaft durchschlagen wie noch niemals zuvor.“ Wer hat, dem wird gegeben. So lautet die Logik des gesamten Wettbewerbs. Die erfolgreichen Anträge konzentrieren sich denn auch auf eine relativ kleine Zahl der insgesamt ca. 100 deutschen Universitäten. Das gilt für die dritte Förderlinie, für die sich von vornherein nur 27 Universitäten beworben hatten, von denen dann 10 in die engere Auswahl gekommen sind; und es gilt auch für die Auswahl der Graduiertenschulen und die Exzellenzcluster, an der sich (bei 135 bzw. 157 Bewerbungen) wesentlich mehr Hochschulen beteiligt haben. Von den 39 Graduiertenschulen, die die erste Runde überstanden haben, sind 18 an nur acht Universitäten angesiedelt (allein acht an den beiden Münchener Universitäten und der RWTH Aachen). Von den 41 noch im Wettbewerb befindlichen Exzellenzclustern vereinigen diese drei Hochschulen sogar neun auf sich. Weitere 14 Cluster entfallen auf noch sieben Universitäten, auf ganze 10 Universitäten also fast 60 Prozent.
Diese Konzentration zeigt deutlich, wohin die im Exzellenzwettbewerb zu vergebenden Mittel fließen werden. Es hat sich eine Spitzengruppe von 10 bis 20 Universitäten herausgebildet, die fast die gesamten Fördermittel abschöpfen werden. Rechnet man die Graduiertenschulen nicht mit (die bei einer Summe von 1 Mio. Euro pro Jahr gegenüber den beiden anderen Förderungstypen weit abfallen), dann sind nur 28 Universitäten überhaupt in die zweite Runde des Wettbewerbs gelangt. Endgültig ausgewählt wird eine noch kleinere Zahl. Die Masse der deutschen Universitäten wird nicht nur beim Exzellenzwettbewerb außen vor bleiben, sie muss schon jetzt mit dem Etikett leben, allenfalls sehr eingeschränkt forschungsfähig zu sein.
Das deutsche Universitätswesen steht vor einer dauerhaften Aufspaltung in zwei Typen von Universitäten, Forschungs- und Ausbildungsuniversitäten. An den Ersteren wird die Forschung konzentriert, Letztere werden kaum noch forschen, sondern (wie heute schon die Fachhochschulen) zügig auf einen Beruf hin ausbilden. Wie ein solches System aussehen dürfte, zeigt eine ungewöhnlich klare Aussage des früheren Berliner Wissenschaftssenators George Turner im Tagesspiegel vom 5. März 2006: „Offiziell bleibt es dabei: Die Fachhochschulen sollen ausgebaut werden. Heimlich aber hat man sich von diesem Ziel verabschiedet, indem ‚bis zu zehn’ Spitzenuniversitäten besonders gefördert werden sollen. Das heißt im Klartext: Der Rest der Universitäten wird zwar förmlich nicht zurückgestuft, de facto aber in die untere Liga eingeordnet. … Die Universitäten, welche nicht den Sprung in die ‚1.Liga’ schaffen – und das wird die überwiegende Mehrheit sein –, und die Fachhochschulen werden näher zusammengerückt. Auch wenn es kaum vorstellbar ist, dass es nur in fünf Bundesländern so genannte Elite-Universitäten geben soll, und es deshalb denkbar ist, dass die Vorgabe ‚bis zu zehn’ ins Wanken geraten könnte – von den knapp hundert staatlichen Universitäten werden die meisten zusammen mit den Fachhochschulen dem ‚Rest’ angehören.“ [1]
Die flächendeckende Ersetzung der alten Uni-Abschlüsse Diplom und Staatsexamen zugunsten von Bachelor und Master ist eine wichtige Voraussetzung für diese Aufspaltung. Die in erster Linie für die studentische Ausbildung zuständigen Massenuniversitäten sollen die Masse der Bachelor-Absolventen schnell durch das Studium schleusen, um den zu erwartenden Studierendenberg ohne zusätzliche Personalstellen bewältigen zu können. Da nach dem Willen der meisten Wissenschaftsminister weniger als die Hälfte, in der Regel nur um die 30 Prozent der Studierenden nach dem Bachelor noch weiter an der Universität bleiben sollen, ist für eine (mehr oder minder) große Mehrheit der Studierenden ein Einblick in wissenschaftliche Forschung gar nicht mehr vorgesehen. Einzig kleinen auserwählten Gruppen wird der Blick in die Forschung vor dem ersten berufsqualifizierenden Abschluss gewährt. Die anderen müssen bis zum Masterstudium warten. Doch auch hier wird sich die Spaltung weiter fortsetzen. Wie die klassischen Technischen Hochschulen (die sog. T9) schon beschlossen haben, werden sie den Bachelor als Zugangsberechtigung zum Master nur dann ohne weitere Prüfungen anerkennen, wenn er an einer ihrer Mitgliedshochschulen gemacht worden ist. Das heißt, die sich selbst zur Elite zählenden Universitäten beginnen schon jetzt, sich gegenüber den anderen abzuschotten.
Die Geistes- und Sozialwissenschaften als große Verlierer
Die Aufspaltung der Hochschullandschaft betrifft nicht nur die Universitäten als Ganze, sie geht auch mit einer Verschiebung der Relationen zwischen den fünf großen Wissenschaftsgebieten (Geistes-, Sozial-, Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie Medizin) einher. Seit die Ergebnisse der ersten Runde des Exzellenzwettbewerbs veröffentlicht worden sind, herrscht unter den Geistes- und Sozialwissenschaftlern Enttäuschung bis Entsetzen. Die Bilanz ist ernüchternd. Ein einziges Projekt mit erkennbar geisteswissenschaftlichem Schwerpunkt hat bei den Exzellenzclustern die erste Runde überstanden, und mit gutem Willen zählen bestenfalls vier von insgesamt 41 ausgewählten Clustern zum weiteren Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften. Über ein Drittel der im ersten Durchlauf positiv bewerteten Cluster entfällt demgegenüber auf die Medizin und jeweils ein gutes Viertel auf die Natur- und Ingenieurwissenschaften. Die Verteilung der Mittel ist damit noch deutlich ungleichgewichtiger als in den Hochschuletats, wo die Geistes- und Sozialwissenschaften schon jetzt massiv benachteiligt sind. Sie bekommen, obwohl bei ihnen ungefähr doppelt so viele Studierende eingeschrieben sind wie in den Natur- und Ingenieurwissenschaften, nur halb so viel Geld. Im Exzellenzwettbewerb ist es nicht einmal mehr ein Fünftel.
Im Nachhinein entlarven sich Aussagen des Wissenschaftsrats und der DFG, die der Beruhigung skeptischer Geistes- und Sozialwissenschaftler dienen sollten, als weitgehend folgenloses Gerede. Was nützt es, wenn unmittelbar vor der Entscheidung von der Koordinatorin der DFG für die Exzellenzcluster mitgeteilt wird, dass man angenehm überrascht sei von der hohen Zahl der Antragsskizzen aus den Geisteswissenschaften, (insgesamt immerhin ein Viertel der 157 Anträge), und darauf auch besonders stolz, weil der DFG immer vorgeworfen werde, „die Geisteswissenschaften bei der Förderung von Drittmitteln im Vergleich zu anderen Disziplinen zu vernachlässigen“. Letztlich bestätigt die Entscheidung ja diesen Eindruck. Es ist genau das eingetreten, was die Skeptiker befürchtet haben. In der zweiten Förderlinie spielen die Geistes- und Sozialwissenschaften kaum eine Rolle. Die zwei Wochen später veröffentlichte Erklärung des Wissenschaftsrats, die „Stärkung der Geisteswissenschaften in den Universitäten“ sei sein „zentrales Anliegen“, ändert daran aber nichts. Sie bleibt ein Lippenbekenntnis.
Leistungs- oder Matthäusprinzip?
Die erwähnte Abschiedsrede des DFG-Präsidenten Winnacker enthält zwei interessante Passagen, die sich mit den beiden zentralen Einwänden gegen die Exzellenzinitiative beschäftigen: Handelt es sich beim Exzellenz-Wettbewerb wirklich um einen fairen Leistungswettbewerb? Und wie sehen die Folgen für die soziale Zugänglichkeit der deutschen Hochschulen aus? Angesichts der eindeutigen Resultate der ersten Runde verzichtet Winnacker hier auf die zuvor stets obligatorische Bemerkung, dass selbstverständlich jede Universität eine Chance habe, und räumt eine gravierende Verzerrung der Wettbewerbsbedingungen ein. Die unterschiedliche finanzielle Ausgangslage in den einzelnen Bundesländern sorge dafür, dass „kein wirklicher Wettbewerb um Ressourcen aller Art, auch nicht um Ressourcen für die Forschung stattfinden“ könne und die Universitäten im Süden der Republik einen entscheidenden Vorteil besäßen. Nachdem die Exzellenzinitiative politisch durchgesetzt ist, kann man jetzt offensichtlich realistischere Aussagen treffen. Winnacker wirft sogar die Frage nach den Spielregeln auf, weil es immer nur dieselben seien, die gewännen. Seine Lösung: eine Gebietsreform. Erst eine Reduzierung auf wenige Bundesländer könne „das Verhältnis Sieger/Verlierer in der Forschungsförderung“ wirklich umkehren (Winnacker 2006: VI).
So zutreffend Winnackers Kritik am bundesdeutschen Föderalismus sein mag [2], den entscheidenden Punkt benennt er damit nicht. Selbst wenn es weniger Bundesländer gäbe und die Unterschiede zwischen ihren Hochschuletats geringer ausfielen als derzeit, hätte das Prinzip des Exzellenzwettbewerbs, die Starken zu stärken, im Endeffekt die gleiche Wirkung. Das Beispiel Bayern als eines der reichen Bundesländer zeigt das deutlich. Unter den Gewinnern befinden sich, das war auch vorher jedem informierten Beobachter klar, die beiden Münchener Universitäten; unter den Verlierern sind, auch das hat man wissen können, die Neugründungen der 1970er Jahre wie Bamberg, Bayreuth oder Passau. Die Ausgangsbedingungen sind einfach viel zu unterschiedlich, von der finanziellen Ausstattung über die Tradition (inkl. der traditionellen Beziehungen zu den wichtigen Drittmittelgebern) bis hin zum wissenschaftlichen Umfeld (Max-Planck-Institute, Fraunhofer- Institute etc.).
Wenn Winnacker darauf verweist, dass auch heute schon fast die Hälfte der DFG-Fördergelder an nicht einmal 20 Universitäten fließt, so zeigt das die historisch gewachsenen Differenzen. Über die tatsächliche Leistungsfähigkeit sagt es jedoch weit weniger aus, als die Zahlen auf den ersten Blick vermuten lassen. Ulrich Teichler demonstriert dies in seinem Buch „Hochschulstrukturen im Umbruch“ sehr eindrücklich anhand der DFG-Mittelvergabe der Jahre 1999 bis 2001. Damals gingen 32 Prozent dieser Mittel an die in diesem Ranking führenden zehn Universitäten, weitere 25 Prozent an die nächsten zehn, d.h. 57 Prozent an die besten 20 Universitäten, gerade einmal halb so viel an die nächsten 20 Universitäten und nur ganze acht Prozent an die auf den Plätzen 41 bis 50 rangierenden – scheinbar ein klarer Beleg für die enormen Leistungsunterschiede im deutschen Universitätssystem. Berücksichtigt man aber die Zahl der jeweils beschäftigten Wissenschaftler und rechnet nicht pro Hochschule, sondern pro Wissenschaftler, so ergibt sich ein weit weniger eindeutiges Bild. Zwar liegen die ersten zehn Universitäten mit ca. 61.000 Euro pro Kopf auch dann noch deutlich vorn, der Unterschied zu den Universitäten auf den Plätzen 41 bis 50, die es auf ca. 32.000 Euro bringen, fällt aber nur halb so hoch aus, wie die generellen Anteile es vermuten ließen. Lässt man die ersten zehn Universitäten außer Betracht, verringern sich die Differenzen noch einmal spürbar. Sie liegen dann nur noch zwischen ca. 46.000 Euro für die zweitbeste und 32.000 Euro für die fünfte Gruppe. Bei Berücksichtigung der Fächerverteilung würden die Unterschiede sogar noch weiter abnehmen. Teichler zeigt das am Beispiel Nordrhein-Westfalens, wo um die Jahrtausendwende, gewichtet man die Fächergruppen, unter den multidisziplinären Universitäten die am wenigsten erfolgreiche pro Kopf immerhin noch 70 Prozent der Mittel einwerben konnte, die der erfolgreichsten zuteil wurden (Teichler 2005: 269).
Für riesige oder entscheidende Leistungsunterschiede sprechen diese Zahlen nicht. Teichler ist in seiner Einschätzung zuzustimmen, dass die Differenzen innerhalb der einzelnen Fakultäten in der Regel viel größer seien als die Unterschiede zwischen den Fakultäten oder gar den Hochschulen. Nicht ganze Fakultäten oder Hochschulen seien als exzellent beurteilt worden, sondern immer nur einzelne Wissenschaftler. In Zukunft, so Teichler, sei unter rein wissenschaftlichen Gesichtspunkten sogar damit zu rechnen, dass die Bedeutung der wissenschaftlichen Kooperation vor Ort und damit der Stellenwert der Hochschulen als Ganzen aufgrund der zunehmenden Spezialisierung und der dramatisch beschleunigten und erleichterten Kommunikationsmöglichkeiten noch weiter zurückgehen werde. Versuche, Fakultäten oder gar Hochschulen nach Qualität in Rangordnungen zu bringen, ähnelten daher immer mehr einem „Glasperlenspiel“ (ebd.: 338f.).
Die Exzellenzinitiative macht nun aber genau das. Sie stellt auf der Ebene der kompletten Universitäten grundsätzliche Unterschiede fest zwischen „exzellent“ auf der einen und „durchschnittlich“ auf der anderen Seite, sprich zwischen Elite und Masse, zementiert sie in einem Ranking und weitet sie auf Dauer weiter aus. Die von Winnacker angesprochenen knapp 20 Universitäten werden im Rahmen der Initiative nicht nur fast die Hälfte, sondern vermutlich über 90 Prozent der zu vergebenden Mittel auf sich vereinigen. Zudem, und das ist der wichtigere Punkt, wird der Exzellenzwettbewerb die Rangfolge verewigen. Er schafft erst jene grundlegenden Unterschiede, die zu messen er vorgibt.
Die Hochschulen, die jetzt nicht zu den Gewinnern zählen, werden sich auch in Zukunft unwiderruflich im Hintertreffen befinden. Das gilt zunächst ganz unmittelbar finanziell, denn die Länder werden ja nicht nur ihren 25prozentigen Anteil an den Kosten der Exzellenzinitiative, sollten Universitäten aus ihrem Bundesland erfolgreich sein, finanzieren müssen, sie müssen nach dem Rückzug des Bundes aus dem Hochschulbau auch an diesem Punkt eine größere finanzielle Last tragen als bislang. Außerdem müssen die im Wettbewerb siegreichen Universitäten ab 2012 wieder mit den eigenen Mitteln haushalten, weil dann die Finanzierung über die Exzellenzinitiative ausläuft. Um das Niveau halten zu können, werden sie ab diesem Zeitpunkt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mehr Landesmittel bekommen. Bei realistischer Betrachtung bedeutet das: Um diese zusätzlichen Gelder aufbringen zu können, müssen die Länder woanders sparen. Allen augenblicklichen Verlautbarungen zum Trotz dürfte das auf Kosten der Verlierer des Wettbewerbs gehen. Dass anders lautende offizielle Aussagen vorrangig der Beruhigung dienen und in der Regel nur recht wenig mit der Realität zu tun haben, zeigen die Erfahrungen der letzen Jahre. Jeder Hochschulangehörige kann inzwischen ein trauriges Lied über gebrochene Hochschulpakte und andere nicht eingehaltene Vereinbarungen zwischen Landesregierungen und Hochschulen singen.
Zu den unmittelbaren finanziellen Folgen des neuen Verteilungsprinzips kommen jene Auswirkungen hinzu, die es auf die Mittelverteilung auf Länderebene hat. Die Hochschulen, die zu den Gewinnern zählen, werden dabei ungleich bessere Karten haben als der Rest. Wie das zukünftige Verteilungsprinzip sich auswirken wird, lässt die seit 2004 gültige leistungsorientierte Mittelverteilung in Nordrhein-Westfalen erahnen. Alle Sachmittel – jeder fünfte Euro, der aus Landesmitteln an die Hochschulen fließ – werden in NRW heute nach diesem Prinzip verteilt. Während früher die Anzahl der Wissenschaftler und der Umfang der eingeworbenen Drittmittel mit jeweils 20 Prozent gleich gewichtet wurden, geht der erstgenannte Faktor jetzt nur noch mit 7,5 Prozent in die Berechnung ein, die Drittmittel dagegen mit 27,5 Prozent. Das fällt um so schwerer ins Gewicht, als heute zusätzlich zu den Sachkosten für Forschung und Lehre auch die Mittel für allgemeine Aufgaben wie etwa die Bibliotheken oder das Rechenzentrum sowie die Verwaltungs- und Energiekosten aus diesem Etat bezahlt werden müssen. Am stärksten profitieren von diesem in NRW praktizierten Modell der Mittelverteilung wird die RWTH Aachen, auf die über ein Viertel der Drittmitteleinnahmen aller 25 nordrhein-westfälischen Hochschulen entfällt. Verlierer werden in erster Linie die Neugründungen und die früheren Gesamthochschulen sein. Der Rektor der Universität Wuppertal hat die Folgen für seine Hochschule im Januar dieses Jahres mit den Worten charakterisiert, dass Wuppertal „Jahr für Jahr mit ‚Kellertreppeneffekt’, wie bei negativer Zinseszinsberechnung, erhebliche Mittel“ verliere, die dann anderen Hochschulen zugute kämen. Es sei „eine Umverteilung im Land“, die jetzt stattfinde. Diese Entwicklung wird durch die Exzellenzinitiative weiter beschleunigt und verstärkt.
Die Sieger des Exzellenz-Wettbewerbs werden in den nächsten Jahren ihre überlegene Position auch bei der Konkurrenz um die guten Wissenschaftler und die guten Studierenden ausbauen können. Dank ihrer spürbar besseren finanziellen Ausstattung und des beträchtlichen Imagegewinns werden sie bei beiden Gruppen deutlich an Attraktivität zulegen. Sie haben die besten Chancen, sich bei den jetzt üblich gewordenen hochschulinternen Auswahlverfahren die leistungsstärksten Studierenden herauszufiltern. Auf diesem Wege können sie gleichzeitig noch ein zweites Ziel erreichen, die Zahl der Studienplätze spürbar zu reduzieren. Sollte es zudem gelingen, die Kapazitätsverordnung abzuschaffen, wäre es ihnen sogar möglich, exklusive Elitestudiengänge mit einer ganz kleinen Zahl von Studierenden einzurichten, ohne die bisherigen Beschränkungen beachten zu müssen. Klein und fein, so heißt die neue Devise. Der Rektor der Universität Mannheim, der Jurist Wolfgang Arndt, hält konsequenterweise die Forderung, die Hochschulkapazitäten wegen des zu erwartenden drastischen Anstiegs der Studierendenzahl auszubauen, für unsinnig und überflüssig, weil sich die Massenuniversität „völlig überlebt“ habe. Kurt von Figura, der Präsident der Universität Göttingen, will die Zahl der Studierenden an seiner Hochschule mittelfristig sogar sogleich um ein Drittel reduzieren, um ihr Profil als forschungsintensive und medizinisch-naturwissenschaftlich ausgerichtete Universität schärfen zu können.
Die Einführung von Studiengebühren unterstützt diese Entwicklung, weil sie auf Dauer zu einer Differenzierung der Gebühren je nach Hochschule führen wird. Wohin die weitere Entwicklung gehen wird, deutet der erste Gesetzesentwurf zum Studienbeitragsgesetz aus Hessen an. Er sah vor, dass die Hochschulen ab dem WS 2007/08 für alle nichtkonsekutiven Masterstudiengänge (ab dem WS 2010/11 auch für die konsekutiven), alle Promotionsstudiengänge und alle Nicht-EU-Ausländer bis zu 1.500 Euro verlangen können. Zwar haben die massiven Proteste an den hessischen Hochschulen im endgültigen Gesetzentwurf eine direkte Umsetzung dieser Vorstellungen verhindern können, die Pläne bleiben aber in den Schubladen der Ministerien. Eine zukünftige Eliteuniversität wird in Zukunft erheblich höhere Gebühren verlangen können als eine „normale“ Massenuniversität [3] und nach dem Vorbild der USA dafür günstigere Studienbedingungen bieten. Die Massenuniversitäten dagegen müssten mit noch schlechteren Bedingungen als schon heute aufwarten, wären dafür aber auch preisgünstiger als die Topadressen. Die Aufspaltung der Hochschullandschaft würde noch weiter vorangetrieben.
Die Verlierer des Exzellenzwettbewerbs werden in jeder Hinsicht an Boden einbüßen. Von einer neuen Chance „beim nächsten Mal“ kann deshalb keine Rede sein. Wenn Politiker und Vertreter der federführenden Wissenschaftsorganisationen (Wissenschaftsrat und DFG) immer wieder betonen, dass – da ausschließlich die Leistung entscheide – eine Hochschule, die jetzt nicht unter den Gewinnern sei, durch eigene Anstrengung das Ziel durchaus noch erreichen könne, so hat das mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun. Von einer möglichen Umkehrung des Verhältnisses zwischen Gewinnern und Verlierern kann keine Rede sein. Wer einmal oben ist, wird in der Regel oben bleiben. Die Eliteuniversitäten in den anderen führenden Industrieländern zeigen das sehr deutlich (Hartmann 2004: 109 ff.).
Dasselbe gilt auch mit Blick auf die einzelnen Fachdisziplinen. Von gleichen Chancen kann auch hier nicht die Rede sein. Dafür haben die Kriterien des Exzellenzwettbewerbs schon gesorgt. Die in der Bund-Länder-Vereinbarung als entscheidend geforderte „internationale Sichtbarkeit“ lässt sich in den Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie der Medizin, in denen internationale Großprojekte alltäglich sind, in denen weltweit bekannte Preise (wie vor allem der Nobelpreis) vergeben werden und in denen die nationale Sprache und Kultur keine oder allenfalls eine sehr untergeordnete Rolle spielen, sehr viel leichter herstellen als in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Auch lässt sich die in derselben Vereinbarung als wichtige Voraussetzung angeführte „wirtschaftliche Relevanz“ von ihnen ungleich einfacher nachweisen. Dass der DFG-Präsident Ernst-Ludwig Winnacker schon vor der Antragstellung davon sprach, die Exzellenzcluster sollten „weitgehend dem Modell der DFG-Forschungszentren“ entsprechen, hätte hellhörig machen können. Von den derzeit geförderten Zentren kommt nämlich kein einziges aus dem Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften.
Wenn der Historiker Ulrich Herbert, einer der Geisteswissenschaftler in der Kommission, im Tagesspiegel vom 27. Januar 2005 offen sagt, die Exzellenzinitiative sei „nicht der Ort, an dem die Stärken der Geisteswissenschaften sichtbar werden“, und gleichzeitig ihre Leistungsfähigkeit im internationalen Vergleich mit den Worten rühmt, „nirgendwo in der Welt ist die Dichte und Qualität der Fächergruppe so hoch wie in Deutschland“, dann wird eines deutlich: die Geistes- wie auch die Sozialwissenschaften sind nicht an ihrer mangelnden Qualität gescheitert, sondern an den strukturellen Vorgaben des gesamten Wettbewerbs. Der öffentliche Anspruch der Initiative, bei ihr gehe es ausschließlich um die Leistung und um nichts anderes, entspricht offensichtlich nicht der Realität, denn niemand kann ernsthaft behaupten, die medizinische Forschung hierzulande sei mehr als dreimal so leistungsstark wie die in den gesamten Geistes- und Sozialwissenschaften.
Die Eliteuniversitäten in den USA
Die USA mit ihrem traditionell hierarchisch sehr tief gestaffelten Hochschulsystem und ihren in der öffentlichen Meinung fest verankerten Rankings zeigen sehr deutlich, wie sich der mit der Exzellenzinitiative auch in Deutschlands Hochschulsystem Einzug haltende Mechanismus auf Dauer auswirken wird. Seit die Zeitschrift U.S. News & World Report Mitte der 1980er Jahre das erste Ranking veröffentlicht hat, haben Harvard, Princeton und Yale als die drei reichsten Hochschulen des Landes fast durchweg die ersten drei Plätze belegt. Einzig Stanford und das California Institut of Technology (CalTech) haben diese Phalanx einmal durchbrechen und sich an der Spitze platzieren können. Auch auf den übrigen Plätzen gab es in der Regel nur einen Wechsel zwischen den immer gleichen Universitäten, darunter stets alle acht Ivy-League-Hochschulen. So pendelt die University of Pennsylvania z.B. kontinuierlich zwischen den Plätzen vier und zehn und Cornell zwischen den Plätzen neun und vierzehn. Bemerkenswerte Veränderungen gab es in den beiden vergangenen Jahrzehnten nur zwei. Zum einen ist die Zahl der öffentlichen Einrichtungen unter den Top-Universitäten kontinuierlich gesunken. Waren anfangs noch sechs unter den ersten 20 vertreten, findet sich jetzt keine einzige mehr dort. Berkeley rangiert als beste staatliche Hochschule seit Jahren auf Platz 21. An die Stelle der staatlichen Einrichtungen sind private Universitäten wie CalTech (1987 noch auf Platz 21), Emory (1987 noch auf Platz 25) oder die damals unter den Top 25 überhaupt noch nicht vertretenen Universitäten Notre Dame und Vanderbilt gerückt. Zum anderen waren Ende der 1990er Jahre mit Stanford sowie CalTech und dem Massachusetts Institut of Technology (MIT) gleich drei stark technisch ausgerichtete Universitäten zeitweise unter den besten sechs zu finden. Beide Entwicklungen haben im Kern dieselbe Ursache, die den jeweiligen Hochschulen zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen. Der Niedergang der staatlichen Universitäten erfolgte parallel zur deutlichen Reduzierung der staatlichen Hochschuletats, und der Aufstieg von Stanford, noch mehr aber der von CalTech und MIT, war mit dem High-Tech- und Internet-Boom der späten 1990er Jahre und den daraus resultierenden Einnahmemöglichkeiten (vor allem in Form von Spenden erfolgreicher Absolventen in den einschlägigen Branchen) untrennbar verknüpft. Auch in den USA gilt, dass diejenigen im Ranking am besten abschneiden, die über das meiste Geld verfügen.
Die aufgrund der historischen Entstehungsbedingungen existierenden Unterschiede – die Ivy-League-Hochschulen z.B. als traditionelle Ausbildungsstätten für die Upper Class –werden durch das inzwischen fest etablierte Ranking von U.S. News & World Report weiter verstärkt und zementiert. Dafür sorgt vor allem die Bedeutung, die dem Prestige, d.h. in erster Linie der Rankingposition, bei der Auswahl der bevorzugten Hochschule mittlerweile zukommt. [4] Das Prestige ist der wichtigste Faktor geworden, noch vor der akademischen Qualität. Es spielt eine umso größere Rolle, je renommierter die Universität ist. So wird das Prestige in Harvard von über 80 Prozent der Bewerber als sehr oder extrem wichtig bezeichnet, die akademische Qualität dagegen nur von zwei Dritteln (Greene/Greene 1999: 20f., 264 ff.). Der entscheidende Grund hierfür ist in der Tatsache zu suchen, dass der Abschluss an einer der im Ranking führenden Hochschulen später die besten Berufsaussichten eröffnet, und das auch unabhängig von der tatsächlichen Qualität der Ausbildung.
Die nämlich ist im Undergraduate-Bereich vielfach weit schlechter, als man angesichts der renommierten Namen vermuten würde (Kirp 2003: 66 ff.; Newman et.al. 2004: 51 ff., 137 ff.). Große Teile der Lehre werden von Graduate Students und schlecht bezahlten Lehrbeauftragten übernommen, an manchen bekannten Universitäten bis zu 70 Prozent von Letzteren (Kirp 2003: 68; Newman et.al. 2004: 58f.). Die Professoren, vor allem die bekannteren unter ihnen, sehen Undergraduates dagegen in der Lehre kaum. Je renommierter und damit gefragter ein Professor ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er von einem Teil seiner (sowieso schon nicht sehr umfangreichen) Lehrverpflichtungen freigestellt wird. Das angesehene American Council of Trustees and Alumni hat folgerichtig in einer Untersuchung der Lehrqualität von 50 renommierten Hochschulen nur zweien der acht Ivy-League-Institutionen wenigstens eine drei als Note gegeben. Die anderen brachten es nur auf Noten zwischen vier und sechs. Auch Berkeley, Northwestern oder Wisconsin-Madison erhielten sämtlich eine sechs (Latzer 2004, S. 15, 19, 23). Die öffentliche Diskussion interessiere sich nur für den Aufnahmeprozess, d.h. für die Frage, wie man in die Universitäten gelange, und die beruflichen Karrieren, d.h. die Frage, was man mit den Abschlüssen erreichen könne. Das sei ein „nationaler Skandal“, so formuliert es ein Beobachter drastisch (Fallows 2005: 44f.). Die geringe Beachtung, die der Lehre zuteil wird, ist eine konsequente Folge des Gewichts, das ihr beim Ranking zukommt. Direkt spielt sie überhaupt keine Rolle, indirekt nur über die Kriterien Kursgröße und Verhältnis Lehrende/Studierende. Sie machen zusammen gerade einmal 10 Prozent der Bewertung aus. Das auf den ersten Blick ebenfalls dazu gehörende und mit 16 Prozent gewichtigere Kriterium der Abschlussquote sagt seinerseits wenig über die Lehrqualität aus. Es reflektiere nur, so Richard Hersh, ehemals Direktor des Harvard Center of Moral Education und Präsident angesehener Hochschulen, das Prinzip „diamonds in, diamonds out, garbage in, garbage out“ (Hersh 2005: 230).
Wirklich entscheidend für die Position im Ranking sind zwei Faktoren, die akademische Reputation als Einzelkriterium mit 25 Prozent und die finanziellen Ressourcen mit insgesamt ebenfalls ca. 25 Prozent, die sich auf die Kriterien Bezahlung der Hochschullehrer, Ausgaben pro Studierendem und Spendeneinnahmen verteilen. Beide begünstigen massiv jene Universitäten, die wie Harvard, Princeton und Yale auf eine lange Tradition in der Ausbildung des Nachwuchses der Upper Class und einen dementsprechend hohen Kapitalstock sowie zahlreiche finanzkräftige Spender verfügen. Sie haben nicht nur das meiste Geld, sie können damit auch im Wettbewerb um die begehrten Wissenschaftler erfolgreicher als die Konkurrenz sein, wie die aktuellen Klagen des vergleichsweise armen und finanziell immer weiter zurückfallenden Berkeley zeigen, und so ihre Reputation [5] kontinuierlich erhöhen. Finanzkraft und Reputation bilden einen sich stetig verstärkenden Kreislauf, der mittels der Rankingposition auch den mit 15 Prozent drittwichtigsten Rankingfaktor entscheidend bestimmt und mit einbezieht, die Selektivität in der Auswahl der Studierenden. Je finanzkräftiger eine Universität und je größer ihr Renommee, desto höher ihre Rankingposition und damit auch die Anzahl von Bewerbern mit exquisiten Testergebnissen in den landesweiten Eignungstests (SAT) sowie der Prozentsatz dieser besonders qualifizierten Bewerber, die letztlich doch eine Absage bekommen. Je höher diese Quote, umso besser für das Ranking, was wiederum die Zahl der besonders leistungsstarken, aber auch die der besonders zahlungskräftigen Bewerber in die Höhe treibt und damit die finanziellen Ressourcen stärkt und so weiter und so weiter – ein perfekter Mechanismus aus Sicht der Gewinner, ein teuflischer aus Sicht der Verlierer. Von gleichen Chancen für alle oder zumindest einen größeren Teil der konkurrierenden Hochschulen kann keine Rede sein. Nicht das Leistungsprinzip ist entscheidend, sondern das Matthäusprinzip.
Steigerung der sozialen Selektivität
Zur Frage, wie sich die Aufspaltung des Universitätssystems auf die soziale Rekrutierung der deutschen Studierenden auswirken wird, bemerkt Winnacker in seiner Rede zunächst lapidar, dass diese Entwicklung „nicht im Widerspruch zu der berechtigten Forderung stehen [müsse], unsere Hochschulen Studierenden aller gesellschaftlichen Schichten zu öffnen“, und fährt fort, dass man gut beraten wäre, „allen Absolventen eines Jahrgangs diejenigen Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten, die ihrer jeweiligen intellektuellen Kapazität angemessen“ seien, dass indes das „menschliche Potential, um 90 Spitzenuniversitäten in Deutschland zu bedienen, [aber] schlichtweg nicht vorhanden“ sei (Winnacker 2006: X).
Auch wenn der letzte Teil dieser Aussage zweifellos richtig ist – diesen Anspruch erhebt aber niemand und kein Land der Welt könnte ihm gerecht werden –, stellt sich doch die Frage, welche Konsequenzen die Exzellenzinitiative für die soziale Zugänglichkeit der Hochschulen tatsächlich haben wird. Was bedeutet es konkret, dass die beschriebene Entwicklung „nicht im Widerspruch“ zum Anspruch eines offenen Zugangs für alle Schichten stehen müsse und allen Absolventen angemessene Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten seien? Auch hier lohnt ein Blick in die USA, das explizite oder zumindest implizite Vorbild für die meisten Umstrukturierungen im deutschen Hochschulwesen, um erahnen zu können, wohin die Reise gehen wird bzw. was mit solchen eher kryptischen Formulierungen gemeint ist.
In den USA verteilen sich die Studierenden auf über 4.000 Hochschulen ganz unterschiedlicher Qualität, von zweijährigen Community Colleges auf dem Niveau deutscher Oberstufen über vierjährige öffentliche Colleges, die in ihrer Qualität von Technikerschulen bis hin zu Berufsakademien reichen, sowie auf staatliche und private Universitäten auf Fachhochschulniveau bis hin zu den berühmten Leuchttürmen der Wissenschaft. Den deutschen Fachhochschulen vergleichbar sind ungefähr 250 dieser Einrichtungen, den deutschen Universitäten ca. 150, die so genannten Doctoral/Research Universities – Extensive. Generell gilt dabei die Regel, dass die soziale Zusammensetzung der Studierenden an diesen Hochschulen umso exklusiver ist, je höher sie in der Hierarchie rangieren und je teurer sie sind. Die untere Hälfte der Bevölkerung schickt ihre Kinder zu fast 90 Prozent auf jene der über 4.000 Hochschulen, die sich bestenfalls auf dem Niveau von Berufsakademien bewegen. Nahezu jedes zweite dieser Kinder geht sogar nur auf eines der Zwei-Jahres-Colleges. Auf die teuren Privatuniversitäten schaffen es gerade einmal drei Prozent von ihnen. Vom Nachwuchs aus reichen Familien geht dagegen jeder fünfte dorthin (Hartmann 2005b: 441f.). Die soziale Zusammensetzung der Studierenden sieht entsprechend aus. An den genannten ca. 150 Research Universities stammen weniger als 10 Prozent aus der unteren Hälfte der Bevölkerung, 74 Prozent kommen aus dem oberen Viertel (Carnevale/Rose 2004: 106; CollegeBoard 2004: 33). Die Rekrutierung ist damit sozial erheblich selektiver als an den deutschen Universitäten, wo allerdings auch bereits zwei Drittel der Studierenden aus dem oberen Drittel der Bevölkerung stammen. Die privaten Eliteuniversitäten sind noch sehr viel exklusiver. Vier von fünf Studierenden kommen dort aus dem oberen Fünftel der Gesellschaft. Jeder fünfte stammt sogar aus den obersten zwei Prozent mit Familienjahreseinkommen von mehr als 200.000 Dollar. Die oberen zwei Prozent der Bevölkerung stellen damit genau so viele Studierende wie die unteren vier Fünftel (Hartmann 2005b: 454; Hill et.al. 2004: 6).
An den US-Eliteuniversitäten sorgen neben den sehr hohen Studienkosten (Hartmann 2005b) vor allem die Auswahlprozeduren für die massive soziale Selektivität. Die Entscheidung über Aufnahme oder Ablehnung erfolgt nach zwei zentralen Kriterien: der in erster Linie durch die SAT-Scores gemessenen intellektuellen Leistungsfähigkeit und der Persönlichkeit der Bewerber. Das zweite Kriterium wurde in den 1920er Jahren zunächst in Harvard, Princeton und Yale eingeführt (wie eine Untersuchung der Aufnahmeprozesse an diesen Hochschulen während des 20. Jahrhunderts zeigt, Karabel 2005). Angesichts des großen Erfolgs jüdischer Bewerber, die ihren Anteil an den Studierenden auf ein Fünftel hatten steigern können, drohte die Abwanderung traditioneller Upper-Class-Kinder, wie sie an der Columbia University schon zu beobachten war. Man ging man deshalb von dem zuvor fast ausschließlich auf intellektuelle Leistung orientierten Auswahlmodus ab. Der Charakter wurde zum neuen zentralen Kriterium. Auf diese Art konnte man sicherstellen, dass der Anteil der jüdischen Studierenden die Marke von 10 Prozent nicht nennenswert überstieg und die Studienplätze auch weiterhin vorwiegend an den Nachwuchs aus den wohlhabenden Familien des Landes vergeben wurden. Das erschien angesichts der zum Teil heftigen Proteste vieler Alumni erforderlich, wollte man nicht riskieren, dass der Spendenfluss spürbar abnahm.
Bis heute hat sich an diesem Prinzip trotz der seit den 1970er Jahren wieder stärkeren Betonung intellektueller Leistungen im Grundsatz nichts geändert. Karabel schildert das sehr eindrücklich. Offiziell betont werden (wie von dem die gesamten 1990er Jahre amtierenden Präsidenten von Harvard, Neil Rudenstine) erwünschte Eigenschaften wie Charakter, Energie, Neugier und Entschlossenheit. Was die für die Kandidatenauslese zuständigen Alumni und Admissions-Committee-Mitglieder indes tatsächlich prämieren, ist vor allem eines: Übereinstimmung mit ihren eigenen Einstellungen, Verhaltens- und Denkweisen, d.h. letztlich soziale Ähnlichkeit. [6] Karabel zitiert aus den Protokollen der Admissions Committees dieser Zeit Passagen, die überdeutlich zeigen, wie oberflächlich und von persönlichen Vorurteilen oder Vorlieben geprägt die Beurteilungen zum Teil zustande kommen. So sind dort Kommentare zu finden wie „klein mit großen Ohren“ oder „ein junger Mann mit Igel-Haarschnitt“, Kommentare, die kaum etwas Substanzielles über die offiziell betonten Charaktereigenschaften verraten. Besonders klar offenbart sich das Ausleseprinzip in folgender Bewertung: „Diese junge Frau könnte eine der intelligentesten Bewerberinnen im Kandidatenpool sein, doch gibt es mehrere Hinweise auf Schüchternheit und der Alumni IV [Interviewer] ist negativ“ (Karabel 2005: 509f.). Wen man sich vorstellt, wie sich jemand in einem solchen Auswahlgespräch präsentiert, der aus einer Farmer- oder Arbeiterfamilie stammt und zudem vielleicht auch noch aus einer kleineren Stadt im Mittleren Westen der USA, dann lässt sich unschwer erahnen, woher die kritisierte Schüchternheit rührt. Das Kind eines Wall-Street-Bankiers oder eines Professorenehepaars dürfte da ganz anders auftreten, weil es in der Regel nicht nur die Codes dieser Kreise seit Kindesbeinen verinnerlicht hat, sondern weil auch sein Wissen um die konkreten Prozeduren des Verfahrens größer und seine Angst entsprechend geringer ist. [7] Von gleichen Chancen für alle Bewerber kann also selbst dann nicht gesprochen werden, wenn man die je nach sozialer Herkunft sehr unterschiedlichen Voraussetzungen für den Erwerb intellektueller Fähigkeiten außer Betracht lässt. Klassenzugehörigkeit wirkt im Bewerbungsprozess nicht nur indirekt, sondern auch ganz unmittelbar.
Winnackers Aussage, die mit der Exzellenzinitiative verknüpfte Entwicklung müsse nicht im Widerspruch zum Anspruch auf soziale Öffnung der Hochschulen stehen und jedem müsse die seinen intellektuellen Fähigkeiten angemessene Ausbildungsmöglichkeit angeboten werden, wirkt angesichts der US-amerikanischen Erfahrungen wenig überzeugend und beruhigend. Auch in Deutschland wird die Hierarchisierung der Hochschullandschaft auf Dauer dazu führen, dass sich die Studierenden an den zukünftigen Elite- und Forschungsuniversitäten erheblich stärker als heute aus bürgerlichen und akademischen Familien rekrutieren und die Kinder aus der übrigen Bevölkerung an den Massenuniversitäten und (wie schon heute) den Fachhochschulen zu finden sein werden. Das bedeutet für sie dann „angemessene Ausbildungsmöglichkeit“. Die soziale Selektivität wird insgesamt zweifelsohne zunehmen. Dafür werden nach dem Muster der USA vor allem individuelle Aufnahmeprozeduren [8], eventuell in Kombination mit der Einführung kostenpflichtiger Aufnahmetests [9], und steigende Studiengebühren sorgen. Eliteuniversitäten haben eben vor allem eine gesellschaftliche Funktion. Sie sorgen für die Stabilisierung der gegebenen gesellschaftlichen Machtverhältnisse und damit auch der Strukturen sozialer Ungleichheit.
Eliteuniversitäten – ein Weg zu höherer wissenschaftlicher Leistung oder ein Irrweg?
Aber selbst wenn man sich ausschließlich auf das Argument konzentriert, das die Befürworter der Exzellenzinitiative als wesentlich für die Etablierung von Eliteuniversitäten anführen – die versprochene Steigerung der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit des Hochschulsystems – offenbart der Blick „über den großen Teich“ gravierende Schwächen des Konzepts. Das Vorbild der US-Spitzenuniversitäten ist nämlich auch in dieser Hinsicht nicht so glänzend, wie es dargestellt wird, und, was noch wichtiger ist, auch nicht so einfach kopierbar. Was den ersten Punkt angeht, so sieht es in den USA gerade in den (in der hiesigen Diskussion immer besonders betonten) Natur- und Ingenieurwissenschaften bei weitem nicht so rosig aus, wie gemeinhin angenommen wird. Die Hochschulabschlüsse in diesen Disziplinen haben in den USA zwischen 1975 und 2000 nur noch um ein Drittel zugenommen. In den meisten größeren Industrieländern waren es dagegen zwischen 100 und 500 Prozent. Die USA sind in diesem Punkt folgerichtig vom 3. auf den 15., d.h. den drittletzten Platz zurückgefallen. Die Folgen lassen sich anhand der wichtigen wissenschaftlichen Veröffentlichungen aus diesem Bereich schon jetzt erkennen. Deren Anzahl ist in den USA seit Anfang der 1990er Jahre nicht mehr gestiegen, hat in Westeuropa dagegen um gut 60 Prozent zugenommen. Westeuropa hat die USA inzwischen deutlich überflügelt (Bowen et.al. 2005: 48f., 58f.). Berücksichtigt man, dass vor allem an den US-Eliteuniversitäten über die Hälfte der Natur- und Ingenieurwissenschaftler aus dem Ausland kommt, [10] fällt die Bilanz noch schlechter aus; denn ihre Veröffentlichungen zählen, so lange sie in den USA tätig sind, für die USA mit. Das ist die Kehrseite des Elitesystems. Zum einen lenkt es die Studierenden in die Fächer, die die höchsten Einkommen und damit die besten Möglichkeiten zur Amortisierung der extrem hohen Studienkosten versprechen, und das sind Economics, Law and Medicine. Zum anderen untergräbt die enorme Konzentration der Mittel an wenigen Hochschulen das Niveau an den meisten anderen.
Dieses Problem wird in den USA durch den weltweiten Einkauf von Spitzenwissenschaftlern aus allen Bereichen, speziell aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften, zumindest entschärft; ein Weg, der in Deutschland nicht gangbar sein wird. Das US-Modell ist aufgrund unzureichender finanzieller Ressourcen nicht kopierbar. Um in der Konkurrenz um begehrte Wissenschaftler mit Harvard & Co, mithalten zu können, wird trotz Exzellenzinitiative auch in Zukunft das nötige Geld fehlen. Das räumen selbst engagierte Befürworter der laufenden Umstrukturierungen im deutschen Hochschulsystem ein. So verglich beispielsweise der Leiter des CHE, Detlev Müller-Böling, im August letzten Jahres in der Zeitschrift „Karriere“ die Unterschiede in der Finanzkraft zwischen Stanford und der FU Berlin sehr anschaulich mit der zwischen Bayern München und Alemannia Aachen, damals noch in der 2. Bundesliga. Hans Weiler, früherer Stanford-Professor und einflussreicher Berater der Bundesregierung und vieler Länderregierungen in Hochschulfragen, äußerte sich im Tagesspiegel vom 21. März 2006 ähnlich. Er wies auf die schlichte Tatsache hin, dass Stanford für seine ca. 16.000 Studierenden ein jährlicher Etat zur Verfügung stehe, der dem gesamten Hochschuletat des reichsten Bundeslandes, Baden-Württemberg, entspreche. Von Konkurrenz auf Augenhöhe kann man angesichts solcher Relationen ganz gewiss nicht sprechen.
Das aber heißt, dass man hierzulande die trotz der zahllosen Sparmaßnahmen immer noch vorhandene hohe Qualität in der Breite zu opfern bereit ist, ohne einen auch nur halbwegs adäquaten Ersatz bieten zu können. Die Minderheit der Universitäten, die zu den Gewinnern der jetzigen Entwicklung zählt, dürfte den Verlust an Forschungskapazität, der dem Rest droht, nicht kompensieren können. Eine kleine Universität im Osten der Republik wird dann keine Chance mehr haben, einen Spitzenwissenschaftler in ihren Mauern zu beherbergen, wie es die TU Ilmenau mit dem MP3-Erfinder Karlheinz Brandenburg heute noch kann. Für die Ausbildungsqualität gilt das in noch viel stärkerem Maße. Wenn man in den zuständigen Ministerien glaubt oder hofft, mit den bisherigen Mitteln [11] die bevorstehende Zunahme der Studierenden um ca. 30 Prozent ohne Qualitätseinbußen bewältigen und die übergroße Mehrheit Kosten sparend in Bachelor-Kurzzeitstudiengängen durch die Universitäten schleusen zu können, erliegt man einem schwerwiegenden Irrtum. Die geplante Reduzierung der Studierendenzahlen an vielen der zukünftigen Elite- oder Forschungsuniversitäten wird das Problem sogar noch weiter verschärfen, so dass bei den Absolventen insgesamt mit einer spürbaren Abnahme des Niveaus zu rechnen ist.
Außerdem wird die Hierarchisierung der Universitäten nach US-Muster auch eine Hierarchisierung der Arbeitsmarktchancen zur Folge haben. Bislang ist es in Deutschland aufgrund der relativ ausgeglichenen Qualität der universitären Ausbildung egal, wo man studiert hat, wenn es um die Bewerbung für eine Stelle geht. Das haben eigene Untersuchungen zu den Karriereverläufen verschiedener Akademikergruppen, vor allem aber eine Analyse der Berufsverläufe von promovierten Ingenieuren, Juristen und Wirtschaftswissenschaftlern zwischen 1955 und 1999 eindeutig gezeigt (Hartmann 2002: 106f., 2005a: 265). Alle Universitäten gelten bei den Personalverantwortlichen (noch) als gleichwertig. Das gilt selbst für die Karriereverläufe von Topmanagern. So hat z.B. der neue Vorstandsvorsitzende von DaimlerChrysler, Dieter Zetsche, 1982 an der Gesamthochschule Paderborn (inzwischen Universität Paderborn) promoviert. Ob jemand seinen Abschluss an einer der zukünftigen Elite- oder Forschungsuniversitäten wie München, Heidelberg oder Aachen gemacht hat oder an einer Neugründung der 1970er Jahre wie Dortmund, Oldenburg oder Passau, spielt noch keine Rolle. Das wird in Zukunft anders sein. Wie in den USA, Frankreich, Großbritannien oder Japan wird maßgeblich der Name der Hochschule Türen öffnen oder verschließen. Die Entscheidung über die zukünftigen Berufswege wird dann auch im Hochschulsystem (wie bisher schon in der Schule) sehr frühzeitig gefällt, intellektuelles Potenzial damit verschenkt. Dazu kommt der in sozialer Hinsicht gravierendste Punkt: die zu erwartende deutliche Zunahme an sozialer Selektivität. Alles in allem ist deshalb zutiefst zu bezweifeln, ob der jetzt beschrittene Weg der richtige ist.
Der Glaube oder die Hoffnung, durch Konzentration der vorhandenen Mittel auf wenige Universitäten dem Problem der Unterfinanzierung des gesamten Hochschulsystems beikommen zu können, dazu die mittlerweile auch im Hochschulbereich dominierenden ökonomistischen Denkmuster – Winnacker spricht in seiner Rede von Forschungsergebnissen als Produkten, „die sich an einem Markt bewähren müssen (Winnacker 2006: V) – führen in jeder Hinsicht in die Irre. Wissenschaftliche Konkurrenz ist nicht vergleichbar mit der Konkurrenz zwischen Unternehmen und wissenschaftliche Erkenntnisse sind keine Waren, die sich wie Autos oder Fernseher auf einem Markt verkaufen lassen müssen. Als generelles Fazit bleibt: Die Exzellenzinitiative kann die realen Probleme an den Hochschulen durch die ihr zuteil werdende mediale Aufmerksamkeit allenfalls kaschieren, einen Beitrag zu ihrer Lösung bietet sie nicht. Sie wird diese Probleme vielmehr ganz im Gegenteil sogar noch verschärfen.
Literatur:
BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) (2005): Grund- und Strukturdaten 2005. Berlin
Bourdieu, Pierre (2004): Der Staatsadel. Konstanz
Bowen, William G. / Kurzweil, Martin A. / Tobin, Eugene M. (2005): Equity and Excellence in American Higher Education. Charlottesville
Carnevale, Anthony P. / Rose, Stephen J. (2004): Socioeconomic Status, Race/Ethnicity, and Selective College Admissions, in: Kahlenberg, Richard D. (Ed.), America’s Untapped Ressource: Low-Income Students in Higher Education. New York, 101-156
CollegeBoard (2004): Education Pays 2004. Washington, D.C.
Fallows, James (2005): College Admissions: A Substitute for Quality? in: Hersh, Richard H. / Merrow, John (Eds.), Declining by Degrees: Higher Education at Risk. New York, 39-46
Greene, Howard/ Greene, Matthew (1999): Inside the Top Colleges. Realities of Life and Learning in America’s Elite Colleges. New York
Hartmann, Michael (2002): Der Mythos von den Leistungseliten. Spitzenkarrieren und soziale Herkunft in Wirtschaft, Politik, Justiz und Wissenschaft. Frankfurt a. M.
Hartmann, Michael (2004): Elitesoziologie. Eine Einführung. Frankfurt a. M.
Hartmann, Michael (2005a): Eliten und das Feld der Macht, in: Colliot-Thélène, Catherine / François, Etienne / Gebauer, Gunter (Hrsg.), Pierre Bourdieu: Deutsch-französische Perspektiven. Frankfurt a. M., 255-275
Hartmann, Michael (2005b): Studiengebühren und Hochschulzugang: Vorbild USA? In Leviathan, 33, 439-463
Hersh, Richard H. (2005): Afterword. What Difference does a College Make? In: Hersh, Richard H. / Merrow, John (Eds.), Declining by Degrees: Higher Education at Risk. New York, 229-232
Hill, Catherine / Winston, Gordon / Boyd, Stephanie (2004): Affordability: Family Incomes and Net Prices at Highly Selective Private Colleges and Universities. Discussion Paper: Williams Project on the Economics of Higher Education. Williamstown
Janson, Kerstin / Schomburg, Harald / Teichler, Ulrich (2006): Wissenschaftliche Wege zur Professur oder ins Abseits? Studie des INCHER für das German Academic International Network. Kassel
Karabel, Jerome (2005): The Chosen. Boston
Kirp, David L. (2003): Shakespeare, Einstein, and the Bottom Line. The Marketing of Higher Education. Cambridge/Mass.
Latzer, Barry: The Hollow Core. Failure of the General Education Curriculum. Washington D.C: American Council of Trustees and Alumni 2004
Müller, Ulrich / Ziegele, Frank / Langer, Markus (2006): Studienbeiträge: Regelungen der Länder im Vergleich. Arbeitspapier Nr. 78 des CHE (Centrum für Hochschulentwicklung). Gütersloh
Newman, Frank / Couturier, Lara / Scurry, Jamie (2004): The Future of Higher Education. Rhetoric, Reality, and the Risks of the Market. San Francisco
Teichler, Ulrich (2005): Hochschulstrukturen im Umbruch. Eine Bilanz der Reformdynamik seit vier Jahrzehnten. Frankfurt a. M.
Winnacker, Ernst-Ludwig (2006): Im Wettbewerb um neues Wissen: Exzellenz zählt, in: forschung. Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft 2/2006, V-XI
Wolfe, Tom (2005): Foreword, in: Hersh, Richard H. / Merrow, John (Eds.), Declining by Degrees: Higher Education at Risk. New York, ix-xi
Der Aufsatz ist in der Zeitschrift für Sozialwissenschaft „Leviathan“ 4 / 2006 S. 447ff. abgedruckt
[«1] Eine gemeinsame Erklärung der Präsidenten der Humboldt Universität in Berlin, der Universität Wien und der Universität Zürich im Juli 2006 weist in dieselbe Richtung, wenn sie davon spricht, dass europaweit von den heute existierenden ca. 1.000 Volluniversitäten in den nächsten Jahren nur noch rund 300 übrig bleiben werden, und in diesem Zusammenhang explizit die Exzellenzinitiative erwähnt.
[«2] In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass der große Erfolg Baden-Württembergs mit vier von zehn Universitäten in der Endrunde der dritten Förderlinie auch darin begründet liegt, dass das Land zu den Exporteuren von Studierenden gehört. An seinen Universitäten werden 7,2 Prozent weniger Personen ausgebildet als es der Anzahl der im Land erworbenen Hochschulzugangsberechtigungen entspräche. In Nordrhein-Westfalen ist es genau umgekehrt (BMBF 2005: 198). Die Universitäten in Baden-Württemberg haben schon in der Vergangenheit die Maxime verfolgt, lieber weniger Studierende auszubilden und so bessere Bedingungen zu Lasten und auf Kosten anderer Bundesländer zu bieten.
[«3] In der jüngsten Untersuchung des CHE zu den Studiengebühren in Deutschland lautet eines der zentralen Bewertungskriterien denn auch, dass den Hochschulen möglichst viel Spielraum zur Gestaltung der Studiengebühren eingeräumt werden müsse, um „so unter den Hochschulen Wettbewerb und Profilierung fördern“ zu können. Als „Best Law“ gilt dem CHE dementsprechend, wenn die Landessregierungen die Entscheidung über die Erhebung und Höhe von Studiengebühren den einzelnen Hochschulen ohne jede Vorbedingung überlassen (Müller et.al. 2006: 6, 14).
[«4] Der berühmte Schriftsteller Tom Wolfe hat die Bedeutung von Ranking und Prestige treffend mit folgenden Worten charakterisiert: „ The matter of how this third-rate news magazine, forever swallowing the dust from the feet of Time and Newsweek, managed to jack itself up to the eminence of ringmaster of American college education, forcing both parents and college administrators to jump through their hoops and rings of fire, is a long and perfectly ludicrous story that would inevitably reduce one to helpless laughter and distract us from the matter at hand. In any event, the result was that parents caught up in the madness of it all – and, as I say, it had become, and remains, a pandemic – were utterly consumed by a single passion: getting in … preferably Harvard, or, if not Harvard, Yale; or, if not Yale, Princeton; or, if not Harvard, Yale, or Princeton, then …“ (Wolfe 2005: xf.).
[«5] Die Bewertung erfolgt durch eine Umfrage unter Präsidenten, Kanzlern und den Leitern der für die Auswahl der Bewerber zuständigen Admissions Committees an US-Hochschulen.
[«6] Vgl. zur Wirksamkeit solcher Mechanismen in Elitebildungseinrichtungen Bourdieu 2004 und beim Zugang zu Elitepositionen Hartmann 2002 und 2004.
[«7] Vgl. dazu Hartmann 2002: 117 ff.
[«8] Der soziale Selektionsgehalt von Auswahlgesprächen tritt zuweilen offen zutage. So wurde am Institut für Politikwissenschaften der TU Darmstadt im Auswahlverfahren gefragt: „Welche ausländischen Tageszeitungen lesen Sie?“. In welchen Haushalten werden schon Zeitungen wie die New York Times oder die International Herald Tribune gelesen. Zumeist bleibt dieser Aspekt allerdings verborgen und wird erst bei genauerem Hinsehen erkennbar, wie z.B. im neuen Auswahlprozess desselben Instituts. Weil die allermeisten der erhofften und auch ausgewählten „Elitestudierenden“ andere Universitäten vorgezogen haben, erfolgt die Auswahl jetzt in einem weniger zeitaufwendigen Verfahren durch eine Kombination von Abiturnoten und der Bewertung eines Bewerbungsschreibens, in dem die Wahl des Fachs und des Studienorts begründet werden soll. Vor allem die Begründung des Studienorts begünstigt aber auch weiterhin eindeutig die Bewerber aus Akademikerfamilien. Da sich kaum jemand ausschließlich für die TU Darmstadt bewerben dürfte, kommt es im Grunde darauf an, schriftlich ein Interesse vorzuspiegeln, dass in dieser Weise gar nicht existiert. Es werden letztlich Formulierungskünste und die Kenntnis universitärer Spielregeln abgefragt, ein Punkt, der den Nachwuchs aus den sog. „bildungsfernen“ Familien erheblich benachteiligt.
[«9] Der Vizepräsident der FU Berlin, Werner Väth, denkt angesichts der deutlichen Zunahme von Bewerbungen (häufig Mehrfachbewerbungen) inzwischen laut über diese Möglichkeit nach. In den USA ist das inzwischen an vielen Universitäten gang und gäbe. Bei Summen von durchschnittlich 100 Dollar ergibt sich bei mehreren Bewerbungen durchaus eine Gesamtsumme, die für Kinder aus ärmeren Familien die Zahl möglicher Bewerbungen spürbar einschränkt.
[«10] Im letzten Jahrzehnt entfiel über ein Drittel der in den USA erfolgten Promotionen auf Ausländer. In den Natur- und Ingenieurwissenschaften waren es bis zu 50 Prozent, in einzelnen Fächern wie etwa der Elektrotechnik sogar zwei Drittel (Janson et.al 2006: 40).
[«11] 2004 sind die staatlichen Mittel für die Hochschulen erstmals seit 1996 sogar auch nominal gesunken, von 17,8 Mrd. auf 17,1 Mrd. Euro, ein Rückgang um immerhin vier Prozent.