Armut macht krank – Krankheit macht arm
Es ist weder Zufall noch Wunder, dass hierzulande auf der einen Seite chronisch Kranke häufig in Hartz IV und somit Armut abrutschen und auf der anderen Seite Armut wiederum krank bzw. noch kränker macht und inzwischen bereits über ein Drittel aller Hartz IV-Empfangenden als psychisch krank gilt. Die entsprechenden Zusammenhänge müssen beleuchtet und aufgeklärt und den Ursachen von Armut und chronischer sowie psychischer Erkrankung muss dabei entschieden entgegen getreten werden. Nicht wirklich möglich sein wird dies jedoch vermittels eines Menschenbildes, das davon ausgeht, seelisch-körperliche Probleme seien zu allererst einmal „eigenverantwortet“ und Gesundheit bedeute auch und vor allem in einer faktisch zunehmend angst- und krankmachenden Gesellschaft, eben k-e-i-n-e Symptome und also Verwundbar- sowie Menschlichkeit zu offenbaren, bedeute also eben, n-i-c-h-t gesund zu reagieren, weil nur der noch als gesund gelten darf, der auch im größten Elend noch funktioniert und auf seine Glückseligkeit insistiert. Aus dieser Sicht erfordert chronische wie psychische Krankheit dann eben vor allem eines: mehr individuelle Verantwortungsübernahme, Anpassungsbereitschaft und Therapie. Über die „Ursachen im außen“, den gesellschaftlichen Kontext, wird hingegen kaum überhaupt mehr diskutiert. So etwas endet dann nicht selten in einem Zynismus mit menschenverachtenden Zügen, wie diesen unlängst beispielsweise der Spiegelmit der Frage präsentierte, ob Obdachlosigkeit nicht womöglich „heilbar“ sei. Ein Kommentar von Jens Wernicke
In den letzten Jahrzehnten haben internationale Studien immer wieder aufgezeigt, dass ein enger Zusammenhang zwischen der sozialen und gesundheitlichen Lage von Menschen besteht: Viele Krankheiten, Beschwerden und Risikofaktoren kommen bei Personen mit niedrigem sozioökonomischen Status, gemessen zumeist über Angaben zu Einkommen, Bildung und Beruf, häufiger vor als bei Personen mit höherem sozioökonomischen Status. Dies gilt auch für schwerwiegende und chronische Gesundheitsprobleme, die oftmals mit Funktionseinschränkungen im Alltag und Auswirkungen auf die Lebensqualität verbunden sind.
Aktuelle Veröffentlichungen [PDF] des Robert-Koch-Instituts im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes zeigen, dass Frauen und Männer, deren Einkommen unterhalb der Armutsrisikogrenze liegen, ein im Verhältnis zur höchsten Einkommensgruppe um das 2,4- bzw. 2,7-Fache erhöhtes Mortalitätsrisiko haben. Infolgedessen erreicht in der niedrigen Einkommensgruppe auch nur ein deutlich geringerer Anteil der Frauen und Männer das 65. Lebensjahr. Unter Einbeziehung der mittleren Einkommensgruppen lässt sich die Aussage treffen, dass die Chance, 65 Jahre oder älter zu werden, mit steigendem Einkommen sukzessive zunimmt.
Noch eindrücklicher lesen sich die Befunde, wenn sie auf die mittlere Lebenserwartung bei Geburt bezogen werden, die nach den Periodensterbetafeln für den Zeitraum 1995 bis 2005 für Frauen mit 81,3 Jahren und für Männer mit 75,3 Jahren beziffert werden kann. Die Differenz zwischen der niedrigsten und höchsten Einkommensgruppe beträgt hier, legt man die zuvor ermittelten Mortalitätsunterschiede zugrunde, bei Frauen 8,4 Jahre und bei Männern 10,8 Jahre. Betrachtet man dabei nur die gesunde Lebenserwartung, das heißt jene Lebensjahre, die in sehr gutem oder gutem allgemeinen Gesundheitszustand verbracht werden, macht der Unterschied zwischen der niedrigsten und höchsten Einkommensgruppe sogar 10,2 Lebensjahre bei Frauen und 14,3 Lebensjahre bei Männern aus.
Daten der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) zeigen zudem die aktuelle Entwicklungslinie in Bezug auf soziale Unterschiede in der ferneren Lebenserwartung ab dem 65. Lebensjahr auf. Untersucht wurden Unterschiede nach Einkommen (Entgeltpunkte) und Berufsstatus, der Beobachtungszeitraum erstreckte sich von 1995/96 bis 2007/08. Die Ergebnisse machen deutlich, dass sich die sozialen Unterschiede in der ferneren Lebenserwartung vergrößert haben. Zwar ist die Lebenserwartung in allen betrachteten Gruppen gestiegen, die Zugewinne fielen in den unteren Einkommens- und Berufsstatusgruppen jedoch geringer aus. Die gesundheitlichen Unterschiede zwischen den Einkommensgruppen haben sich im Beobachtungszeitraum also vergrößert bzw. vertieft.
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die zunehmenden sozialen Unterschiede in Deutschland machen immer mehr Menschen arm. Die zunehmende Armut und der mit dieser verbundene Stress wiederum machen immer mehr Menschen krank. Krankheit wiederum verschärft die Nachteile auf dem Arbeitsmarkt, führt zu Stigmata, Ausgrenzung – und allzu oft in noch größere Armut hinein. Kurzum: „Armut macht krank – Krankheit macht arm“.
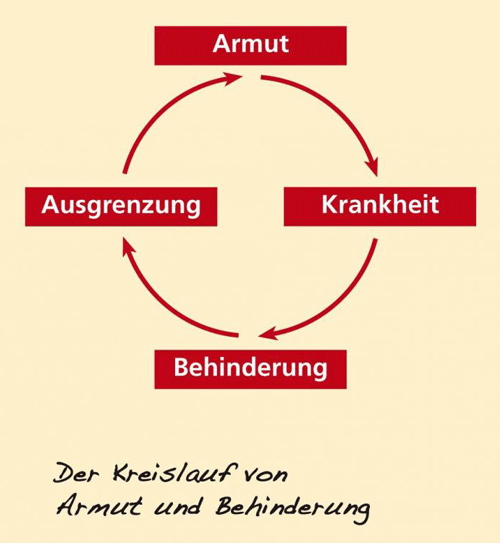
Quelle: Christoffel-Blindenmission
Wie wenig es sich hierbei um „Marginalien“ handelt, weisen andere zahlen aus:
Der 4. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung aus dem Jahre 2013 bestätigt, dass über 15 Prozent der Bevölkerung in Armut leben. Dies entspricht einer Zahl von ca. 12 Millionen Menschen. Allein 2,5 Millionen Kinder sind betroffen. Und: Bei 9,6 Millionen Menschen in Deutschland liegt eine amtlich festgestellte Schwerbehinderung oder eine Erwerbsminderung vor. Dies entspricht 14 Prozent der Bevölkerung. An chronischen Beschwerden oder Krankheiten leiden zudem 19,1 Millionen Menschen. Das entspricht 28 Prozent der Bevölkerung.
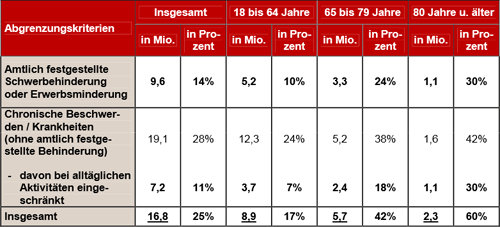
Quelle: Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen 2013, S. 44
Diese „Negativspirale der Armut“ trifft psychisch Kranke dabei oft zunehmend häufig besonders hart [PDF]: „Die Schwerbehindertenstatistik weist für die Jahre 2005 bis 2011 einen leicht ansteigenden Anteil der Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen an allen schwerbehinderten Menschen aus. In absoluten Zahlen ausgedrückt, wird jedoch die Relevanz dieser Beeinträchtigungsart deutlich: Im Jahr 2011 hatten rund 500.000 Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung eine psychische Beeinträchtigung. Gegenüber dem Jahr 2005 stellt dies eine Zunahme um 42 Prozent dar“, wie es im aktuellen „Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen“ [PDF] heißt.
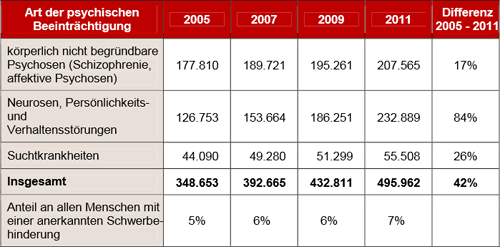
Quelle: Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen 2013, S. 382
Zudem gilt [PDF], „dass (inzwischen) nahezu jeder vierte männliche und jede dritte weibliche Erwachsene (…) unter voll ausgeprägten psychischen Störungen (leidet). (…) Am häufigsten sind (dabei) Angst- und depressive Störungen, gefolgt von Substanz- und somatoformen Störungen. (…) Typisch für psychische Störungen (…) (ist dabei) eine ausgeprägte Komorbidität, eine hohe Anzahl an Ausfalltagen und eine niedrige Behandlungsrate.“
Nahezu verdoppelt hat sich überdies auch die Zahl der Menschen, die aufgrund von psychischen Beeinträchtigungen eine Rente der Deutschen Rentenversicherung wegen verminderter Erwerbsfähigkeit erhalten. Im Jahr 2010 entfielen 70.946 Neuzugänge auf diese Diagnosegruppe, 2000 waren es mit 39.037 nur halb so viele. Inzwischen stehen 39 Prozent aller Neuzugänge im Zusammenhang zu psychischen Beeinträchtigungen, konstatiert der Teilhabebericht weiter.
Und hier schließt sich der Kreis. Denn zahlreiche internationale Studien weisen darauf seit Langem darauf hin, dass sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen besonders anfällig (auch) für psychische Störungen sind. Für Deutschland hatte bereits der Bundes-Gesundheitssurvey 1998 gezeigt, dass Personen mit niedrigem Sozialstatus häufiger an psychischen Störungen wie depressiven Erkrankungen, Angsterkrankungen und substanzbezogenen Störungen litten, als Personen mit höherem Status. In der GEDA-Studie 2009 zeigt sich ebenfalls ein deutlicher Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit und sozialem Status, der anhand von Angaben der Befragten zu Bildungsstand, Einkommen und beruflicher Position ermittelt wurde.
„Sowohl diagnostizierte Depressionen als auch aktuelle seelische Belastungen werden am häufigsten von Personen mit niedrigem Sozialstatus angegeben (…). Bei statistischer Kontrolle der Effekte von Alter und Geschlecht ergibt sich, dass Personen mit niedrigem Sozialstatus eine fast doppelt so hohe Chance einer diagnostizierten Depression haben, wie Personen mit hohem Sozialstatus (…). Die Chance einer aktuellen seelischen Belastung ist bei niedrigem Sozialstatus etwa 2,6-mal höher als bei hohem Sozialstatus“, konstatierte [PDF] das Robert-Koch-Institut bereits 2011.
Später wurde dann ergänzt [PDF]: Die Häufigkeit starker Stressbelastung nimmt insgesamt mit steigendem sozioökonomischem Status ab; sie fällt von 17,3 Prozent bei niedrigem auf 7,6 Prozent bei hohem sozioökonomischem Status. Gleichzeitig gilt: Menschen mit einer starken Belastung durch chronischen Stress zeigen deutlich häufiger eine aktuelle depressive Symptomatik, ein Burnout-Syndrom oder Schlafstörungen als Menschen ohne starke Belastung durch chronischen Stress. Kein Wunder also, dass gilt [PDF]: „Die Häufigkeit von Depressionen sinkt mit der Höhe des sozioökonomischen Status (SES): Bei niedrigem SES beträgt sie 13,6%, bei mittlerem 7,6 Prozent, bei hohem 4,6 Prozent.“
Caritas TV-Spot: Armut macht krank
Lassen wir uns daher von allem Gerede von „Eigenverantwortung“, welche für die Genesung auch und gerade von psychischen Erkrankungen sehr wohl wichtig und notwendig ist, ein X aber nicht gleich für ein U vormachen: Die Ängste und Nöte, unter denen psychisch Kranke leiden, sind womöglich sehr wohl entwicklungspsychologisch und biografisch fundiert, dennoch aber jedoch weniger in dem Sinne zu bewerten, als dass sie „falsch“ wären und daher „wegtherapiert“ gehörten, als vielmehr in jenem, als dass ihre Aktualisierung und „Re-Aktivierung“ auch und vor allem dafür spricht, dass „die Verletzten“ dieser Erde eben auch die sensibelsten Menschen sind und damit eben jene, die soziale und gesellschaftliche Missstände als erste spüren und wahrnehmen, da sie gar nicht umhin kommen, unter diesen zu leiden.
In diesem Sinne würde die „Eigenverantwortung“ psychisch Kranker dann aber eben auch bedeuten, die eigenen Gefühle zumindest als Teil der eigenen Menschlichkeit und Wahrheit anzunehmen und neben der Arbeit an der Linderung der größten unmittelbaren Not mit diesen sich überall dort, wo dies möglich erscheint, auch für gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu streiten, die (faktisch und nicht nur imaginiert!) weniger ängstigend, furchteinflößend und traumatisierend sind.
Denn das der einzelne ggf. eher und schneller und deutlicher als die Mehrheit auf Probleme reagiert heißt eben nicht unmittelbar, dass der einzelne selbst oder allein die Ursache seiner „Störungen“ ist. Vielmehr ließe sich mit Arno Gruen und Erich Fromm sehr wohl argumentieren, dass vielmehr wohl doch das Ganze das Problematische und also Unwahre sei.
Bei Arno Gruen liest sich das so [PDF]:
„Um erfolgreich zu sein, müssen wir von klein an lernen, vom Versagen zu träumen. Was zählt in unserer Kultur, ist nicht, im Gefühl des Lebendigen zu sein, sondern wie wir den Erfolg erreichen. Danach werden wir gemessen und messen uns selber. Erfolg ist der Maßstab, nicht die Fähigkeit zu lachen, zu spielen oder zärtlich zu sein.
Dieser Erfolg aber gründet auf dem Versagen eines anderen Menschen. Er beinhaltet Gewalt. Diese Lektion fängt im Elternhaus an, wird in der Schule verstärkt, so daß wir schon lange vor dem Erwachsensein von dem internalisierten Alptraum gekennzeichnet sind: Wir träumen von der Angst des anderen, die unsere eigene ist. Sogar, wenn wir auf dem Höhepunkt des Erfolges sind, träumen wir von der Angst des Versagens. Das eben ist das Problem: Um ein Selbst auf diesen, den Werten der Gesellschaft entsprechenden Wegen aufzubauen, müssen wir uns maskieren. Wir müssen verneinen, daß das, was wir wirklich tun, ist: einem anderen Wesen Schmerzen zuzufügen. Es ist, wie Vaclav Havel es in seinem Essay ‚Versuch, in der Wahrheit zu leben‘ darstellt: ‚Ideologie als scheinbare Art der Sichbeziehung zur Welt bietet dem Menschen die Illusion, er sei eine mit sich identische, würdige und sittliche Persönlichkeit womit es ihm möglich wird, alles dies nicht zu sein‘.
Sich auf diese Weise zu betrügen, macht es aber unmöglich, gerade den Selbstwert aufzubauen, der einen Menschen in sich ruhen läßt, (und) in dem Verletzlichkeit und Hilflosigkeit zum Ausgangspunkt des Seins werden können.“
Und Erich Fromm brachte es auf folgenden zugespitzten Punkt, um zu verdeutlichen, dass die als „krank“ gebrandmarkten und stigmatisierten Reaktionen vielleicht die gesündeste aller Reaktionsweisen auf faktisch kranke und krankmachende Umweltbedingungen sind:
Interview mit Erich Fromm
Weiterlesen:
- Weltgesundheitsorganisation: Soziale Determinanten von Gesundheit: Die Fakten [PDF]
- Robert-Koch-Institut: Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Armut, soziale Ungleichheit und Gesundheit [PDF]
- Fact Sheet Gesundheit und soziale Gleichheit des Projektes „Solidarisch G’sund“ [PDF]
- Christoffel-Blindenmission: Armut und Behinderung bilden einen verhängnisvollen Kreislauf
- Landeszentrale für Gesundheit in Bayern e.V.: „Armut macht krank – Krankheit macht arm?!“ [PDF]
- Verein „Armut und Gesundheit in Deutschland e.V.“
- Süddeutsche: Wissenschaftliche Studien: Armut macht krank
- Naturheilkundliches Fachportal: Armut macht krank und mindert Lebenserwartung













