Denkfehler 18: »Inflation ist unsozial.«
Albrecht Müller. Auszug aus „Die Reformlüge. 40 Denkfehler, Mythen und Legenden, mit denen Politik und Wirtschaft Deutschland ruinieren“ Seiten 216ff.
Variationen zum Thema:
- »Preissteigerungen schaden den Sparern, den Rentnern, den Arbeitnehmern.«
- »5 Prozent Preissteigerung seien leichter zu ertragen als 5 Prozent Arbeitslosigkeit – ein fataler Irrtum.«
Freunde, die es gut meinen, haben mir davon abgeraten, dieses Thema zu behandeln. Man könne über diese sensible Frage nicht rational diskutieren. Die Deutschen hätten beim Thema Inflation eine fast traumatische Erinnerung. Ich respektiere diese Gefühle, aber ich will dennoch zu erläutern versuchen, warum der damalige Superminister Helmut Schmidt recht hatte, als er 1972 meinte, das deutsche Volk könne 5 Prozent Preissteigerung besser vertragen als 5 Prozent Arbeitslosigkeit.
Da die wirtschaftspolitische Debatte in Deutschland rational jedoch nur schwer zu führen ist, will ich ein paar Sätze vorausschicken:
Ich bin für Preisstabilität und dafür, alles zu tun, um nicht in eine inflationäre Entwicklung abzugleiten. Wenn ich hier dennoch dafür plädiere, eine leichte Preissteigerung gegen die realen Folgen hoher Arbeitslosigkeit, der Unterbeschäftigung und des Zusammenbruchs vieler selbständiger Existenzen abzuwägen, dann nicht aus Leichtfertigkeit. Wenn Hunderttausende junger Menschen über längere Zeit keine Arbeit finden, dann ist diese Situation auf Dauer nicht tragbar. Wenn Fünfundvierzigjährige und Fünfzigjährige und Fünfundfünfzigjährige keine Chance mehr sehen, eine neue Stelle zu finden, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren, dann hat das gravierende reale Folgen. Diese Folgen vor Augen, kann man einfach nicht daran vorbei, über alle Wege nachzudenken, um diesen Zustand zu ändern oder abzumildern.
Das war im übrigen genau der historische Hintergrund der Äußerung von Helmut Schmidt. Die damalige Regierung stand unter massivem Druck; es wurden mit einer Riesenpropaganda – zum Beispiel mit Anzeigen von einem brennenden Hundertmarkschein – Ängste vor der Inflation geschürt. In dieser Situation gab Helmut Schmidt den Rat, abzuwägen zwischen den verschiedenen Zielen der Wirtschaftspolitik. Zu dieser Abwägung ist die Bundesregierung verpflichtet.
Diesen Rat zur Abwägung zu geben heißt nicht, für Inflation zu sein. Es heißt nur, im konkreten Fall die Frage zu stellen: Hätten wir die Chance, mit der bedrückenden Arbeitslosigkeit und der Unterbeschäftigung unserer Volkswirtschaft besser fertigzuwerden, wenn wir in Kauf nähmen, dass die Preise auch einmal um 3 oder 4 Prozent steigen, wenn die Wirtschaft endlich boomt? Oder müssen wir das Preissteigerungsziel der Europäischen Zentralbank von weniger als 2 Prozent auf Teufel komm raus einhalten? Auch dann, wenn unsere Wirtschaft dadurch gelähmt wird? Auch dann, wenn auf diese Weise zarte Pflänzchen konjunktureller Belebung zertreten werden? Diese Fragen zu stellen ist nach der Erfahrung der letzten zwanzig Jahre berechtigt. Schließlich wurde beispielsweise der Einigungsboom aus Sorge um die Preissteigerung abgebrochen – mit bitteren Folgen für viele Menschen. Damals setzte sich die Bundesbank mit ihrer eindimensionalen Ausrichtung auf die Preisstabilität durch und erhöhte massiv die Zinsen, von 2,9 Prozent im Jahr 1988 auf 8,75 Prozent Diskontsatz (1992). Die Folge waren riesige Verluste wegen nicht ausgenutzter Produktionskapazitäten und hoher Arbeitslosigkeit – mit allen Konsequenzen für den Anstieg der Schulden und mit Beitragssatzerhöhungen in den sozialen Sicherungssystemen von 35,5 Prozent 1990 auf 42 Prozent 1998 (siehe auch Denkfehler Nr. 30, S. XXX).
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen ist es berechtigt, wenigstens die Frage zu stellen, ob eine leichte Preissteigerung nicht eine Art von Schmiermittel für die wirtschaftliche Belebung und auch für die wirtschaftliche Umstrukturierung sein könnte, mit dessen Hilfe wir eine bessere Auslastung unserer Kapazitäten erreichen können.
Man muss auch offen darüber sprechen dürfen, welche Folgen eine etwas höhere Preissteigerung für die reale Lage der Menschen hat. Es macht ja keinen Sinn, nur die nominellen Zahlen zu betrachten. Die Vergangenheit zeigt, dass häufig dann, wenn die Preissteigerungen etwas höher waren, auch die Zinsen höher waren; die Lohnzuwächse fielen ebenfalls höher aus und damit stiegen auch die Renten.
Wenn man den Geldschleier wegzieht, wie die Ökonomen sagen, dann entdeckt man, dass die reale Lage der Menschen mit etwas höheren Preissteigerungen nicht schlechter ist als ohne sie. Zieht man von einem nominellen Zins von 7 Prozent die Preissteigerung von 4 Prozent abzieht, dann bleiben immer noch 3 Prozent real übrig. 3 Prozent real, das erreichen heute nicht viele Sparer. Und wenn man von einer Rentensteigerung von 5 Prozent die 4 Prozent Preissteigerung abzieht, dann bleibt immer noch soviel wie heute. Das gleiche gilt für die Löhne.
Wenn man die Situation von Lohnbeziehern, Konsumenten, Rentnern und Sparern so betrachtet, kann man zu dem Ergebnis kommen, dass wegen der Erleichterung des strukturellen Wandels, wegen der besseren Auslastung der Kapazitäten und wegen geringerer Arbeitslosigkeit die Hinnahme von etwas höheren Preissteigerungen durchaus akzeptabel ist.
Um es noch einmal zu sagen: Niemand plädiert für Inflation und für Preissteigerungen. Es geht nur darum, um der realen Vorteile willen notfalls auch einen leichten Preisanstieg hinzunehmen, weniger rigoros zu sein und dem Bewegungsdrang der Ökonomie etwas Raum zu geben.
Wenn wir gelernt haben, statt in Geldgrößen in realen Größen zu denken, dann interessieren uns bei diesem Thema nur die Antworten auf folgende Fragen:
- Welche realen Folgen haben etwas höhere Preissteigerungen für die Auslastung unserer Kapazitäten, für die Arbeitslosigkeit, für den strukturellen Wandel und für die Insolvenzen? Wenn in diese Größen positive Bewegung kommt, dann gibt es schon einmal ein positives Vorurteil.
- Was bleibt nach Abzug der Preissteigerungen von den Nominallöhnen übrig?
- Was bleibt nach Abzug von Preissteigerungen von den Nominalzinsen an realem Zins übrig?
- Wie steht es um die reale Rentenentwicklung?
- Ganz wichtig: Was muss man tun, um die Lage im Griff zu behalten, damit aus Preissteigerungen keine galoppierenden inflationären Entwicklungen folgen?
Wie so oft, sind wir in Deutschland auch bei diesem Thema zur Zeit nicht zu einer nüchternen rationalen Abwägung in der Lage. Die Debatte ist voller Vorurteile, Klischees und Stereotypen. Dagegen hilft nur, sich die Fakten anzusehen: die Entwicklung der Preise für die Lebenshaltung, des realen Wachstums, der Reallöhne und der Realzinsen für Spareinlagen (siehe die Abbildungen 7 und 8 sowie die Tabelle A10 im Anhang, S. XXX).
Abbildung 7: Reallohn, Inflation und Wirtschaftswachstum
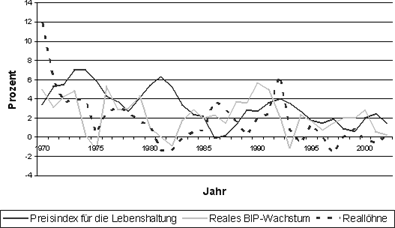
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung (Hrsg.): Statistisches Taschenbuch 2003, Arbeits- und Sozialstatistik, Bonn 2003, 1.2, 1.13, 9,16
Abbildung 7 und in die Tabelle A10 im Anhang zeigen eindrucksvoll, dass die siebziger Jahre für die Bezieher von Lohneinkommen nicht nur nominal, sondern auch real insgesamt sehr erfolgreich waren und dass auch das reale Bruttoinlandsprodukt damals beachtlich gewachsen ist, jedenfalls deutlich mehr als in den darauffolgenden beiden Jahrzehnten.
Abbildung 8: Realzins, Inflation und Wirtschaftswachstum
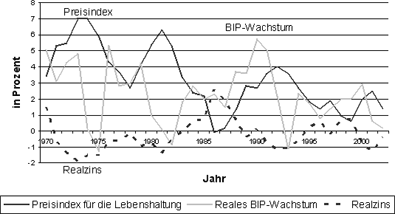
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (Hrsg.): Statistisches Taschenbuch 2003, Arbeits- und Sozialstatistik, Bonn 2003, 1.2. und 9.16; Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Hrsg.): Staatsfinanzen konsolidieren – Steuersystem reformieren, Jahresgutachten 2003/04, Berlin 2003, S. 575
Wir stellen weiter fest, wie Abbildung 8 zeigt, dass es negative Realzinsen für Spareinlagen sowohl in Perioden hoher Preissteigerungsraten – wie etwa zwischen 1971 und 75 – gab, wie auch in Phasen der Stagnation, etwa 1981/82/83 oder auch anfangs der neunziger Jahre und zu Anfang dieses Jahrhunderts, als wir bei geringen Preissteigerungsraten von 2 Prozent, von 2,5 Prozent und von 1,4 Prozent jeweils negative Realzinsen zu verzeichnen hatten. In dieser Phase lagen schon die Nominalzinsen kaum höher als 1 Prozent. Die Sparer haben also sowohl in Zeiten steigender als auch in Zeiten stabiler Preise gelitten.
Wir stellen in beiden Grafiken fest, dass die Parallelität zwischen relativ hohen Preissteigerungsraten und hohen realen Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts bemerkenswert ist. Das ist verständlich: In einer Volkswirtschaft, die von einer aktiven und hohen Nachfrage geprägt ist, werden vergleichsweise viele Ressourcen und Kapazitäten ausgenutzt und deshalb wird real viel produziert und geleistet; zugleich besteht wegen dieser lebendigen Nachfrage eine Tendenz zu höheren Preissteigerungsraten. Wenn man dies hinnimmt, gewinnt man in der Regel: Millionen von Menschen – Arbeitnehmer und Unternehmer, Rentner und Sparer – gewinnen real.
Umgekehrt gilt: Seit 1992 nutzen wir unsere Kapazitäten nicht, weil unsere Geld- und Finanzpolitiker meinen, die Preise drücken zu müssen. Das haben sie geschafft – von 4 Prozent im Jahr 1992 auf 0,6 Prozent 1999. Aber es ist ein Pyrrhussieg, denn diese Kur hat uns schätzungsweise 1,5 Billionen Euro realen Wohlstand gekostet und Millionen von Menschen in reale Existenznöte gebracht.
Man sieht: bei der Erörterung dieses Themas geht es nicht um graue Theorie.














