Eine überflüssige Konjunkturprognose
Angesichts der Vielzahl der Wirtschaftsprognosen ragt die „Gemeinschaftsdiagnose“ [PDF – 5.3 MB] der ohnehin wirtschaftspolitisch gleich gepolten Wirtschaftsinstitute nicht mehr aus dem heraus, was man schon oft gelesen hat. Man fragt sich warum das Bundeswirtschaftsministerium überhaupt 4 Forschungsinstitute (das Ifo Institut des Professors Sinn, das Instituts für Weltwirtschaft des Professors Snowers, des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle des Professors Professors Blum oder des RWI des Professors Schmidt) und dazu noch mehrere kooperierende Forschungsstellen beschäftigen und bezahlen muss, von denen man jedenfalls was ihre wirtschaftswissenschaftlichen Bewertungsmaßstäbe und dementsprechend was ihre wirtschaftspolitischen Empfehlungen anbetrifft, ohnehin von vorneherein weiß, was als Ergebnis herauskommt. Wolfgang Lieb
Seit 2006 habe ich mich der Mühe unterzogen sowohl das Frühjahrsgutachten als auch das Herbstgutachten dieser Forschungsinstitute zu lesen und auf den NachDenkSeiten zu kommentieren. Der Tenor war fast immer der gleiche und reichte regelmäßig für eine Erfolgsmeldung des auftraggebenden Wirtschaftsministers: erfreuliches Wachstum, Arbeitslosigkeit sinkt, Inlandsnachfrage wächst, Löhne steigen.
Auch die wirtschaftspolitischen Empfehlungen wiederholten sich mit minimalen Varianten:
Haushaltskonsolidierung fortsetzen (selbst im Rezessionsjahr 2009), Zurückdrängung des Staates aus der Wirtschaft, Flexibilisierung des Arbeitsmarkts, Steuersenkungen oder keinesfalls Steuererhöhungen, „Reformkurs“ fortsetzen, Lohnzurückhaltung, Sozialleistungen senken, Inflationsbekämpfung durch höhere Leitzinsen.
Die Wachstumsprognosen des diesjährigen Frühjahrsgutachtens von 2,8 % in 2011 und von 2,0% in 2012 hat man – ein zehntel mehr oder ein zehntel weniger – schon oft gelesen. Im Übrigen, wenn man die Prognosewerte des letzten Frühjahrsgutachtens (1,5%) mit dem Ist-Wert des Jahres 2010 (3,6%) vergleicht, dann wird deutlich, wie viel Kaffeesatzleserei da betrieben wird. (Die Rechtfertigung dieser Fehleinschätzung im letzten Jahr ist den Gutachtern gerade mal eine halbe Seite wert. S. 28)
Das einzig Hilfreiche ist, dass man alle halbe Jahre sozusagen ein update der neuesten Daten und das erleichtert die Sucharbeit, wenn man Zahlen für andere Zwecke braucht. Aber wenn eine Regierung ohnehin den gleichen wirtschaftspolitischen Glaubenslehren anhängt, wie diese Institute, dann kann man vom sog. Gemeinschaftsdiagnose wirtschaftspolitisch kaum noch etwas Überraschendes erfahren.
Für einen wirtschaftsliberalen Wirtschaftsminister hat das Gutachten nahezu ausschließlich eine Public-Relation-Funktion, wie Brüderle schon am Abend im Fernsehen bei Maybrit Illner mal wieder aufdringlich bewiesen hat.
„Deutschland erlebt einen kräftigen Aufschwung“, heißt es da, gerade so als ob 2,8 oder danach 2,0 Prozent nach dem Einbruch von 2009 schon wieder Anlass zu Übertreibungen wären.
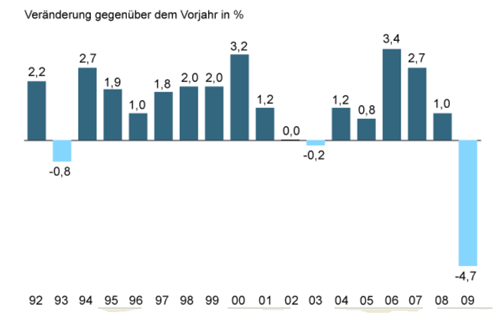
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2010
Da wird eine stärkere Binnennachfrage gefeiert, obwohl die Privaten Haushalte gerade mal jeweils 0,7% zum Anstieg des BIP beitragen. Wenn überhaupt, fallen die Anlageinvestitionen im Binnenmarkt mit 1,0 bzw. 09% ins Gewicht. Für Ausrüstungsinvestitionen wird eine kräftig Zunahme von 10,5 % (2011) und 7,6% (2012) erwartet. (S. 34) Und darauf kommt es ja den neoklassischen Ökonomen an, nämlich dass die hiesigen Unternehmen investieren. Den privaten Konsum braucht man in der Welt dieser Wirtschaftsökonomen ohnehin nicht. Die Unternehmen machen ja ohnehin alles alleine, sie konsumieren, investieren und exportieren, wenn es sein muss an die Wesen vom Mars. (Heiner Flassbeck)
Auch künftig werden sich die Einkommenszuwächse vor allem aus einer kräftigen Zunahme der Gewinn- und Vermögenseinkommen speisen. Trotz einer prognostizierten Steigerung der Bruttolöhne wird sich die Umverteilung von den Arbeits- auf die Kapitaleinkommen fortsetzen. Die Kaufkraft soll sich real um gerade einmal 1,0% erhöhen. (S. 34)
Dabei lagen die effektiven Stundenlöhne im Jahre 2011 gegenüber dem Vorjahr um 0,1 % niedriger. Und nebenbei wird bemerkt, dass angesichts des Anstiegs der gesamtwirtschaftlichen Produktivität um 1,0% und angesichts der Tatsache, dass die nominalen Lohnstückkosten ihr Niveau vom Vorjahr um 1,1 % unterschritten, sich die Gewinnsituation der Unternehmen spürbar verbessert habe. (S. 36) Gemessen am Produktionsniveau lägen die realen Arbeitskosten 2012 immer noch niedriger als vor Beginn der Lohnmoderation im Jahr 2004. (S. 37)
Da wird in dem Gutachten beim Arbeitsmarkt von einem „regelrechten Boom“ (S. 37) gesprochen und als Erfolg vermeldet, dass etwa 60 % (!) des Beschäftigungsaufbaus in Vollzeitstellen stattfand und die Beschäftigung in der Arbeitnehmerüberlassung weiter zunimmt, wenn man angesichts der inzwischen beschönigenden Statistiken unter 3 Millionen Arbeitslosen liegt. Die Qualität der Arbeitsplätze, dass jeder 5. Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor gelandet ist, ist für die Gutachter vernachlässigbar. Die Arbeitsplatzqualität spielt für unsere Kartoffelmarkt-Ökonomen keine Rolle, der Preis der Arbeit bildet sich ja auf dem Markt und wenn der Preis der Arbeit eben seinen Mann nicht mehr ernährt, dann ist die Arbeit eben auch nicht mehr Wert.
Da werden der Rückgang der Arbeitsproduktivität und die Zunahme der Lohnstückkosten (um 1,0 %) durch inzwischen leichte Lohnerhöhungen kritisch betrachtet, schon wird wieder die Gefahr einer „Lohn-Preis-Spirale“ an die Wand gemalt (S. 29), ganz so als hätte Deutschland nicht im letzten Jahrzehnt durch permanentes Lohndumping unsere europäischen Nachbarn niederkonkurriert und dadurch wesentlich zu den Leistungsungleichgewichten gegenüber unseren europäischen Nachbarn beigetragen. Der weitere Anstieg der Exporte um 9,8% (2011) und 6,5% (2012) auch in die Mitgliestaaten der EWU wird nicht etwa problematisiert sondern als Erfolg vermeldet. (S.30) Die schwache Konjunktur in den Peripherieländern des Euroraums (Griechenland, Portugal, Spanien) dürfte sich nach Meinung dieser Exporten kaum bemerkbar machen, da deren Anteil an der Gesamtausfuhr Deutschlands nur gering sei. (S. 31)
Obwohl man mit eine restriktiven finanzpolitischen Impuls in Relation zum nominalen BIP von 0,4 bzw. 0,9 % rechnet, werden der Konsolidierungskurs der Regierung und die Vorgaben der „Schuldenbremse“ gelobt. (S. 29, 44)) Die sinkenden Sozialleistungen u.a. durch das sog. „Sparpaket“ werden positiv gewürdigt (S. 40)
Und natürlich ist man gegen die Finanztransaktionssteuer (S. 29).
Fazit: Die „Gemeinschaftsdiagnose“ spielt auf der alten Leier, die ja bekanntlich aufgrund ihrer wenigen Saiten und nur geringem Tonumfang ziemlich eintönig ist und sich auf die Wiederholung des altbekannten beschränkt. Solange das Bundeswirtschaftsministerium nicht endlich einmal auch neue und alternative (wirtschaftspolitische) Saiten aufzieht und auch abweichende ökonomische Ansätze bei der Begutachtung zu lässt, werden wir auch in Zukunft nur die altbekannten, ewig gleichen Wiederholungen hören.
Die „Gemeinschaftsdiagnose“ wird weiter nur die Funktion haben, die Wirtschaftspolitik ihres jeweiligen Arbeitgebers in höchsten Tönen zu loben – sofern er dem neoliberalen Kurs der beauftragten Forschungsinstitute folgt.
Typisch für die monetaristische Grundeinstellung der Forschungsinstitute ist ihre Kritik an den institutionellen Reformen der Europäischen Währungsunion. Scharf werden die Mechanismen zur Korrektur „makroökonomischer Ungleichgewichte“ – einer der Hauptursachen der derzeitigen Schuldenkrise der sog. Peripherstaaten – kritisiert. Die Ungleichgewichte stellten keineswegs notwendigerweise eine Gefahr für die Währungsunion dar, sie spiegelten nur die strukturellen Unterschiede wider. Diese Mechanismen könnten nur „zu schwer zu rechtfertigenden Eingriffe in die marktwirtschaftliche Ordnung genutzt werden“ (S. 48) und damit die Grundlage des Wohlstandes in der EU beschädigt werden. Offener kann man seine Marktideologie nicht zur Schau tragen.
Massiv wenden sich unsere Marktgläubigen dagegen, dass der Pakt fordere, dass sich die Arbeitskosten entsprechend der Produktivität entwickeln sollten. Damit wäre der Wirtschaftspolitik die Möglichkeit genommen „für anpassungsfähige Arbeitsmärkte zu sorgen“ (S. 49) – auf deutsch übersetzt: auf weitere Flexibilisierung und weiteres Lohndumping zu setzen. Selbst hinter den mehr als vagen Stabilisierungsmechanismen auf EU-Ebene fürchten unsere Gutachter „eine Tendenz zu wirtschaftspolitischem Zentralismus“. Viele Vorlagen der EU entfernten sich vom Leitbild der Marktwirtschaft.
Die Forschungsinstitute verlangen deshalb vielmehr die „Einrichtung eines dauerhaften Krisen- und Insolvenzmechanismus für Euroländer“ als weitaus wichtigstes Reformwerk.
Die Forschungsinstitute die hier so locker über die Insolvenz von Staaten daherreden, verweigern damit eine wirkliche Analyse der Schuldenkrise der südeuropäischen Länder. Griechenland oder Portugal (bei Irland liegt die Lage anders) haben sich doch vor allem deshalb im Ausland verschuldet (verschulden müssen), weil sie unter anderem gerade durch Deutschland mit seinem jahrzehntelangen Lohndumping in hohe Leistungsbilanzdefizite getrieben worden sind und durch den gemeinsamen Euro, das Geld, das sie zum Zahlen brauchen nicht mehr autonom drucken konnten. Wer wirklich das Ziel hat, dass die Europäische Währungsunion zu einer politischen Union zusammenwächst, der muss die außenwirtschaftlichen Probleme innerhalb der EWU lösen. Wer das nicht will, sollte besser gleich so ehrlich sein, ein Ausscheiden der verschuldeten Länder aus der EWU zu empfehlen.
Eine von den Forschungsinstituten in einem Insolvenzverfahren notwendige „Umschuldung“ („Hair-Cut“) würde – einmal abgesehen von den unabsehbaren Folgen für das Finanzsystem – die außenwirtschaftlichen Probleme innerhalb der EWU bestenfalls vertagen.
(Siehe Flassbeck [PDF – 75 KB])













