
NachDenkSeiten – Die kritische Website
Titel: Exzellenz außer Konkurrenz: Die neuen Eliteuniversitäten sind die alten und der Rest geht baden.
Datum: 24. Juli 2019 um 8:55 Uhr
Rubrik: Aktuelles, Hochschulen und Wissenschaft, Interviews
Verantwortlich: Redaktion
Seit Freitag stehen die Gewinner der jüngsten Runde der Exzellenzstrategie zur Förderung von Spitzenforschung fest. Das Feld der Sieger versammelt die üblichen Verdächtigen. Das ist politisch gewollt: Den großen, reichen Unis wird immer mehr gegeben und bluten müssen die kleinen, mittleren und Ausbildungshochschulen – alles dafür, dass die deutsche Wissenschaft in einer Liga mit Harvard, Princeton und Stanford mitmischt. Das Ziel ist so verwegen wie unerreichbar, meint der Eliteforscher Michael Hartmann. Im Interview mit den NachDenkSeiten entblößt er den Wettstreit um Ruhm und Fördermillionen als Scheingefecht mit vorhersehbarem Ausgang. Auf der Strecke blieben die einst hohe Qualität in der Breite und die Interessen der Studierenden. Mit dem emeritierten Soziologen sprach der Journalist Ralf Wurzbacher.
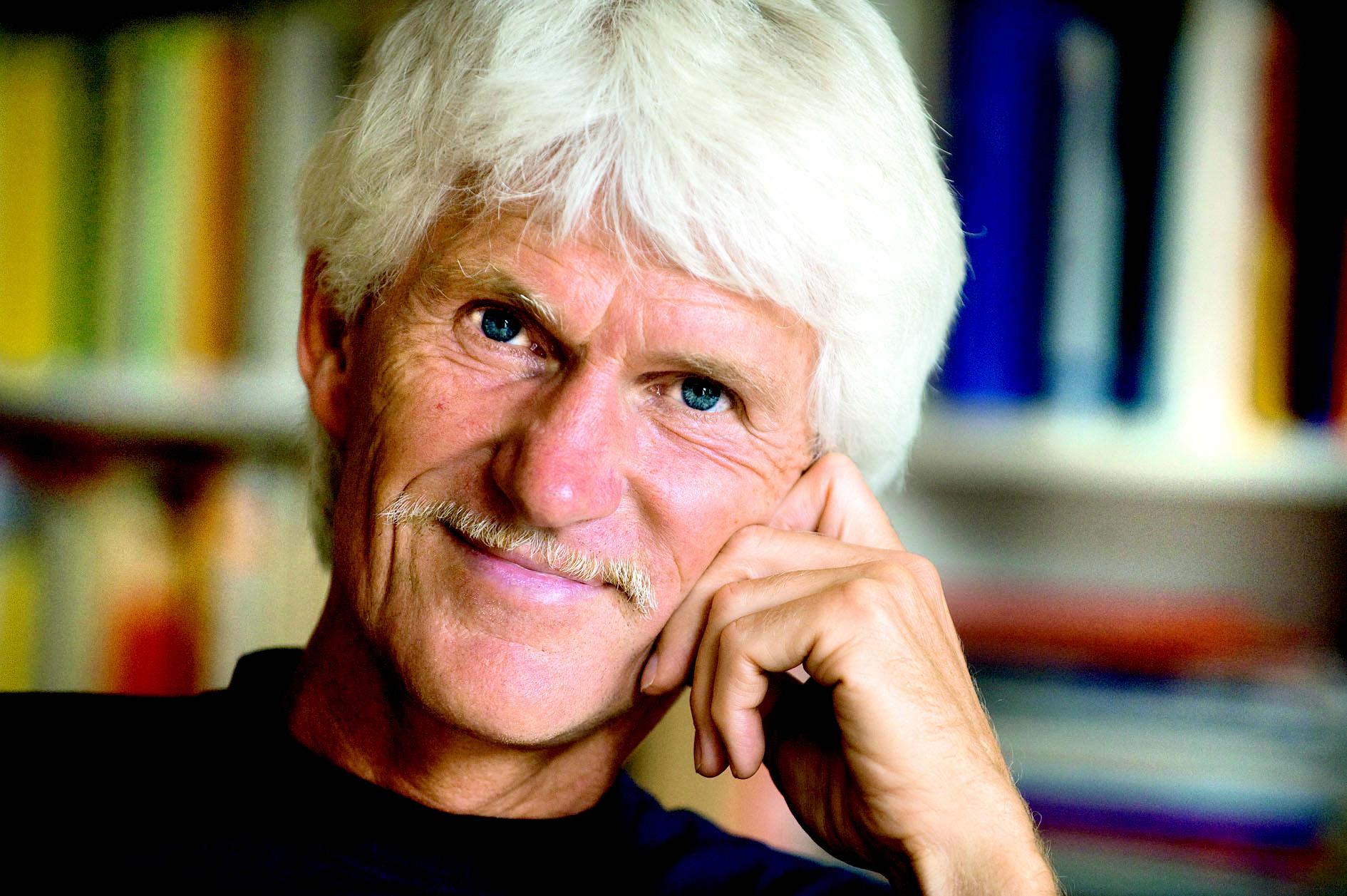 Foto: Privat
Foto: PrivatZur Person: Michael Hartmann, Jahrgang 1952, war bis zu seinem Ruhestand Professor für Soziologie an der Technischen Universität Darmstadt. Er forscht über Eliten, Globalisierung und nationale Wirtschaftskulturen sowie Hochschulsysteme im internationalen Vergleich. Vor einem Jahr erschien von ihm im Campus-Verlag: „Die Abgehobenen: Wie die Eliten die Demokratie gefährden.“
Herr Hartmann, um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen: Wozu wurde die Exzellenzinitiative, neuerdings Exzellenzstrategie, eigentlich erfunden?
Es gibt eine offizielle und eine inoffizielle Version. Offiziell wurde und wird verlautbart, es bräuchte in Deutschland internationale Leuchttürme der Wissenschaft, um dem Brain-Drain, also der Abwanderung kluger Köpfe ins Ausland, insbesondere in Richtung der USA, zu begegnen und deutsche Universitäten für ausländische Spitzenforscher attraktiver zu machen. Weil das angeblich mit unserem traditionellen, mehr auf Breite angelegten Hochschulsystem nicht zu bewerkstelligen wäre, müssten verstärkt Investitionen in die Spitze erfolgen und besonders leistungsfähige und international sichtbare Einrichtungen geschaffen werden, die mit Eliteuniversitäten wie Harvard, Princeton oder Stanford konkurrieren könnten. Aber, und das wurde in den ersten zehn Jahren stets pflichtschuldig dazu gesagt, beim Wettbewerb um Fördergelder hätten natürlich alle die gleichen Chancen und es gehe lediglich um eine funktionale Differenzierung.
Was allerdings nicht stimmt?
Ja, und damit sind wir bei dem, was die inoffizielle Marschrichtung war und ist. Demnach zielt die Exzellenzinitiative auf eine massive hierarchische, also vertikale Differenzierung ab, um bei der Verteilung der Mittel eine deutlich stärkere Konzentration zu erreichen und beim Renommee eine klare Aufteilung in zwei grundsätzlich unterschiedliche Klassen von Universitäten zu schaffen. Das bedeutet eine klare Absage an die bewährten Strukturen mit einer weitgehend gleichen Verteilung der staatlichen Mittel auf ein breites Feld vom Grundsatz her gleicher Akteure. Im Klartext: Das Prinzip „the winner takes it all“ musste endlich auch in Deutschland Einzug halten.
Nur gehen die Verantwortlichen damit nicht hausieren …
Natürlich war das lange nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und es wird auch heute nicht an die große Glocke gehängt. Aber ich habe vor ungefähr zehn Jahren einmal aus Zufall auf einer Tagung dem Gespräch zweier Vertreter von bis heute erfolgreichen Exzellenzuniversitäten lauschen können, wovon der eine kurz davor stand, die Eröffnungsrede zu halten. Zu seinem Gegenüber sagte er: „Gleich werde ich wieder das Übliche von der funktionalen Differenzierung erzählen. Aber wir wissen ja, worum es wirklich geht.“ Beide Protagonisten sind glühende Anhänger und Unterstützer der Exzellenzinitiative und fest davon überzeugt, dass die Konzentration der Mittel auf ein paar wenige Standorte die Leistungs- und die internationale Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wissenschaft steigert.
Wer hat die Exzellenzinitiative erfunden?
Es gab drei wesentliche Faktoren für ihre Einrichtung. Erstens wurde damals fast die gesamte Gesellschaft vom Siegeszug des Neoliberalismus erfasst, mit seinem Prinzip der Überlegenheit des Marktes gegenüber dem Staat. Konkurrenz sollte bei der Mittelvergabe an die Stelle relativ gleichmäßiger staatlicher Verteilung treten. Zweitens wollte die Regierung Schröder auch in der Hochschulpolitik beweisen, dass sie von den alten sozialdemokratischen Traditionen Abschied genommen hat. „Elite statt Gleichmacherei“ hieß die neue Devise. Schließlich gab es auf Seiten der Wissenschaft, vor allem bei den Spitzenvertretern der aussichtsreichen Universitäten wie Aachen, Berlin, Heidelberg oder München großes Interesse an der Initiative. Man rechnete sich dort, meistens zu Recht, aus, im Verteilungskampf um die knappen Hochschulmittel einen deutlichen Vorteil erzielen zu können.
Wie weit ist die angestrebte Spaltung der Hochschullandschaft 15 Jahre nach Einführung des Instruments fortgeschritten?
Dazu muss man sich nur den Bericht der Imboden-Kommission ansehen, die nicht um den heißen Brei herumgeredet hat. Demnach sei die hierarchische Differenzierung Ziel des Wettbewerbs gewesen und den Weg dorthin habe man erfolgreich beschritten.
Zum besseren Verständnis: Der Schweizer Umweltphysiker Dieter Imboden hatte das Programm als Frontmann der nach ihm benannten Kommission evaluiert und im April 2016 seine Empfehlungen vorgelegt.
Und was darin steht, ist deshalb so aufschlussreich, weil das Gremium bis auf eine Ausnahme mit Leuten besetzt war, die die Exzellenzinitiative sehr positiv sehen. Deshalb ist der Imboden-Bericht, da wo er kritisch ist, viel stärker zu gewichten als andere Verlautbarungen, gerade deshalb, weil darin ganz offiziell die Katze aus dem Sack gelassen wird. An einer Stelle heißt es da, „dass eine vertikale (leistungsbezogene) Differenzierung eines nationalen Universitätssystems nicht per se schlecht oder gar ungerecht ist, sondern dessen Effizienz zugutekommt“. Man will einfach ein Zweiklassensystem in der Hochschullandschaft.
Die Evaluation war Impulsgeber für das vor drei Jahren durch Bund und Länder als Exzellenzstrategie vereinbarte Anschlussprogramm. Wie viel Imboden steckt in der Beschlussfassung?
Seine Empfehlungen wurden weitgehend umgesetzt. Die Graduiertenschulen, die bis dahin dritte und einzige Förderlinie, die zumindest teilweise auch auf eine Verbesserung der Lehrbedingungen zielte, hat man einfach eingestampft. Dazu können Anträge bei den sogenannten Exzellenzclustern neuerdings auch von Hochschulverbünden eingereicht werden. Die einschneidendsten Veränderungen betreffen aber die Verstetigung des Programms, das bisher immer eines mit möglichem Ende war, sowie die Mechanismen, die das Feld der Profiteure weiter verfestigen. Um beim Rennen um den Titel Exzellenzuniversität mitmachen zu können, sind zwei prämierte Exzellenzcluster zwingende Voraussetzung, bei Verbünden braucht es drei Zuschläge. Das können fast nur die großen, finanz- und forschungsstarken Unis meistern. Und natürlich erhöhen sich die Chancen, am Ende als Eliteuni ausgezeichnet zu werden, mit der Zahl der geförderten Cluster.
Und Sie meinen, den Platz an der Sonne wird man den Siegern künftig noch schwerer streitig machen können?
Das Feld der Profiteure war schon immer ziemlich festgefahren. Bis auf wenige Ausreißer räumen seit Jahren die üblichen Verdächtigen ab. Das ist auch nur logisch und genau so gewollt: Die Sieger werden mit jeder Förderung stärker, bauen ihren Vorsprung aus und mit dem Mehr an Reputation werben sie noch mehr staatliche und private Drittmittel ein. Die Top-Ten der deutschen Hochschullandschaft hat seit Beginn der Exzellenzinitiative die Gelder aus den Töpfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft um zehn Prozent gesteigert. Und ja: Die Konzentration in der Spitze wird unter den neuen Bedingungen der Exzellenzstrategie noch einmal zunehmen.
Warum?
Bisher musste man sich zu jeder Förderrunde mit einem neuen Antrag bewerben, das heißt, jeder Anwärter fing zumindest auf dem Papier bei Null an. Künftig sollen die Sieger alle sieben Jahre nur noch einer Evaluation unterzogen werden zum Nachweis, ob sie die ausgegebenen Ziele erreicht haben. Imboden geht sogar das zu weit. Er hatte dafür plädiert, lediglich Indikatoren wie das Drittmittelaufkommen und wichtige Preise für Forschungsleistungen zur Bewertung heranzuziehen und auf dieser Basis die zu fördernden Universitäten auszuwählen. Damit konnte er sich zwar nicht durchsetzen, aber im Kern läuft das gewählte Prozedere auf dasselbe hinaus: Den Gewinnern wird es noch einmal leichter gemacht, ihre Spitzenposition dauerhaft zu behaupten.
Wo bleibt da der Wettbewerbsgedanke, den die Protagonisten so gerne hochhalten?
Man ist dabei, eine Uni-Champions-League mit Regularien zu errichten, die Bayern München, Real Madrid und der FC Barcelona bisher nur für die Zukunft planen. Die müssen sich immer noch im alljährlichen nationalen Wettbewerb für das Kräftemessen auf der großen europäischen Fußballbühne qualifizieren. Dagegen wird bei der Exzellenzstrategie echter Wettbewerb institutionell weitgehend unterbunden. Man müsste sich schon ziemlich dumm anstellen, um Titel, Ruhm und Anschlussförderung einzubüßen. Dass von den jetzt elf siegreichen Standorten einer auf der Strecke bleibt, ist sehr unwahrscheinlich. Womöglich wird auch mal einer absteigen und ein anderer aufsteigen. Das wahrt dann immerhin den Schein von Konkurrenz. Aber im Kern wird die Konstellation in den kommenden Jahrzehnten zementiert. Elf, nach den Plänen später vielleicht auch 15 Standorte, werden sich immer weiter vom großen Rest absetzen.
Die elf Gewinner der neuen Runde sind die Abonnementsieger Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) in Aachen sowie die Technische (TUM) und die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München. Dazu kommen die Unis Konstanz, Heidelberg, Tübingen und im Verbund die drei Berliner Unis FU, HU und TU, dazu die TU Dresden, die Unis aus Hamburg und Bonn sowie das Karlsruher Institut of Technology (KIT). Gibt es für Sie Überraschungen?
Das ist es ja: Die Auswahl ist zum ersten Mal überraschungsfrei, was wiederum keine Überraschung ist. Jetzt, da das Programm auf Dauer gestellt ist, bringt man im Paket genau die Kandidaten in Stellung, die auf lange Sicht die Spitze der deutschen Hochschullandschaft stellen sollen. Dabei ignoriert man auch gravierende Wissenschaftsskandale: Die Uni Heidelberg hat sich mit ihrem unbrauchbaren Bluttest zur Brustkrebsdiagnose bis auf die Knochen blamiert – und trotzdem ihren Elitestatus verteidigt.
So wie acht weitere Standorte, die seit 2012 das Elitesiegel trugen …
Wie gehabt ist auch die regionale Verteilung. Mit der TU Dresden gibt es wie immer einen Sieger in Ostdeutschland. Ein Titel geht nach Norden, mal war es Göttingen, zuletzt Bremen, jetzt Hamburg. Mehr kriegt der Norden nicht ab. Berlin ist immer dabei, zwei Gewinner stellt seit Jahr und Tag München, und der Rest geht in die Rheinschiene, wobei Baden-Württemberg diesmal gleich vier Vertreter stellt. Klar war auch, dass Bochum, obwohl mit zwei siegreichen Clustern im Rennen, keine Eliteuni wird, so wie das ganze Ruhrgebiet noch nie zum Zug gekommen ist.
Riecht das nicht streng nach politischer Einflussnahme?
Politische Überlegungen spielen seit jeher eine Rolle. Der entscheidende Punkt ist aber der Vorsprung, den sich die Siegerunis in den vorangegangenen Runden erarbeitet haben. Das betrifft nicht nur die eingespielten Gelder, sondern auch das Renommee, auf das die Gutachter vertrauen – wenn nötig auch blind, wie sich im Fall Heidelberg zeigt.
Die akademische Klasse ist demnach nicht unbedingt das Hauptkriterium bei der Elitekür?
Hier wirkt eine Mischung aus politischen Vorgaben, wissenschaftlicher Expertise und subjektiven Vorurteilen der Gutachter. Was den Unterschied zwischen Freiburg und Tübingen ausmachen soll, erschließt sich wissenschaftlich nicht wirklich. Die TU Dresden hat sich ohne Frage viel Mühe gegeben und mit Unterstützung der Landespolitik manches aufgebaut. Aber das erklärt nicht, warum die Uni plötzlich so brillant sein soll. Vielmehr durfte es einfach nicht sein, dass der Osten keine Eliteuni hat.
Zurück zu den erklärten Ansprüchen, die die Macher mit dem Uniwettstreit verbinden. Wie weit sind die deutschen Exzellenzuniversitäten von der internationalen Spitze entfernt?
In puncto Geld und Ausstattung liegen Welten dazwischen. Das Massachusetts Institute of Technology hat zum Beispiel gut 11.000 Studierende bei einem Jahresetat von fast 3,6 Milliarden Dollar. Das Jahresbudget von Harvard liegt bei 4,5 Milliarden Dollar, das von Stanford sogar bei 6,5 Milliarden Dollar, und diese für 20.000 bzw. gut 16.000 Studierende. Das reiche Bundesland Baden-Württemberg gibt für den gesamten Bereich Wissenschaft, Forschung und Kunst dagegen mit gut 5,2 Milliarden Euro zwar ähnlich viel Geld wie Harvard oder Stanford aus, hat aber ungefähr 360.000 Studierende. Das macht die Differenz deutlich.
Den deutschen Siegerunis winken für ihr prämiertes Zukunftskonzept und abhängig von der Zahl der ausgezeichneten Exzellenzcluster zwischen 25 und 50 Millionen Euro jährlich. Sind das im Spiel der Großen der Welt nicht nur Peanuts?
Ein Vergleich zwischen privaten US-Unis und den deutschen Hochschulen führt hier nicht weiter, weil es um völlig verschiedene Systeme geht. Im deutschen Maßstab sind besagte Summen deshalb auch kein Pappenstiel. Viele der neuen alten Sieger, wie etwa die TU und die LMU München oder die RWTH Aachen, beziehen diese Extrabeträge seit fast 15 Jahren, zusätzlich zu reichlich mehr Drittmitteln aus anderen Quellen. Das ist nicht nur für sich gesehen viel Geld, es ist vor allem viel Geld, das andere nicht haben. Seit 2005 flossen mit der Exzellenzinitiative fast 45 Milliarden Euro. Im gleichen Zeitraum sind die Grundmittel der Hochschulen im Verhältnis zu den Studierendenzahlen merklich zurückgegangen. Profitiert hat von dem Programm aber nur ein kleiner Teil der bundesweit rund 250 staatlichen Hochschulen.
Das ist wohl der Preis, den man zahlen muss, damit deutsche Unis Weltniveau erlangen?
Das allerdings ist mit den Summen nicht zu schaffen. Die Unis mögen damit Forschungsschwerpunkte setzen können und in einzelnen Bereichen sichtbarer werden, mehr aber auch nicht. Ich habe vor Jahren die ETH Zürich mit der TU Darmstadt verglichen. Die hatte dreimal mehr Studierende, aber nur halb so viel Geld. Wollte man wenigstens im Kreis der führenden Staatsunis mitspielen, müssten die Gelder statt auf elf auf nur drei oder vier Unis konzentriert werden und etwa Baden-Württemberg sich nicht vier, sondern nur eine Eliteuni halten. Die ETH Zürich ist eine Bundesuniversität, ein Modell, das auch bei uns immer wieder diskutiert wird. Würde man das machen, wäre der Schaden in der Breite freilich noch viel verheerender.
Und was wäre, wenn man die Spitzenunis gleich ganz privatisiert?
Das ist bei uns nicht umsetzbar und wird auch nicht ernsthaft erwogen. Allerdings hat die Wirtschaft auch heute schon mit dem Instrument der Drittmittelvergabe, ob über staatliche Wettbewerbe oder direkt von der Industrie kommend, großen Einfluss auf die Forschungstätigkeit der Hochschulen. Wenn man heute einen Förderantrag rund um die Themen Künstliche Intelligenz, Industrie 4.0 oder Gentechnik stellt, erhöht das die Chancen auf einen Zuschlag kolossal. Alles, was in den technischen und naturwissenschaftlichen MINT-Fächern oder in den Life Sciences behandelt wird, steht auch bei der Exzellenzstrategie weit oben im Kurs. Die Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften sind dagegen nahezu chancenlos und werden damit weiter ins Abseits befördert.
Womit wir bei den Studierenden wären. Was haben die von der Exzellenzstrategie?
In zwei Bereichen hat die Exzellenzinitiative eindeutig zu Verschlechterungen geführt. Die forschungsstarken Professoren haben sich in erheblichem Ausmaß aus der Lehre zurückziehen können. Die an den Exzellenzclustern beteiligten Forscher haben ihr Lehrdeputat im Schnitt halbiert. Das heißt, sie teilen ihre Kenntnisse nur noch sehr begrenzt mit den Studierenden. Den zweiten Punkt hatte ich schon angesprochen: Die Grundfinanzierung der Hochschulen ist im Windschatten des Programms zurückgeblieben. Das macht sich auch innerhalb der siegreichen Institutionen bemerkbar. Hier werden die Gelder und Personalmittel zugunsten der geförderten Institute und Fakultäten umgeschichtet und verstärkt aus den wirtschaftsfernen Fächern abgezogen. Und das endet nicht mit dem Tag, an dem ein Cluster aus der Förderung fällt. Dann wird dieser Schwerpunkt natürlich, soweit möglich, aus den laufenden Mitteln weiterfinanziert, womit für den Rest noch weniger übrigbleibt. Oder es läuft so wie in Niedersachsen, nachdem die Uni Göttingen 2012 ihr Elitelabel verloren hatte. Das Land machte mal eben 50 Millionen Euro dafür locker, um das Aufgebaute zu bewahren.
Nun gibt es immer noch diesen vermeintlichen Widerspruch zwischen Klasse und Masse. Die Unis sind weiterhin im Rahmen der sogenannten Kapazitätsverordnung dazu verdonnert, mehr Studenten aufzunehmen, als ihnen lieb ist. Dieter Imboden hat dies dieser Tage problematisiert und dem Berliner Tagesspiegel gesagt: „Es müsste daher im Sinne der oben erwähnten vertikalen Differenzierung den Universitäten die Freiheit gegeben werden, sich in geeigneter Form ihre Studierenden für die einzelnen Studiengänge selber auszuwählen.“ Droht hier über kurz oder lang ein Dammbruch?
Das ist keine neue Forderung. Schon zu Beginn der Exzellenzinitiative wollte der ehemalige Präsident der Göttinger Uni die Zahl der Studierenden an seiner Einrichtung glatt halbieren. Interessierte Kreise hatten gehofft, dass mit Einführung allgemeiner Studiengebühren die Entwicklung in diese Richtung geht. Dafür wollte man die Beiträge für ausgewählte Standorte zügig über die anfänglichen 500 Euro hinaus hochtreiben und dann eine Handhabe schaffen, sich die Studenten selbst auszusuchen. Mit der flächendeckenden Abschaffung der Gebühren wurde daraus nichts und aktuell sehe ich keine Anzeichen dafür, dass sich daran in nächster Zeit etwas ändern könnte. Genauso wenig glaube ich, dass demnächst die Kapazitätsverordnung gekippt wird.
Was ist mit der Exzellenzstrategie? Sehen Sie Kräfte, die diese kippen könnten?
Nein. Das Ganze ist jetzt eineinhalb Jahrzehnte gelaufen und wurde gerade um weitere sieben Jahre verlängert. Damit ist es Teil der Grundstruktur der Hochschullandschaft, an die sich die Beteiligten gewöhnt haben. Auch die vielen Verlierer haben sich damit abgefunden. Die Aufteilung in eine Zweiklassengesellschaft wird bleiben und sich mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter verstärken.
Titelbild: katatonia82 / Shutterstock
Hauptadresse: http://www.nachdenkseiten.de/
Artikel-Adresse: http://www.nachdenkseiten.de/?p=53616