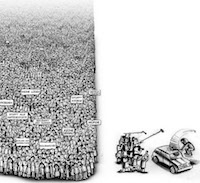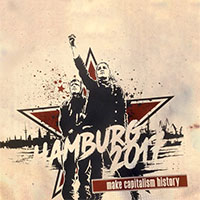Über Grenzen nachdenken. Rezension eines neuen Buches zur Ethik der Migration
Im Moment kommen an Italiens Küste wieder viele neue Flüchtlinge an, was zu verzweifelten Hilfeappellen der italienischen Regierung an die anderen EU-Mitgliedsstaaten geführt hat. Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat das Thema gerade für den SPD-Wahlkampf entdeckt. Das neue Buch zur Flüchtlingspolitik von Julian Nida-Rümelin, Professor für Philosophie an der Universität München und ehemaliger Kulturstaatsminister in der Rot-grünen Regierung Gerhard Schröders, könnte deshalb nicht aktueller sein. Könnte! Udo Brandes hat das Buch für die Nachdenkseiten gelesen und rezensiert.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.