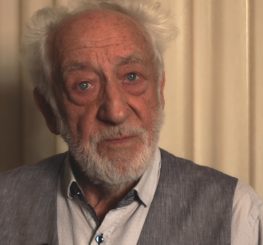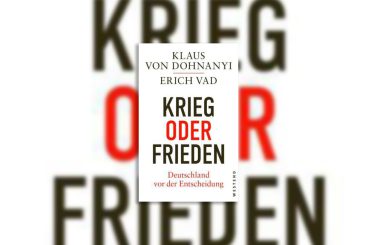„Ich habe gesät, reichlich gegossen. Nun darf ich anscheinend ernten.“

Der Berliner Dirk Zöllner wird nach wie vor eher dem ostdeutschen Publikum ein Begriff sein. Der Sänger, Musiker, Komponist, Buchautor, ein Lebensfroher, Hungriger, Zweifelnder, Nachdenkender ist nach wie vor mit seiner Band „Die Zöllner”, im Duo mit seinem ewigen Freund und Kollegen, dem Pianisten und Sänger André Gensicke, und mit weiteren Projekten vor allem in Ostdeutschland unterwegs. Trotz eines engen Zeitplans hat sich Dirk Zöllner, einer der Erstunterzeichner des Berliner Appells, dennoch die Zeit genommen, um wieder einmal in ein intensives, persönliches Gespräch mit Frank Blenz für die NachDenkSeiten einzutauchen.