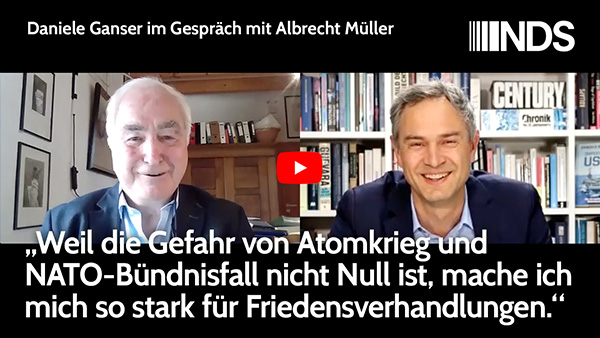„Wir mussten neu bauen – aus einer Position der Schwäche“ – Mit diesen Worten beschreibt der sowjetisch/russische Diplomat Wladimir Michailowitsch Polenow die damalige Lage Moskaus im Umbruch von 1989/90. Im Gespräch mit Artem Pawlowitsch Sokolow beleuchtet Polenow die Umstände des Beitritts der DDR zur BRD, die Besonderheiten des Verhandlungsprozesses und teilt seine persönliche Einschätzung der Folgen der Ereignisse von 1989/90. Aus dem Russischen übersetzt von Éva Péli.
Die deutsche Wiedervereinigung stellte die Sowjetunion vor immense politische und diplomatische Herausforderungen. Polenow, ehemaliger Mitarbeiter der sowjetischen Botschaft in der BRD, war nicht nur hautnah an den Geschehnissen beteiligt. Er war später als Mitarbeiter des Außenministeriums maßgeblich an der Ausarbeitung zentraler Abkommen, einschließlich des Zwei-plus-Vier-Vertrags, beteiligt.
Artem Sokolow: Wladimir Michailowitsch, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Haben Sie Ende der 1980er-Jahre eine Perspektive für eine mögliche Wiedervereinigung Deutschlands gesehen?
Wladimir Polenow: Im September 1989, nach siebeneinhalb Jahren fast ununterbrochenen Aufenthalts in Deutschland, machte ich mich auf den Weg nach Hause nach Moskau. Botschafter Juli Alexandrowitsch Kwizinski wollte mich damals nicht so recht gehen lassen – auch weil sich in Ostdeutschland Prozesse anbahnten, die später zu dem führten, was wir heute haben.
Ich würde nicht sagen, dass wir damals in der Botschaft der Sowjetunion in der Bundesrepublik Deutschland das Gefühl hatten, dass gleich etwas passieren würde – und dass alles innerhalb einer Stunde zusammenbrechen würde. Ich glaube nicht wirklich denen, die später behaupteten, sie hätten diese rasante Entwicklung der Ereignisse vorausgesehen, die wie eine Dampfwalze über die gesamte internationale Lage hinwegrollte, einschließlich des Völkerrechts. Aber es war klar, dass ein Prozess in Richtung einer „Zerlegung“ der DDR in Gang gekommen war.
Das haben wir schon 1986 gespürt. Warum? Schon damals war uns, die wir in Bonn arbeiteten, durch unsere Kontakte klar, dass die mit dem Amtsantritt von Michail Sergejewitsch Gorbatschow begonnene Politik der damaligen DDR-Führung nicht gefiel. Bezeichnend war der Besuch meines guten Freundes, des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Lothar Späth, bei Erich Honecker in Ostberlin. In jenen Jahren hatte ich offiziell die Position des Kulturattachés der Botschaft inne und war darüber hinaus faktisch Assistent des amtierenden Botschafters J. A. Kwizinski. Späth rief mich an und bat mich, zur Eröffnung einer Ausstellung ostdeutscher Künstler in Stuttgart zu kommen. Bemerkenswert ist, dass mich die Ständige Vertretung der DDR nicht zu dieser Veranstaltung eingeladen hatte, obwohl ich Kulturberater war … Ich konnte nicht zur Eröffnung kommen – entweder wegen Staus oder aus einem anderen Grund. Ich kam erst zum Abendessen, und Späth erzählte mir am Rande ausführlich von seinem Gespräch mit Honecker. Natürlich sprachen sie über die Sowjetunion, die Perestroika und Gorbatschow. Honecker beschimpfte ohne Umschweife unseren Staatschef und benutzte dabei alle Schimpfwörter, die ihm einfielen. Nach meiner Rückkehr nach Bonn berichtete ich Botschafter Kwizinski ausführlich über dieses Gespräch. Letztendlich beschlossen wir, Moskau darüber nicht zu informieren.
So war bereits 1986 eine Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung unserer Perestroika durch die DDR-Führung und der eigenen Realität offensichtlich. Die Spaltung innerhalb der DDR verstärkte sich mit dem Besuch Gorbatschows in Bonn im Juni 1989. Die Westdeutschen empfingen ihn begeistert – sowohl in Bonn als auch in Stuttgart, wo er ebenfalls hinreiste. Ich war damals unter anderem für das Programm für Raissa Maximowna Gorbatschowa zuständig. Wir sahen, wie sich in Stuttgart an einem normalen Wochentag vor dem Neuen Schloss 20.000 bis 30.000 Menschen versammelten, nur um den sowjetischen Staatschef zu sehen. Natürlich hatte sie niemand dorthin getrieben. Als wir mit Raissa Maximowna auf ihren Wunsch hin eine einfache Arbeiterfamilie in einem Vorort von Stuttgart besuchten, fanden wir nach dem Treffen unseren Dienstwagen ZIL mit mehreren Schichten Blumen bedeckt vor. So nahmen die Deutschen diesen Besuch wahr.
Dann folgte der Besuch von Gorbatschow in der Hauptstadt der DDR. Damals sah und hörte die ganze Welt diese Rufe „Gorbi, rette uns! Hilf uns!“. Gleichzeitig muss auch an die Montagsdemonstrationen in Leipzig erinnert werden.
Allerdings konnte J. A. Kwizinski mich nicht länger in Bonn halten. Unsere Zentrale bestand darauf, dass meine siebeneinhalbjährige Entsendung nun beendet sei und meine Rückkehr anstehe. Da mir die Möglichkeit fehlte, jedes Jahr Urlaub zu nehmen, plante ich, die Zeit für eine ausgedehnte Erholung zu nutzen – ich hatte mindestens drei Monate bezahlten Urlaub angesammelt. Diese Pläne wurden jedoch durch die deutsche Wiedervereinigung obsolet. Nach drei Wochen rief mich der Leiter der Dritten Europaabteilung des Außenministeriums, Alexander Pawlowitsch Bondarenko, an und fragte:
- Was machst du?
- Ich mache nichts, ich bin im Urlaub.
- Was für ein Urlaub? Siehst du denn nicht, was da gerade los ist?
Ich wurde dringend zur Arbeit gerufen und habe mich an der Ausarbeitung des Zwei-plus-Vier-Vertrags beteiligt. So konnte ich – natürlich nicht aus Berlin, sondern aus Moskau – alles mitverfolgen, was in der DDR und in Berlin geschah, vor allem den Fall der Mauer. Es war klar, dass die Öffnung der Grenzen nicht nur die Deutschen im Osten und Westen durcheinanderbringen, sondern auch die gesamte Nachkriegsordnung zerstören würde.
Sie wissen sehr gut, wie sich die Bewegung der BRD in Richtung Vereinigung weiterentwickelte – zunächst entstand die Idee einer Konföderation oder Föderation. Als es dann aber darum ging, die außenpolitischen Aspekte der deutschen Regelung internationalrechtlich zu regeln, tauchten viele Fragen auf.
Das Wichtigste war natürlich, dass wir keine andere Wahl hatten, als Formen zu finden, um diese Einheit unter Berücksichtigung unserer Interessen zu gestalten, vor allem, weil wir Truppen in der DDR stationiert hatten. All diesen Prozessen ging bekanntlich ein Vertrag zwischen der BRD und der DDR über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion voraus. Die Westmark kam in den Osten. Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir Ende April 1990 mit Bondarenko im Büro des Botschaftsrats in unserer Botschaft in Berlin saßen. Wir hörten den Lärm von Unter den Linden, wo bereits Festzelte aufgestellt waren, in denen Coca-Cola, verschiedene Süßigkeiten und Leckereien verkauft wurden und Musik spielte. Damals akzeptierten die Verkäufer dort bereits beide Währungen: die ostdeutsche Mark und die D-Mark.
Zu diesem Zeitpunkt musste Botschafter Kwizinski dringend nach Moskau zurückkehren, da er zum stellvertretenden Minister ernannt worden war. Nachdem ich also nur kurze Zeit in der Dritten Europaabteilung gearbeitet hatte, wechselte ich in das Sekretariat von J. A. Kwizinski, um näher an diesem Prozess beteiligt zu sein.
Das kostete mich viele schlaflose Nächte. Eines Tages rief mich der Botschafter in sein Büro und sagte: „Schreiben Sie einen Entwurf für einen Vertrag über den Abzug unserer Truppen.“ Mein erster Gedanke war: „Aber wie? Wo soll ich nachschauen? Noch nie wurden unsere Truppen abgezogen!“. Und er: „Ich weiß nichts davon – setz Dich hin und schreib!“ Ich musste also schreiben. Die Grundprinzipien der völkerrechtlichen Regelung in Bezug auf Deutschland wurden von unserer Seite von J. A. Kwizinski selbst ausgearbeitet. Es war eine maximale Forderung, wie es in Verhandlungen üblich ist. Ich musste fast alle anderen Verträge schreiben, mit Ausnahme des Vertrags über die vermögensrechtlichen und finanziellen Aspekte der deutschen Vereinigung. Aber der „Große Vertrag”, also der Vertrag über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit mit der BRD, der auf unser Drängen hin am Tag nach der Unterzeichnung des Zwei-plus-Vier-Vertrags in Moskau paraphiert wurde, wurde zum Gegenstand meiner kreativen Arbeit.
Nach meiner Rückkehr ins Außenministerium von einem praktisch ausgefallenen Urlaub Anfang Oktober 1989 begann ich, mich mit den Berichten unserer Botschafter aus beiden deutschen Hauptstädten vertraut zu machen. Offen gesagt stammte fast die gesamte Information über die Lage in der DDR und die damit verbundenen Risiken nicht aus Berlin, sondern aus Bonn. Dies war vermutlich darauf zurückzuführen, dass die ostdeutsche Führung den Prozessen in der Sowjetunion seit Mitte der 1980er-Jahre äußerst reserviert gegenüberstand und unsere Diplomaten mit großer Vorsicht behandelte. Der Informationsfluss war, abgesehen von den sichtbaren Straßenszenen in Leipzig und Berlin, stark limitiert. Unsere Botschaft in der BRD erhielt weitaus umfangreichere Informationen.
Sie sagten, dass die Wiedervereinigung Deutschlands Ihnen Ihren großen Urlaub zunichtegemacht hat …
Und das hat mir von deutscher Seite niemand kompensiert (lächelt).
Das heißt, Sie haben aus den Nachrichten vom Fall der Berliner Mauer 1989 erfahren? Wie haben Sie auf dieses Ereignis reagiert?
Ich muss sagen, dass ich nicht in der DDR gearbeitet habe. Ich war nur 1973 für fünf Monate in der sowjetischen Botschaft in Berlin, wie es damals nach dem vierten Studienjahr üblich war. Mein gesamtes Berufsleben war mit der BRD verbunden, und dann mit dem vereinigten Deutschland. Aber noch 1973, als ich ein unerfahrener Student war und mit Bewohnern der DDR sprach, stellte ich einmal die naive Frage: „Wie nehmen Sie die Teilung der Nation wahr?“ Ein Ostdeutscher antwortete mir ganz einfach: „Sie verstehen doch, dass, wenn man eine Hand abhackt, die eine Hälfte abfällt und die andere blutet.“ Die Teilung der Nation war für die meisten Menschen nicht normal. Der Bau der Mauer trug dazu bei, die DDR als Staat zu erhalten. Ohne sie hätte sich der Zustrom von Menschen aus Ost- nach Westberlin wahrscheinlich noch weiter verstärkt, mit entsprechenden wirtschaftlichen und völkerrechtlichen Folgen. Aber ich rechtfertige den Bau der Mauer nicht. Anscheinend war diese Entscheidung damals die einzig mögliche. Es gab verschiedene Exzesse: Polizei und Grenzsoldaten schossen auf diejenigen, die die Grenze überqueren wollten – all dies wurde natürlich in den westlichen Medien verbreitet. Gleichzeitig muss man jedoch verstehen, dass schon damals, als es noch kein Internet gab, eine Flut von Propagandamaterial über das Fernsehen der BRD auf die DDR hereinbrach. In vielerlei Hinsicht überwog diese sogar die ostdeutsche Darstellung, obwohl die Propaganda in der DDR auf hohem Niveau war. Meine Diplomarbeit schrieb ich zum Thema: „Die außenpolitische Propaganda der DDR unter den Bedingungen der ideologischen Expansion der BRD“.
Man kann nicht sagen, dass wir über den Fall der Mauer empört waren. Dieser Prozess war unvermeidlich und musste früher oder später eintreten, da sich in den 44 Jahren seit Ende des Zweiten Weltkriegs zu viel grundlegend verändert hatte.
Ich begann 1974, in Bonn zu arbeiten. Was war das für eine Zeit? Es war eine Zeit, in der auf unsere Initiative hin und als Ergebnis intensiver politischer und diplomatischer Bemühungen etwas erreicht wurde, was lange Zeit nicht möglich gewesen war. Die Unterzeichnung des Moskauer Vertrags von 1970, der Abschluss des Viermächteabkommens über Westberlin und natürlich die Aufnahme beider deutscher Staaten in die UNO im Jahr 1973. Wir konnten erreichen, dass beide deutschen Staaten als gleichberechtigte Akteure der Weltpolitik agierten im Bereich der internationalen Beziehungen. Es war symbolisch, dass Erich Honecker zu einem Besuch nach Bonn kam und dass ein Foto des Bundeskanzlers und des Staatschefs der DDR vor dem Hintergrund der Flaggen der beiden deutschen Staaten gemacht wurde. Unsere Diplomatie hat aktiv dazu beigetragen. 1989 wiederum war größtenteils eine direkte Konsequenz der Verkrustung der DDR-Führung. Denn selbst der „Fall“ der Mauer war letztlich auf Fehler und interne Abstimmungsprobleme innerhalb des ostdeutschen Machtapparates zurückzuführen.
Ja, die Aussage von Günter Schabowski.
Sie waren verwirrt und konnten nichts entgegensetzen. Doch wie verliefen ähnliche Prozesse bei uns im Jahr 1991?
In welchem Umfeld arbeiteten die sowjetischen diplomatischen Vertretungen und andere Organisationen in der DDR in der Übergangszeit 1989-1990?
Ich weiß nicht sehr genau, wie die Arbeit unserer Kollegen in der Hauptstadt der DDR ablief, da ich nur wenige Male dort war. Ich kam aus Bonn für ein paar Tage, um meine Geschäfte zu erledigen, oder zusammen mit dem Botschafter. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für sie sehr schwierig war. Ich erinnere mich an mein Praktikum in unserer Botschaft in Berlin im Jahr 1973. Schon damals beobachtete ich bestimmte Prozesse in der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED). Die DDR-Führung schaffte es zwar, diese vorübergehend zu stoppen, aber nicht vollständig zu unterbinden.
Man denke nur an die Geschichte von Werner Lambertz, einem Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der SED: ein junger, aktiver, populärer und denkender Parteikader. Unsere Kollegen in der sowjetischen Botschaft in der DDR unterhielten gute, ja freundschaftliche Kontakte zu ihm. Doch irgendwann betrachteten die älteren Kräfte in der SED-Führung diese jüngeren, reformoffeneren Persönlichkeiten als Störfaktoren. Werner Lambertz verstarb tragischerweise bei einem Flugzeugabsturz viel zu früh … Die Starrheit im DDR-Führungskreis hatte sich bereits seit Mitte der 1970er-Jahre verfestigt. Vor diesem Hintergrund wurde es für unsere Diplomaten naturgemäß immer mühsamer, an authentische Informationen zu gelangen.
Westler behaupteten, dass Botschafter Pjotr Andrejewitsch Abrassimow mit dem Fuß die Tür zu Erich Honeckers Büro öffnete. Das war bei Weitem nicht der Fall.
In Ostdeutschland wusste man sehr gut, wie man sich gegenüber der UdSSR äußerlich unterwürfig verhalten und gleichzeitig seine eigenen engen Interessen wahren konnte. Man denke nur daran, in welchem Zustand sich unsere Wirtschaft in den 1980er-Jahren befand und wie die Wirtschaft der DDR im Vergleich zur sowjetischen Wirtschaft aussah. Es ist kein Zufall, dass in Ostdeutschland lange Zeit die These vertreten wurde, die DDR sei die zehntgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Das Schaufenster des Sozialismus.
Ja, natürlich. Die Ostdeutschen konnten sich wirklich auf die Schulter klopfen und sagen: „Seht her!“ Ich erinnere mich noch genau daran, was damals in den Geschäften der DDR-Hauptstadt und in den Geschäften Moskaus verkauft wurde.
Wladimir Michailowitsch Polenow ist ein sowjetischer und russischer Diplomat, außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter 1. Klasse, der lange Zeit in der BRD tätig war und an den Zwei-plus-Vier-Verhandlungen teilgenommen hat. Er ist der Verfasser des Vertrags über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der BRD und der Sowjetunion von 1990, der die Grundlagen der russisch-deutschen Beziehungen für die nächsten Jahrzehnte festlegte.
Artem Sokolow, Senior Researcher am Institut für Internationale Studien des MGIMO, ist ein ausgewiesener Experte für internationale Beziehungen. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen die deutsche Außen- und Innenpolitik, die deutsche Geschichte sowie die europäische Integration.
Dieses Interview ist Teil einer Reihe analytischer Materialien über die Außen- und Innenpolitik der BRD, die von Mitarbeitern des Instituts für Internationale Studien der MGIMO (Staatliches Moskauer Institut für Internationale Beziehungen des Außenministeriums Russlands) erstellt wurden. Wir veröffentlichen das Interview in zwei Teilen.
Das vorliegende Gespräch ist eingebettet in den analytischen Bericht über die deutsche Wiedervereinigung, erstellt am MGIMO des Außenministeriums Russlands, 2024.
Der zugrundeliegende Bericht „GESPALTENE EINHEIT: 35 Jahre Beitritt der DDR zur BRD“ führt die Forschungstradition des Instituts für Internationale Studien der MGIMO zur deutschen Politik fort.
Copyright-Vermerk: © Sokolow A.P., Worotnikow W.W., Pankow E.S., 2024.
Titelbild: DacologyPhoto / Shutterstock
Die Mauer fiel ’89 – Deutsche Frage ist nicht gelöst, Gysi stellt sie weiter
Der 17. Juni und die vergessene Unterdrückung von Streiks und Volksaufständen im Westen Deutschlands
Gedanken zum 09. November: Im Jahr 33 nach der „Zeitenwende“ des Mauerfalls