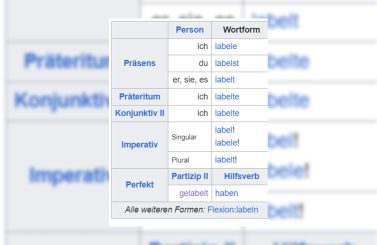Vor ein paar Wochen hatte NachDenkSeiten-Herausgeber Albrecht Müller im Artikel „´Das Narrativ steht im Fokus´ usw. – Über den Wandel unserer Sprache“ den Missbrauch von Fremd- und Lehnwörtern in der medialen Berichterstattung kritisiert und unsere Leser aufgefordert, uns ihre Einschätzung zum Thema und weitere Beispiele einzusenden. Dem ist auch der Autor Wolfgang Bittner gefolgt, der sich in einem 2002 erschienen Buch bereits mit der Thematik auseinandergesetzt hatte. Wir freuen uns, die Passage auf den NachDenkSeiten abdrucken zu dürfen.
Die deutsche Sprache ist reich, die Wahl der richtigen Wörter oft recht mühsam. Nicht immer löst der Thesaurus im Computer die Probleme. Wir können in die Stadt gehen, schlendern, bummeln, trotten, pilgern, wandern, laufen …, wir können uns in die Stadt begeben, uns ihr zuwenden, dort zu tun haben, die Richtung einschlagen … Wir können ärgerlich, aufgebracht, empört, entrüstet, erbost, ungehalten, verstimmt, missmutig oder verdrossen sein. Es ist auch ein deutlicher Unterschied in der Sprachqualität, ob ich „sehr früh“ aufgestanden bin oder „zu nachtschlafender Zeit“. Die richtige Wortwahl ist ausschlaggebend für das Gelingen eines Textes.
Das zu Papier bringen oder in den Computer eingeben, was sich in Gedanken vorbereitet. „Man kann Sätze nicht machen, man kann sie nur entgegennehmen oder ablehnen“, sagt Martin Walser. „Sie fallen einem ja ein.“ Aber man kann daran arbeiten. Sätze fügen sich zu einem Text, der wiederum bearbeitet werden kann. Genauigkeit spielt dabei eine große Rolle, die durch die Verwendung entsprechender Ausdrücke, Wörter mit geeigneten Vokalen und Konsonanten (Ruhe ist nicht Stille, schreien ist nicht rufen), wie auch durch die Syntax, durch Wiederholungen, Reihungen, Metaphern usw. erreicht wird; einmal abgesehen von den Inhalten und einer eventuellen Handlung. Auf diese Weise lässt sich auch eine bestimmte Atmosphäre erzeugen, die sich dem Leser über die Ästhetik des Formalen hinaus mitteilt. Nun sind das Idealvorstellungen; in der Praxis geht es um Annäherungen, vieles geschieht intuitiv, je nach Talent und Sprachbegabung. […]
Zurzeit ist Englisch (oder vielmehr „Denglisch“) angesagt. Man fährt „first class“, registriert den „sharholder value“, hat „emotions“ und geht zu einem „event“. Wie weit diese Sprachdeformation schon fortgeschritten ist, wird deutlich, wenn über der Einkaufsstraße einer deutschen Großstadt auf einem riesigen Schild „City Shopping“ steht, über einem Textilgeschäft in einer deutschen Kleinstadt „fashion for the young“, wenn der Treffpunkt am Bahnhof „Meeting Point“, die Auskunft „Service Point“, die Toilette „McClean“ heißt, der Flughafen „Airport“, das Ortsgespräch „City-Call” oder das Ferngespräch „German-Call“ usw. – „for a better understanding“.
Eine Empfehlung fürs „Business“:
Zwinge den Geschäftspartner, deine Sprache zu lernen, das kostet ihn Zeit und Energie und du wirst ihm überlegen sein, weil du deine Sprache immer besser sprechen wirst als er!
Verein Deutsche Sprache, Dortmund 1999.
„Bezeichnend, dass das Deutsche Zentrum an der ‚deutschen’ Tongji-Universität natürlich ‚German Centre for Industry and Trade’ heißt … Vertreter deutscher Unternehmen etwa waren es, die in der Fakultät vom Studium der Germanistik abgeraten hatten … Diese Zurückhaltung deutscher Firmen ist nicht nur kulturell bedenklich, sondern auch wirtschafts- und unternehmenspolitisch kurzsichtig …“
Horst Hensel , Sprachverfall und kulturelle Selbstaufgabe, 1999.
Nichts gegen Internationalismus, im Gegenteil. Aber es ist schon seltsam, wenn einerseits Regionalismus angesagt ist, Mundart, Brauchtum, Volksmusik und eine wie auch immer geartete „kulturelle Identität“, und andererseits die Warriors, Aliens, Lieutenants und Coroners in die Kinder- und Wohnzimmer kommen, in Shuttles, Enterprises, Supershows und Reality-TV; sie machen starwar, action, talk und sex für Singles, Kids, Daddy und Mom. Wer das kritisiert, braucht kein Deutschtümler oder Nationalist zu sein, zumal hinter dieser Entwicklung eine wahnsinnige Freizeit- und Unterhaltungsindustrie steht, die über jegliche Traditionen hinweggeht und die Gehirne verschmutzt, nicht nur in sprachlicher Hinsicht. Vielen ist offenbar nicht bewusst, dass der Verlust von Sprache den Verlust der eigenen kulturellen Identität nach sich zieht. Kein Antiamerikanismus, keine Abschottung gegen andere Lebenssphären, sondern eine Besinnung auch auf eigene kulturelle Werte.
Sprache ist auch Herrschaftsmittel. Sie hat Einfluss auf Gedanken, Einstellungen und Verhaltensweisen. Wir sollten uns die deutsche Sprache, die sehr reich, sehr vielfältig ist und auch schön sein kann, erhalten. In Kanada wurde bis vor wenigen Jahrzehnten Indianerkindern, die man dort zwangsweise in Internaten zusammenfasste, bei Strafe verboten, ihre Stammessprachen zu sprechen. Sie wurden sprachlos, denn sie beherrschten bald ihre Muttersprache nicht mehr, und Englisch lernten sie auch nie perfekt. Dadurch verloren sie ihre kulturellen Wurzeln und ihre Identität.
„Die Sprache ist der Spiegel einer Nation. Wenn wir in diesen Spiegel schauen, so kommt uns ein großes, treffliches Bild von selbst daraus entgegen.“
Friedrich von Schiller (1759-1805).
„Progressiv“ und „modern“ zu erscheinen heißt offenbar, sich seiner Identität zu schämen. Ein Blick in die Vergangenheit bestärkt uns in dem Eindruck, dass die Deutschen von einem Extrem ins andere fallen; sie neigen zur Selbstverleugnung, nach verlorenen Kriegen weniger zu Besinnung und Reue als vielmehr zu Verdrängung oder Masochismus in vielerlei Ausprägung. Das zeigt sich unter anderem im Sprachgebrauch. Jedenfalls wäre etwas mehr Sprachhygiene vonnöten, und Schriftsteller können dazu beitragen.
„Deutsch ist eine der musikalischsten Sprachen und kommt an Klangfülle der Orgel, ja dem vollen Orchester vielleicht am nächsten.“
Salvador de Madariaga y Rojo (1886-1978).
„Die Muttersprache kann zu allem übrigen sagen: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer mich verachtet, der wird wieder verachtet von seinem Zeitalter und schnell vergessen von der Nachwelt.“
Gottfried August Bürger (1747-1794).
Aus: Wolfgang Bittner, „Beruf: Schriftsteller. Was man wissen muss, wenn man vom Schreiben leben will“, Rowohlt 2002, Neuauflage: Allitera Verlag 2006
Leserbriefe zu diesem Beitrag finden Sie hier.
Titelbild: Wikipedia