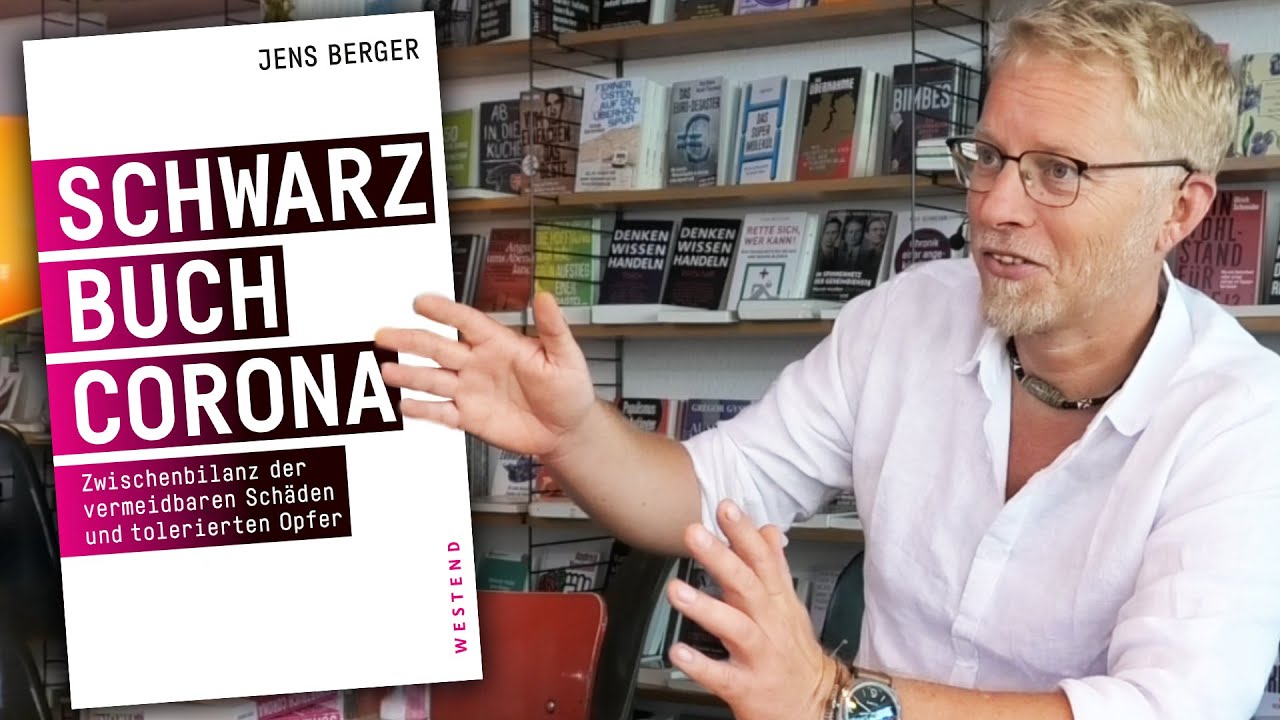In den alternativen Medien ist wohl kaum ein Thema ideologisch so vermint wie die Diskussion um das Geldsystem. Auf der einen Seite stehen Libertäre wie Markus Krall (Gold) und Marc Friedrich (Bitcoin), auf der anderen Seite Anhänger der Modern Monetary Theory (MMT) wie Maurice Höfgen. Dazwischen gibt es aber auch noch jemanden, der sich dem Thema relativ unaufgeregt nähert. Es ist der Frankfurter Finanzprofessor und Spieltheoretiker Christian Rieck, der vor allem durch seinen YouTube-Kanal mit über 500.000 Abonnenten bekannt ist. Rieck hat nun das Buch „Fürstengeld, Fiatgeld, Bitcoin – Wie Geld entsteht, einen Wert bekommt und wieder untergeht“ geschrieben und im hauseigenen Rieck-Verlag veröffentlicht. Eine Rezension von Thomas Trares.
Wie der Name bereits verrät, ist das Buch eine Reise durch die drei Geldformen Fürstengeld, Fiatgeld und Bitcoin. Während Fiatgeld das heutige Geldsystem repräsentiert, handelt es sich beim Fürstengeld um eine historische Geldform vornehmlich aus der Zeit des Feudalismus, bei der eine Obrigkeit ein bestimmtes Gut zu Geld erklärt. Die dritte in dem Buch besprochene Geldform ist allerdings nicht – wie der Titel unterstellt – der Bitcoin, sondern das Knappheitsgeld. Dessen Wesensmerkmal ist sein exogen begrenztes Geldangebot, der Bitcoin wie auch das Gold sind lediglich Beispiele dafür. Der gemeinsame Nenner all dieses Geldes ist, dass es auf Schuldbeziehungen basiert. „Fürstengeld, Fiatgeld, Knappheitsgeld. Sie alle sind Geld, und Geld ist Ausdruck der Struktur unseres Zusammenlebens. Geld bestimmt nicht nur, wie reich oder arm wir sind, sondern auch, in welchem Geflecht der Schuldbeziehungen wir leben“, schreibt Rieck. (S. 11)
Viele Missverständnisse rund um das Fiatgeld
Um es gleich vorwegzunehmen – das große Verdienst dieses Buches ist, dass Rieck das Fiatgeld und damit auch das aktuell gültige Geldsystem realistisch und unvoreingenommen darstellt. Ein großes Problem der Geldsystem-Debatte ist nämlich, dass gerade zum Fiatgeld Unmengen von Fehlinterpretationen, Mythen und Halbwahrheiten im Umlauf sind, die einer Richtigstellung bedürfen. Darauf weist Rieck gleich am Anfang des Buches hin: „Fiat! ist Latein und steht für ´Es werde!´ In der Kombination mit Fiatgeld ist es wahrscheinlich der meist missverstandene Satz der Geldtheorie.“ (S. 9) Und an anderer Stelle schreibt er: „Eines der verhängnisvollsten Missverständnisse über Fiatgeld besteht darin, dass es vermeintlich aus dem Nichts kommt und daher keinen Wert haben könne.“ (S. 113)
Das Fiatgeld entsteht prinzipiell durch die Kreditvergabe der Geschäftsbanken. Deswegen wird es auch als Kreditgeld bezeichnet. Die Bank prüft dabei die Bonität des Kreditnehmers, insofern ist das neu geschaffene Geld durch dessen wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gedeckt. Der Vorteil dabei: Das Geld ist endogen, es entsteht im Wirtschaftsprozess und passt sich flexibel an den Geldbedarf an. „Fiatgeld ist somit von den in diesem Buch behandelten Geldformen die einzige, die eine direkte Koppelung an die reale Wirtschaft vorweisen kann“, schreibt Rieck. (S. 112) Zudem sind Fiatgeldsysteme in der Regel zweistufig konstruiert. Das heißt, die Geldproduktion findet bei den Geschäftsbanken statt, die Zentralbank ist für die Gesamtsteuerung zuständig.
Qualität bei Fiatgeld entscheidend
Das Fiatgeld hat freilich auch gravierende Nachteile, die unter anderem in der Finanzkrise zu Tage traten. Es ist prozyklisch, das heißt, es verstärkt die Boom-and-Bust-Zyklen. Im Aufschwung sitzt das Geld bei den Banken relativ locker, im Abschwung knausern sie. Es kann dann zur Liquiditätsklemme, ja sogar zum Bank-Run kommen. Entscheidend beim Fiatgeld ist zudem die Qualität des Geldes, nicht die Quantität. „Das umlaufende Fiatgeld ist werthaltig, solange der emittierten Geldmenge ausreichende Vermögenswerte gegenüberstehen“, schreibt Rieck dazu. (S. 125) Genau diese Bedingung war aber in der Finanzkrise verletzt. Die Banken gingen zu hohe Risiken ein, vergaben zu viele Kredite, die nicht mit entsprechenden Vermögenswerten unterlegt waren, das System geriet ins Wanken.
Darüber hinaus ist das Fiatgeld auf ein funktionierendes Rechts- und Justizsystem angewiesen, das die Rechte der Bürger garantiert und durchsetzt. „Da Kreditgeld eine zukünftige Warenlieferung verbrieft, kann es seine Funktion nur erfüllen, wenn diese Lieferung auch erzwungen werden kann“, schreibt Rieck. (S. 53) Schwindet dagegen das Vertrauen in das Rechtssystem, dann wird das Fiatgeld zunehmend durch das Knappheitsgeld ersetzt. Dies dürfte nicht zuletzt auch das aktuell große Interesse von Regierungskritikern an staatsfernen Geldformen wie Bitcoin und Gold erklären. Beide sind Knappheitsgeld – beim Gold resultiert die Knappheit aus dem begrenzten Vorkommen, beim Bitcoin ist es die algorithmische Begrenzung.
Der Bitcoin und die Freiheitsrechte
Rieck schreibt dazu: „Ein Großteil des Erfolgs von Bitcoin beruht darauf, dass das Geldsystem in den letzten Jahrzehnten immer weiter Freiheitsrechte verloren hat, die es dem einzelnen Bürger einmal gewährt hatte. Geld auf reiner Goldbasis bot – trotz der damit verbundenen Nachteile – ein Maximum an Freiheit, weil dieses Geld völlig unabhängig von jeder Form der ´Obrigkeit´ existieren konnte. Nach dem Umstieg auf Buchgeld gab es lange Zeit das Bankgeheimnis, das einen Teil dieser Freiheit bewahrt hat. Als dieses abgeschafft wurde, gab es noch die Möglichkeit, Geschäfte in Bargeld abzuwickeln. Aber auch diese Möglichkeit wird zunehmend eingeschränkt, was ein weiterer Schritt auf dem Weg zur völligen Kontrolle des einzelnen Bürgers ist.“ (S. 209 f.)
Darüber hinaus greift Rieck noch einige interessante Einzelthemen auf. So gibt es eine Analyse der Inflationsentwicklung seit 1750 oder auch einen Abschnitt zum digitalen Euro, den er für eine der „gefährlichsten“ Geldformen überhaupt hält. Außerdem diskutiert Rieck die Gültigkeit der Quantitätstheorie des Geldes. Diese nutzen Monetaristen gerne, um einen Zusammenhang zwischen steigender Geldmenge und einem steigenden Preisniveau herzustellen. Rieck dagegen vertritt die Auffassung, dass dieser Zusammenhang gerade beim Fiatgeld nicht besteht. Er schreibt. „Aber das hilft nicht viel, denn in unserem Fiatgeld-System ist die Geldmenge nicht exogen gegeben, sondern sie bildet sich endogen. Die Quantitätsgleichung ist deshalb eine sowohl empirisch als auch theoretisch unzutreffende Beschreibung.“ (S. 167)
Die „Unterdrückungsmaschinerie“ MMT
Eine ganz besonders starke Abneigung hegt Rieck aber offenbar gegenüber der MMT, der er wohl aus diesem Grund gleich ein ganzes Kapitel widmet. Bei der MMT handelt es sich um eine postkeynesianische Denkschule, die davon ausgeht, dass der Staat in der eigenen Währung nicht pleitegehen und er deswegen so viel Geld aufnehmen kann, wie nötig ist, um Vollbeschäftigung oder andere Ziele zu erreichen. Freilich ist diese Sichtweise umstritten, doch was Rieck über die MMT schreibt, ist bisweilen richtig starker Tobak. So bezeichnet er sie mal als eine Denkrichtung, die „unser bisheriges Geldsystem abschaffen will und wieder Fürstengeld ohne Selbstbindung einführen will“. (S. 171) Dann ist sie eine „Unterdrückungsmaschinerie, die darauf ausgerichtet ist, die Untertanen auszubeuten“. (S. 174) Und weiter meint er: „Worauf die MMT hinausläuft, ist die Einführung eines sozialistischen Systems hinter der Verkleidung einer vermeintlich neuartigen Theorie rund ums Geld, die aber lediglich eine ablenkende Cover-Story darstellt.“ (S. 192)
Damit ist auch klar, dass Riecks Buch nicht jedem Leser gefallen wird. Sowohl bei der MMT als auch bei den Bitcoinern sind seine Thesen schon in der Vergangenheit auf heftigen Widerspruch gestoßen – siehe hier und hier. Klar ist aber auch, dass man es in der Geldsystem-Debatte ohnehin nicht allen recht machen kann. Vor diesem Hintergrund eignet sich Riecks neues Buch auf jeden Fall zur Grundlagendiskussion rund um das Geldsystem, und wer es gelesen hat, der wird zumindest beim Verständnis ebenjenes Geldsystems, das wirklich ein komplexes und vielschichtiges Gebilde ist, einen guten Schritt vorangekommen sein.
Christian Rieck: Fürstengeld, Fiatgeld, Bitcoin: Wie Geld entsteht, einen Wert bekommt und wieder untergeht. Eschborn 2025, Rieck Verlag GmbH, Taschenbuch, 220 Seiten, ISBN 978-3924043971, 18 Euro