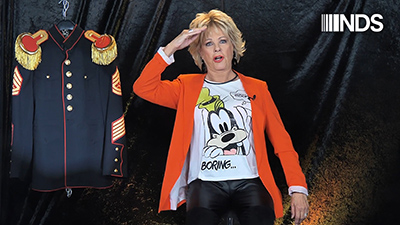Können sich Volkswirtschaften aus der Krise sparen?
Wir kennen alle die Propaganda von Gesundsparen in Politik und Medien, die allerdings meist wenig konkret ist. Seitens der Wissenschaft wird allgemein eingeräumt, dass Austeritätsprogramme negative Folgen für Wachstum und Beschäftigung haben – allerdings nur in der sehr kurzen Frist. Angestoßen durch einen Beitrag in der Neuen Züricher Zeitung “Wie Schweden sich aus der Krise sparte” untersucht Orlando Pascheit die Argumentation von prominenten Vertretern die für ein „Heraussparen aus der Krise“ plädieren.
Wir kennen alle die Propaganda von Gesundsparen in Politik und Medien, die allerdings meist wenig konkret ist. Seitens der Wissenschaft wird allgemein eingeräumt, dass Austeritätsprogramme negative Folgen für Wachstum und Beschäftigung haben – allerdings nur in der sehr kurzen Frist. In einem Artikel der WirtschaftsWoche mit dem Titel „Die Mär vom Kaputtsparen“ resümiert OECD-Ökonom Eckhard Wurzel: „Alles in allem mangelt es also nicht an Sparstrategien, die Wachstum und Beschäftigung nicht behindern oder gar fördern – wenn dies auch nicht gleich im ersten Jahr sichtbar sein mag.“
Auf den zentralen Mechanismus dabei verwies der spätere EZB-Chefökonom Jürgen Stark 2003 in der Welt: „Spart der Staat bei den Ausgaben, um den Haushalt zu konsolidieren, sind durch den Gewinn an Glaubwürdigkeit schon nach kurzer Zeit positive Wachstumseffekte zu erwarten”. Auch Harvard-Ökonom Alberto Alesina kommt in seinen Untersuchungen zum Ergebnis, dass sich Volkswirtschaften manchmal, tatsächlich sogar oft, gut entwickeln würden, selbst wenn das staatliche Defizit rigoros reduziert würde. Das Sparprogramm könne das Vertrauen auf eine Weise steigern, dass dadurch eine Konjunkturerholung ausgelöst würde. Ein nachhaltiger Sparkurs würde angesichts der hohen Schuldenlast die Furcht vor Steuererhöhungen nehmen und die Privaten würden wieder zu investieren beginnen. Hierzu ist auch ein Vortrag von Alesina beim BMF (!) anzuschauen bzw. anzuhören.
Interessant ist, dass Alesina Mitte 2011 in Unkenntnis der späteren Entwicklung von Erfolgen beim griechischen Defizitabbau spricht. Fast witzig ist, dass in Alesinas Vortrag die These einen breiten Raum einnahm, dass Regierungen trotz Konsolidierungskurs keine Abwahl zu fürchten hätten. Unter den Ländern, welche sich durch Sparprogramme erfolgreich entwickelten, nennt der Wissenschaftler auch Schweden. Es stand fast zu erwarten, dass auch die ausgesprochen wirtschaftsliberale NZZ irgendwann ein Beispiel für das Heraussparen aus Krise hervorholen würde. Bei Schweden wurde sie dankenswerterweise fündig. Unter dem Titel „Wie Schweden sich aus der Krise sparte“ schreibt die NZZ: „1993 stand Schweden vor dem Kollaps. Die Genesung des nordischen Landes führte unter anderem über ein grosses Sparprogramm und die Einführung strenger Budgetregeln, deren Säulen ein Ausgabenlimit sowie ein Überschussziel sind.“
Nur liegen die Dinge nicht so einfach, wie dann schon der Untertitel mit dem Ausdruck “unter anderem” zwar angedeutet, aber von Ingrid Meissl Årebo nicht konsequent zu Ende gedacht wird. Niemand leugnet, dass in Schweden ein beachtliches Sparprogramm umgesetzt wurde, allerdings sind einige gravierende Vorbehalte anzumelden, was die Wachstumsursachen und die Übertragbarkeit des schwedischen Modells betrifft. Wenn man den Artikel aufmerksam liest, wird man zunächst feststellen, dass die Schweden intelligent gespart haben. Von vornherein war klar, dass lineare Kürzungen suboptimal gewesen wären (sozusagen ein umgekehrtes Gießkannenprinzip), d.h. einzelne Ausgabenkategorien wurden sehr unterschiedlich behandelt, vor allem aber wurde auch die Einnahmeseite des Staates gestärkt. Lohnsenkungen, wie sie die Troika Staaten wie Griechenland, Portugal, Spanien und Italien aufzwingen möchte, wären für Schweden undenkbar gewesen. Selbst ein wirtschaftsliberaler Ökonom wie Allan Meltzer beweist hier mehr Realitätssinn als Europa: “Wir reden hier von Lohnkürzungen von 20 bis 30 Prozent. Das entspricht etwa dem, was während der Großen Depression geschehen ist – und das zusätzlich zur Wachstumsschwäche der letzten Jahre. … Manche Beobachter hier in den USA glauben, dass es zu sozialen Unruhen kommen kann, dass Regierungen stürzen, ja dass es an manchen Orten Revolutionen geben wird.”
Es soll nicht verschwiegen werden, dass die Ziele der schwedischen Finanzpolitik z.T. weit über Maastricht hinausgehen, wenn z.B. ein Haushaltsüberschusses von einem Prozent vom BIP angestrebt wird. Aber auch hier setzt Schweden Zeichen einer intelligenten Fiskalpolitik, indem dieses Ziel nicht für ein einzelnes Jahr, sondern für den Zeitraum eines Konjunkturzyklus gilt. Defizite sind also möglich. Die Kommunen sollen einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren. Nur was passiert, wenn eine Gemeinde ein entstandenes Defizit nicht innerhalb von den vorgeschlagenen drei Jahren nicht korrigieren kann? Es erfolgt keine Sanktion. Es gibt keine formale Möglichkeit diese Politik mit automatischen Sanktionen durchzusetzen – ganz im Gegensatz zur deutschen Schuldenbremse und zu dem, was im europäischen Fiskalpakt vorgesehen ist. Dennoch wurden diese neuen Regeln im Großen und Ganzen eingehalten. Der bedeutenden Schwedische Ökonom Lars Calmfors schrieb dazu: “Schwedens fiskalische Entwicklung legt nahe, dass Transparenz und eine auf hohem Niveau geführte Debatte über die Wirtschaftspolitik für die Haushaltsdisziplin möglicherweise bedeutender sind als formal bindende Vorschriften.” Bereits hier werden aber auch die Grenzen des schwedischen Modells deutlich. Die breite Akzeptanz solcher Regeln ist einem Europa mit ganz disparaten Traditionen allein im Steuerwesen nicht vorstellbar. Zu unterschiedlich ist aber auch die jeweilige Ausgangslage von Einkommen, sozialer Absicherung oder Ausbildung. Wenn z.B. im Artikel der NZZ auf den Umbau des Rentensystems hingewiesen wird, so muss man wissen, dass im heutigen Schweden den Rentnern immer noch ein größerer Anteil des Bruttoinlandsprodukts zugutekommt als in jedem anderen Land der Welt.
Kommen wir zu dem oben genannten ” unter anderen”. Ganz am Ende des Artikels steht, kurz und knapp: “Die Budgetsanierung war jedoch nur ein Pfeiler der erfolgreichen Überwindung der schwedischen Krise. Die massive Kronenabwertung verlieh der Exportindustrie Flügel, die auch vom allgemeinen Aufschwung der wichtigsten Handelspartner profitierte.” In einer IWF-Studie haben Guajardo, Leigh und Pescatori in Kenntnis älterer Literatur zu diesem Thema eine eindeutige Tendenz nachgewiesen, wonach Sparprogramme die Konsumausgaben verringerten und die Wirtschaft schwächten. Im Grunde wären die Folgen geradezu katastrophal gewesen, wenn Wirtschaftseinbruch und Konsolidierungspolitik nicht dazu geführt hätten, dass die heimische Währungen an den Finanzmärkten abgewertet wurden und dadurch die Exporte des “sparenden” Landes befördert wurden. Dies deckt sich mit einer Untersuchung von Roberto Perotti, der 1997 noch zu dem Schluss gekommen war, dass Haushaltskonsolidierung Wirtschaftswachstum befördern könne, aber 2011 in seiner Arbeit “The Austerity Myth: Gain Without Pain?” [PDF – 1 MB] zwar Beispiele für Länder liefert, die nach einer Konsolidierung einen kurzfristigen Wirtschaftsaufschwung erlebt hatten, er aber auch zu der Erkenntnis kommt, dass dieser Aufschwung mit einer starken Abwertung der Landeswährung einherging, die den Export ankurbelte. Meines Erachtens liegt hier der entscheidende Schwachpunk in der Argumentation Alesinas, auch wenn er einräumt, dass die Folgen eines Sparkurses sehr unübersichtlich seien. Schlussendlich lassen wir den Schweden Calmfors sprechen:
“In Schweden wurde die Haushaltskonsolidierung in den 1990er Jahren von einem hohem Outputwachstum begleitet – ein Umstand, welcher als Beispiel für die expansive Wirkung einer kontraktiven Fiskalpolitik zitiert wurde (Giavazzi und Pagano 1996). Dies ist ein falscher Rückschluss (Fiscal Policy Council 2011), da die schwedische Wirtschaft aufgrund einer starken Abwertung des realen Wechselkurses wuchs: Von 1991 bis 1993 fielen die relativen Lohnstückkosten um 20 Prozent, was größtenteils einer nominalen Abwertung des Wechselkurses geschuldet war. Die Folge war ein Anstieg der Nettoexporte (siehe Abbildung 1). Die dadurch entstandenen stimulierenden Effekte, Zweitrunden-Multiplikatoreffekte eingeschlossen, erlaubten ein Wachstum der aggregierten Nachfrage zwischen 1994 und 2000 trotz der Haushaltskonsolidierung.”
Dieses “trotz der Haushaltskonsolidierung” sagt eigentlich alles und befördert alle, die da meinen, Sparpolitik befördere Wirtschaftswachstum, in das Aus – erst recht innerhalb einer Währungsunion. Da können Griechenland, Spanien oder Portugal in eine Rezession fallen und sparen ohne Ende, eine Abwertung und daraufhin steigende Exporten sind per definitionem in der Eurozone nicht möglich, worauf auch der oben genannte Perotti hinweist.
Hinzukommt, dass Länder wie Griechenland oder Spanien z.B. im Verhältnis zu Schweden kaum mit einer wettbewerbsfähigen Industrie ausgestattet sind, was sich u.a. an der Exportquote (Exporte als Anteil am BIP) ablesen lässt. Die Exportquoten im Warenhandel lagen 2011 für Griechenland bei 11, 5 Prozent, für Spanien bei 20,4 Prozent und für Schweden bei 35,5 Prozent. Wer sich über die schwache industrielle Basis Griechenlands genauer informieren möchte, kann sich bei der UNIDO informieren.
So hatte beispielsweise Schwedens Wertschöpfung in der verarbeitenden Industrie (Manufacturing Value Added) einen EU-Anteil von 3,2 Prozent im Jahre 2000, von 3,9 Prozent im Jahre 2005 und von 4,2 Prozent im Jahre 2010, während Griechenland 2000 auf 0,8 Prozent, 2005 auf 0,9 Prozent und 2010 auf 1 Prozent kam. Portugal hat sich im selben Zeitraum von 1,2 Prozent auf 1,1 Prozent verschlechtert. Das weitaus größere Spanien sank von 6,6 Prozent (2000) auf 5,9 Prozent (2010). Ähnlich sieht es aus, wenn man beispielsweise die Wertschöpfung pro Beschäftigten in den einzelnen Branchen ansieht. Über die UNIDO-Statistik lassen sich sogar die Lohnstückkosten in einzelnen Branchen berechnen. Selbst dort wo die Wertschöpfung hoch und die Lohnstückkosten niedrig sind, ist zu beachten, wie groß der Anteil der verarbeitenden Industrie (Anteil am BIP) in einem Land ist: Griechenland: 9 Prozent, Portugal: 13 Prozent, Spanien: 12 Prozent, Schweden: 20 Prozent. – Für Länder wie Griechenland, Portugal oder Spanien, die ihre externen Schulden über Exporteinnahmen bedienen sollen, bedarf es, ob nun in der Währungsunion oder außerhalb, einer Verbreiterung der industriellen Basis, welche allerdings nicht in der kurzen Frist herzustellen ist. Konjunkturprogramme bringen hier wenig, gefragt sind, auch vonseiten der europäischen Union, Investitionsprogramme z.B. für den jeweiligen Mittelstand – das geht nicht ohne Geld, wie uns die Rede von den sogenannten „Strukturreformen“ weismachen will [PDF – 50 KB].
D.h. aber letztlich, dass diese Länder an ein Tabu des marktgläubigen, europäischen Binnenmarktprojekts rühren müssen, indem sie Industriepolitik betreiben, indem sie öffentliche Mittel einsetzen, um bestimmte Wirtschaftszweige zu fördern oder nationale Industrien zu schützen. Es genügt eben nicht, dass wir nun alle Feta und Olivenöl kaufen. – Natürlich hat das Exportkapital Kerneuropas nur wenig Interesse daran, dass die europäische Peripherie industriell aufrüstet und sich zur Konkurrenz entwickelt. Da ist es doch viel schöner, wenn der europäische Steuerzahler Transfers in diese Länder finanziert und das Kapital diese über seine Exporte wieder abschöpft.