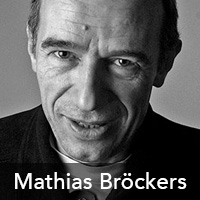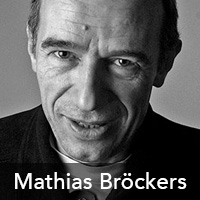
Im September 1996 ergab eine telefonische Umfrage unter 800 erwachsenen Amerikanern, dass 74 Prozent – also drei von vier Bürgern – glaubten, die US-Regierung sei regelmäßig in geheime und verschwörerische Aktivitäten verstrickt. Dass diese Leute nicht alle einfach „Verrückte“ oder „Spinner“ sind, davon zeugt ein weiteres Studienergebnis. Denn „lediglich“ 29 Prozent der Befragten glaubten an Hexerei und „nur“ 10 Prozent waren der Meinung, Elvis Presley weile noch unter den Lebenden. Wenn nun aber drei Viertel der Bürger – und das ist eine Mehrheit, die kaum je eine Regierung hinter sich wusste – die eigene Regierung verbrecherischer und ruchloser Aktivitäten verdächtigen, dann bedeutet das, dass inzwischen ganz normale Leute glauben, was vor hundert Jahren etwa, in den 1890ern, lediglich erbitterte Linksradikale behaupteten: „Da oben stimmt etwas ganz und gar nicht!“. Das blinde Vertrauen in die weise und gerechte Herrschaft der Oberen erodiert, das Misstrauen der Unteren wächst und Theorien über finstere Machenschaften und Verschwörungen haben Hochkonjunktur. Doch wie ticken „Verschwörungstheoretiker“ und was genau sind „Verschwörungstheorien“? Und ist es wirklich angebracht, Verschwörungstheoretiker – weil ja vermeintlich irre und wirr im Kopf – stets umgehend mit Diskursverboten zu belegen und also aus öffentlichen Debatten auszuschließen? Zu diesen Fragen sprach Jens Wernicke mit dem Autor und Publizisten Mathias Bröckers, dank dessen Engagements soeben das „Lexikon der Verschwörungstheorien“ in einer Neuauflage erschien, und der, wie zuvor bereits Friedensforscher Daniele Ganser, darauf insistiert, dass das Stigma „Verschwörungstheoretiker“ bereits seit Jahrzehnten von den Mächtigen dazu genutzt wird, um notwendige und berechtigte Kritik zum Schweigen zu bringen.