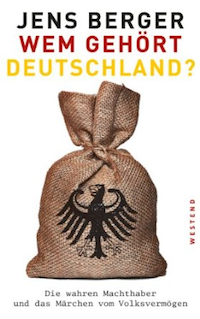Schöner manipulieren mit dem Allianz Global Wealth Report
Wussten Sie schon, dass Sie – ja „Sie!“ – einen Zinsverlust von 280 Euro erlitten haben? Und dass daran die EZB schuld ist? Das schreibt zumindest SPIEGEL Online und die müssen es ja wissen. SPIEGEL Online weiß auch, dass die Mittelschicht wächst, die Zahl der Reichen sinkt und damit alle Vorurteile widerlegt seien. Die WELT weiß noch mehr. Sie weiß beispielsweise, dass „deutsche Sparer Europas Krisenstaaten aufpäppeln“ und dass „wir“ – ja auch „Sie“! – die „Nullzins-Verlierer“ sind. Am meisten weiß jedoch die FAZ. Sie weiß, das „die Deutschen“ – also auch „Sie“! – „selbst schuld am Vermögensverlust“ sind, weil sie mit ihrem Geld nicht an der Börse spekulieren. Bei so viel gesammeltem Wissen in unseren Qualitätszeitungen sollten wir von den NachDenkSeiten eigentlich ehrfürchtig schweigen. Tun wir aber nicht. Von Jens Berger.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.