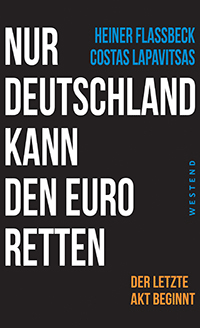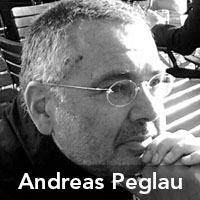Rezension: Sehnsucht nach einer friedlicheren Welt – Konstantin Wecker über sein Leben
Über sich zu schreiben, ist ein schwieriges Unterfangen. Konstantin Wecker hat es gewagt, und es ist ihm in vielen Passagen seines Buches „Mönch und Krieger“ gelungen, seine Leserinnen und Leser für sich zu gewinnen, indem er über die unvermeidliche Selbstbespiegelung weit hinausgeht. Er verschweigt nichts, er blendet nicht, er bleibt bei den Fakten, die er natürlich subjektiv interpretiert. Das Herzstück seines Buches sei – so schreibt er – sein „lebenslanges Suchen nach dem Wunderbaren, die Suche nach der Rückkehr in meine geistige Heimat“, auch „wachsender Zorn über die politischen Verhältnisse“. Von Wolfgang Bittner[*].