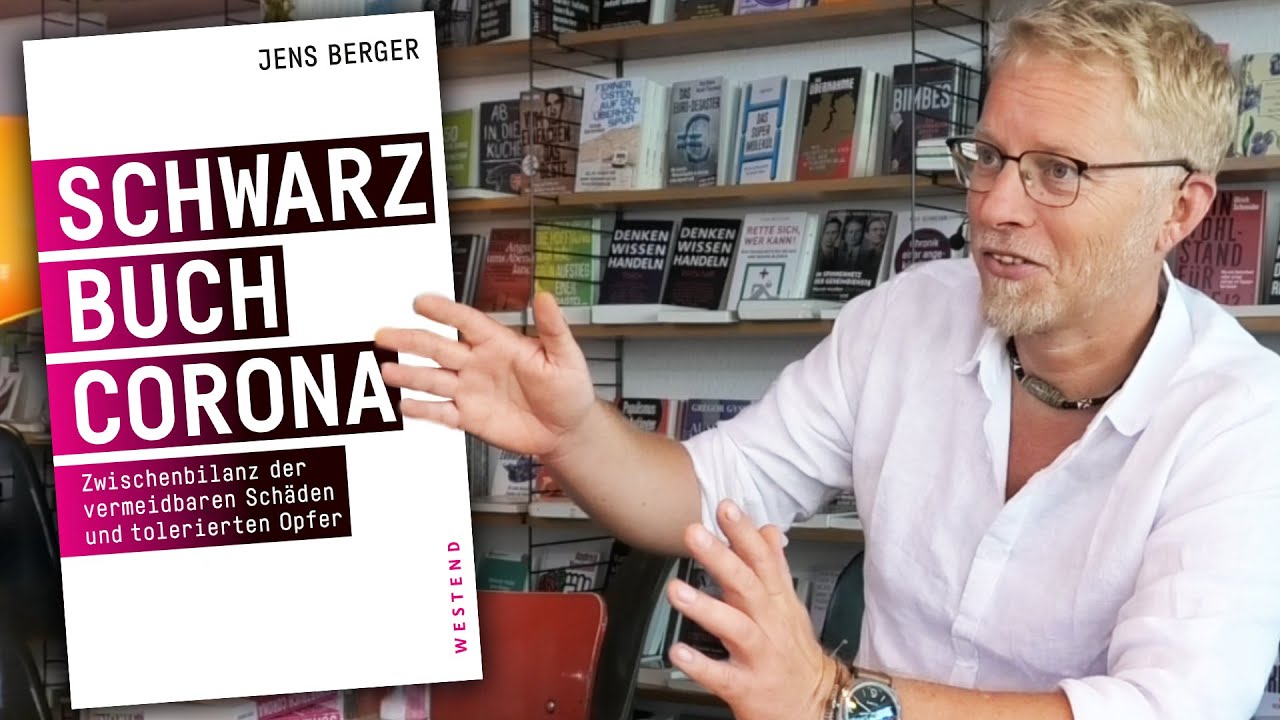Es ist Nacht in einer Lagerhalle irgendwo in Oregon. Zwischen Paletten und Förderbändern steht eine Maschine, die aussieht wie ein Mensch. Zwei Beine, zwei Arme, ein Torso. Sie hebt Kisten, scannt Barcodes, dreht sich, läuft. Keiner schaut hin. Keiner muss ihr erklären, was sie tut. Ein anderer Roboter des gleichen Typs hat die Aufgabe am Vortag gelernt. Heute können es alle. Ein Software-Update genügt. Dieser Augenblick wirkt banal. Und doch erzählt er eine Geschichte, die größer ist, als wir ahnen – sie handelt von vernichteten Jobs und von Privatarmeen aus Metall. Von Günther Burbach.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Diese Geschichte spielt nicht in ferner Zukunft, sondern sie beginnt jetzt: Die Geschichte davon, wie Maschinen in unseren Alltag treten, in Fabriken, Pflegeheime, Restaurants, vielleicht bald auch in den öffentlichen Raum. Maschinen, die nicht nur schneller und präziser sind als wir, sondern auch miteinander vernetzt, lernfähig und massenhaft verfügbar.
Wir alle kennen die Figur „Lt. Commander Data“ aus der Science-Fiktion-Serie Star Trek. Ein freundlicher Android, stark und klug, aber stets bemüht, menschlicher zu werden. Die Roboter, die heute in Fabriken und Laboren entstehen, sind anders. Sie sind nicht freundlich, nicht neugierig, nicht moralisch. Sie sind Werkzeuge. Und Werkzeuge lassen sich nicht nur zum Helfen nutzen.
Die unscheinbare Gegenwart
Noch lacht man über sie: die hölzern wirkenden Gestalten auf Messen, die stolpern, hinfallen oder steif Arme schwingen. Doch die Realität ist ernster.
In den USA testet Agility Robotics seinen Roboter Digit bereits in Lagerhallen von Amazon. Zwei Beine, zwei Arme, ein Kopf mit Kameras, er kann Kisten stapeln, durch Gänge laufen, einfache Greifaufgaben erledigen. Noch wirkt das unbeholfen. Doch Amazon hat gezeigt, was es bedeutet, wenn Technik erst einmal in Lieferketten integriert wird: Innerhalb weniger Jahre kann sie Milliarden Menschen erreichen.
Das Start-up Figure AI hat mit dem Modell Figure-02 einen humanoiden Roboter entwickelt, der nicht nur gehen und greifen, sondern auch Werkzeuge bedienen und Sprache verstehen soll. BMW testet die Geräte in der Produktion. Elon Musk wiederum kündigt an, seinen Tesla-Roboter Optimus ab Ende 2025 in den eigenen Fabriken einzusetzen. Und in Polen sorgt Clone Alpha für Aufsehen: ein Roboter mit künstlichen Muskeln, die sich wie menschliches Gewebe bewegen, durchzogen von Flüssigkeiten, die Adern imitieren. Ein Maschinenkörper, der zum ersten Mal wirklich organisch wirkt.
Noch sind diese Prototypen teuer, begrenzt, fehlerhaft. Aber die Richtung ist klar.
Der Preissturz – Roboter werden zur Massenware
Wer glaubt, dass humanoide Roboter noch Jahrzehnte entfernt sind, sollte nach China schauen. Dort verkauft die Firma Unitree ihren humanoiden Roboter G1 bereits für rund 16.000 Dollar. Ein kleineres Modell, der R1, kostet sogar nur etwa 6.000 Dollar. Das ist weniger als ein Kleinwagen.
Noch sind es Forschungsgeräte, gedacht für Universitäten und Labore. Doch die Stückpreise zeigen, wohin die Reise geht. Was heute Experiment ist, wird morgen Massenware.
Die chinesische Regierung hat klare Ziele gesetzt: Masseneinsatz humanoider Roboter bis 2025, Weltspitze bis 2027. In Shanghai gibt es bereits Richtlinien, die den Einsatz regeln, nicht um zu bremsen, sondern um den Rollout zu beschleunigen. Und die staatlichen Beschaffungen steigen rasant: von einigen Millionen Yuan 2023 auf über 200 Millionen Yuan im Jahr 2024. Wenn ein Land mit dieser Entschlossenheit in den Markt drückt, können westliche Firmen kaum tatenlos zusehen.
Roboter wie Smartphones
Wir haben das Muster schon erlebt. Ein neues Gerät erscheint, erst teuer, dann billiger, dann allgegenwärtig. Beim Smartphone dauerte es zehn Jahre. Bei humanoiden Robotern könnte es schneller gehen, weil die Produktionsketten längst existieren: Batterien, Motoren, Kameras, Sensoren. Alles kommt aus derselben Industrie, die schon Elektroautos und Smartphones billig macht.
Die Schwelle ist klar: Sobald humanoide Roboter weniger kosten als ein Jahresgehalt, kippt das Spiel. Dann stehen nicht mehr Hunderte oder Tausende Maschinen in Laboren, sondern Hunderttausende in Fabriken, Hotels, Pflegeheimen und irgendwann auch in unseren Straßen.
Schwarmintelligenz – wenn einer lernt, lernen alle
Die eigentliche Revolution liegt nicht im Metallkörper, sondern in der Software. Neue Modelle wie Helix von Figure AI oder GR00T N1 von Nvidia verbinden Sehen, Sprache und Bewegung in einem System. Das bedeutet: Ein Roboter kann per Sprachbefehl angewiesen werden, eine Maschine zu bedienen und lernt dabei nicht nur für sich, sondern für alle baugleichen Systeme.
Ein Beispiel: Ein Roboter in Shenzhen lernt, mit einer Pressluftanlage umzugehen. Minuten später kann ein baugleiches Gerät in Texas dasselbe. Wissen wird nicht mehr über Schulungen weitergegeben, sondern über Software-Updates.
Das klingt nach Effizienz. Aber es bedeutet auch: Fehler oder Manipulationen verbreiten sich ebenso schnell. Ein Hackerangriff, ein Software-Bug und plötzlich reagieren tausende Roboter gleichzeitig falsch.
Militärische Versuchung
Kein Soldat, der zweifelt. Kein Hunger, kein Schlaf, kein Gewissen. Für Generäle klingt das wie ein Traum: Maschinen, die Befehle ausführen, ohne zu zögern, ohne Fragen, ohne Grenzen. Schon heute wird in den USA, China, Russland und Israel daran geforscht, humanoide Roboter für militärische Einsätze tauglich zu machen. Häuserkampf in engen Gassen, Stürmung von Gebäuden, Sicherung kritischer Infrastruktur, überall dort, wo Menschen verwundbar sind, könnten Roboter die „effizientere“ Lösung sein.
Das Gefährlichste daran: Militärische Technologien bleiben nie auf dem Schlachtfeld. Sie finden immer ihren Weg zurück in die Gesellschaft. Drohnen begannen als hochgeheime Aufklärungsgeräte der US-Armee. Heute kann jeder Teenager im Elektronikmarkt ein Fluggerät kaufen, das Luftbilder in HD liefert, während gleichzeitig dieselbe Technologie in der Ukraine und im Gazastreifen als tödliche Standardwaffe eingesetzt wird.
Wer glaubt, humanoide Kampfroboter blieben auf Gefechtsfeldern, macht sich etwas vor. Sie werden eines Tages dort auftauchen, wo wir es am wenigsten wollen: auf Straßen, auf Plätzen, vielleicht vor Demonstrationen. Dann stehen uns keine Polizisten mehr gegenüber, die müde werden, die zweifeln oder sich weigern könnten, Befehle auszuführen. Sondern Maschinen, stark, schnell, vernetzt und emotionslos.
Das ist die eigentliche Dystopie: Nicht der ferne Krieg, sondern der Moment, in dem die Kriegsmaschine heimkehrt und zu einem Werkzeug der inneren Kontrolle wird.
Drei Szenarien, die uns das Blut gefrieren lassen
Szenario 1: Der stille Putsch der Arbeit. Ein Handelskonzern ersetzt schrittweise Nachtschichten durch humanoide Roboter. Anfangs nur ein Test, dann ein Pilot, dann Routine. Innerhalb von zwei Jahren sind ganze Abteilungen verschwunden. Kein Knall, kein Aufstand, nur das stille Verschwinden von Arbeitsplätzen.
Szenario 2: Das Update-Desaster. Ein fehlerhaftes Sicherheitsupdate rollt weltweit aus. Innerhalb weniger Minuten verhalten sich Roboter in Fabriken seltsam: Sie setzen Kisten falsch ab, blockieren Laufbänder, stoßen Geräte um. Nichts davon ist absichtlich, doch der Schaden geht in Milliarden. Alles nur, weil eine Zeile Code falsch war.
Szenario 3: Die Privatarmee aus Metall. Ein Sicherheitsdienst stattet Einkaufszentren mit humanoiden Robotern aus. Sie patrouillieren, beobachten, filmen. Was als „Schutz“ beginnt, kippt, als Hacker die Systeme übernehmen. Plötzlich reagieren die Roboter nicht mehr auf ihre Besitzer, sondern auf fremde Befehle. Was heute Drohnen im Krieg sind, könnten morgen humanoide Roboter im Alltag sein.
Der Kontrollverlust
Wir sollten uns nichts vormachen: Ein humanoider Roboter ist am Ende ein Computer mit Armen und Beinen. Und jeder Computer kann gehackt werden. Sicherheitsexperten wie Sandro Gaycken warnen seit Jahren: „Alles, was vernetzt ist, kann übernommen werden.“
Stellen wir uns vor: Ein Hack in die Cloud-Infrastruktur eines großen Herstellers. Innerhalb von Minuten reagieren tausende Roboter weltweit auf fremde Befehle. Nicht mehr auf ihre Besitzer, nicht mehr auf ihre Firmen, sondern auf Unbekannte. Das ist keine Science-Fiction. Das ist eine logische Konsequenz, wenn man lernfähige, vernetzte Maschinen massenhaft in Umlauf bringt.
Gesellschaftliche Folgen
Noch reden wir über Fabriken und Lagerhallen. Doch schon jetzt sehen wir: In Pflegeheimen werden Roboter getestet, in Hotels servieren sie, in Restaurants liefern sie Essen.
Wenn humanoide Roboter in den Alltag treten, verschiebt sich die soziale Ordnung. Arbeit wird nicht verschwinden, aber sie wird sich verändern. Millionen Jobs stehen auf der Kippe. Und die entscheidende Frage lautet: Wer zahlt die Menschen, die nicht mehr gebraucht werden? Die Firmen, die die Roboter einsetzen? Oder die Gesellschaft?
Von Data zur Dystopie
Wir alle hätten gern einen Roboter wie „Lt. Commander Data“ aus Star Trek. Freundlich, loyal, moralisch. Doch die Realität ist eine andere.
Wir bauen keine Datas. Wir bauen Werkzeuge. Und Werkzeuge werden so eingesetzt, wie Macht es verlangt. Wenn Staaten sie in Polizeieinsätzen nutzen, kippt das Verhältnis zwischen Bürger und Ordnung. Wenn Konzerne sie in Hotels und Fabriken einsetzen, kippt das Verhältnis zwischen Arbeit und Einkommen. Und wenn Hacker sie übernehmen, kippt das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine.
Die Frage ist nicht mehr, ob diese Maschinen kommen. Sie sind schon da.
Die Frage ist: Wer kontrolliert sie und was passiert, wenn niemand es mehr tut?
Titelbild: Ole.CNX / Shutterstock
Quellen:
- Business Insider, Agility Robotics’ humanoid Digit is entering warehouses, 29.11.2024.
- New York Post, China’s newest humanoid robot is ready to serve like never before, 11.01.2025.
- The Sun, Clone Alpha humanoid robot with synthetic organs coming 2025, 06.01.2025.
- Heise, „Humanoider Roboter Unitree G1 kostet 16.000 Dollar“, 16.05.2024.
- Robotikverband.de, „Humanoide Roboter – Zwischen Vision und Realität“, 13.05.2025. (deutscher Überblick, inklusive Xiaomi CyberOne, NEURA 4NE-1)
- Deutschlandfunk, „Weltweit erster Sportwettbewerb für humanoide Roboter in Peking“, 15.08.2025.