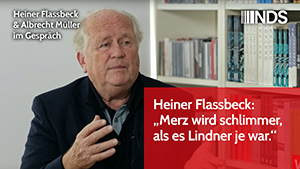Der Alarmismus vor der Weltklimakonferenz (COP30) im brasilianischen Belém war mal wieder groß. UN-Generalsekretär António Guterres sah bei seiner Eröffnungsrede die Weltgemeinschaft beim Erreichen des 1,5-Grad-Ziels gescheitert und sprach von einem „moralischen Versagen und tödlicher Fahrlässigkeit“. Brasiliens Präsident Lula warnte: Das „Zeitfenster zum Handeln“ schließt sich. Und die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) gab zu Bedenken, dass das Jahr 2025 voraussichtlich das zweit- oder drittheißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen wird. Für den wahren Aufreger sorgte jedoch jemand, der gar nicht bei COP30 zugegen ist. Die Rede ist von Microsoft-Gründer Bill Gates, der einmal der reichste Mann der Welt war und sich seit einiger Zeit auch gerne als Philanthrop geriert. Von Thomas Trares.
„Die Menschheit wird auch in Zukunft auf den meisten Teilen der Erde leben und gedeihen können“, schrieb Gates in dem Essay „Drei harte Wahrheiten übers Klima“, das er kürzlich auf seiner Website „gatesnotes.com“ veröffentlichte . Den Klimawandel bezeichnete er darin als ein ernsthaftes Problem, aber kein Untergangsszenario.
Bankenbündnis löst sich auf
So überraschend diese Sätze für viele auch kamen, so wenig sind sie es tatsächlich. Denn Gates setzt hier keinen neuen Trend, sondern springt auf einen auf, der schon längst Fahrt aufgenommen hat. Dafür steht unter anderem das Schicksal der Net Zero Banking Alliance (NZBA), die Anfang Oktober de facto ihr Ende erklärt hat. Bei der NZBA handelt es sich um ein Bündnis internationaler Großbanken, das 2021 gegründet wurde mit dem Ziel, im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen die Energiewende zu finanzieren – weg von fossilen Energieträgern hin zu Windkraft, Biomasse und Solarzellen. Mit dabei waren die US-Banken J.P. Morgan und Goldman Sachs, die französische BNP Paribas und die schweizerische UBS. Deutsche Mitglieder sind die Deutsche Bank, die Commerzbank und die genossenschaftliche DZ Bank.
Was das Bündnis in den vier Jahren seiner Existenz außer „virtue signalling“ (Signalisieren tugendhaften Verhaltens) eigentlich bewirkt hat, ist nicht ganz klar. Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG etwa will in einer Analyse herausgefunden haben, dass NZBA-Mitglieder ihre ESG-Ziele schneller vorantreiben als andere Banken. ESG steht für ‚Environmental, Social, and Governance‘ und ist an den Finanzmärkten so etwas wie der Nachhaltigkeitsstandard schlechthin. Eine Auswertung der Europäischen Zentralbank bescheinigt der NZBA jedoch, kaum einen messbaren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele geleistet zu haben. Zwischen den Finanzierungseffekten von NZBA-Mitgliedern und -Nichtmitgliedern gebe es kaum einen Unterschied.
Exodus nach Trump-Wahl
Der Anfang vom Ende der NZBA fällt zeitlich mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten vor gut einem Jahr zusammen. Kurz danach erklärte nämlich Goldman Sachs den Austritt aus dem Bündnis, dann folgten die Bank of America, die Citigroup, J.P. Morgan Chase und Morgan Stanley, also all die großen US-Institute. Begründet wurden die Austritte mit juristischen Risiken, politischem Druck und staatlichen „Anti-ESG-Kampagnen“. Das Scheitern der NZBA allein auf Trumps Amtsantritt zu schieben, greift aber zu kurz. Denn es traten auch kanadische Institute wie die Bank of Montreal, die britischen HSBC und Barclays und auch japanische Banken aus dem Bündnis aus. Damit war die NZBA nur noch ein zahnloser Papiertiger, weswegen das Bündnis Anfang Oktober den Übergang zu einer „Framework-Initiative“ beschloss, was de facto seinem Ende gleichkommt.
Die NZBA ist jedoch bei Weitem nicht der einzige Zusammenschluss, der sich in Auflösung befindet. Die Net Zero Asset Managers initiative (NZAM), das Bündnis der globalen Vermögensverwalter, ist seit dem Austritt des US-Schwergewichts BlackRock und anderer US-Adressen ebenfalls nicht mehr aktiv. Bei den Versicherern sieht es ähnlich aus. Hier hat sich die Net Zero Insurance Alliance (NZIA) bereits 2024 in „Forum for Insurance Transition to Net Zero“ umgewandelt. Und mit der Munich Re hat der weltgrößte Rückversicherer inzwischen alle Nachhaltigkeitsbündnisse verlassen, in denen er aktiv war. Die Münchener wollen nun „unabhängig von internationalen Initiativen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten“.
Diversitätsprogramme unter Druck
Parallel dazu stehen in den USA auch die ganzen DEI-Initiativen (Diversity, Equity, Inclusion) zur Disposition. Ein prominentes Beispiel ist der US-Telekomriese Verizon, der die Genehmigung zur Übernahme des Glasfasernetzbetreibers Frontier Communications erst erhielt, nachdem er sein Diversitätsprogramm eingestellt hatte. Ähnlich erging es T-Mobile, der US-Tochter der Deutschen Telekom. Auch sie musste erst ihre DEI-Initiativen stoppen, um den Kabelnetzbetreiber Lumos übernehmen zu dürfen. Weitere Beispiele sind der Discounter Aldi Süd, der in den USA sein DEI-Bekenntnis von der Homepage entfernt hat, und der Softwarekonzern SAP, der das Ziel, in seiner US-Belegschaft eine Frauenquote von 40 Prozent zu erreichen, fortan nicht mehr verfolgt.
All diese Fälle zeigen, dass Nachhaltigkeit offenbar doch nicht der gesellschaftliche Megatrend zu sein scheint, der die Richtung bis weit in das 21. Jahrhundert hinein vorgibt. Stattdessen entpuppen sich Kürzel wie ESG, DEI und Net Zero zusehends als die Überbleibsel eines Modetrends, der seinen Höhepunkt wohl im Jahr 2021 gesehen hat, als all die Unternehmenslenker und Bankenchefs sich als Überzeugungstäter und Kämpfer für die gute Sache inszenierten. Nur zur Erinnerung: Bill Gates veröffentlichte damals ein Buch mit dem Titel „Wie wir die Klimakatastrophe verhindern“, und BlackRock-Chef Larry Fink schwor in seinem viel beachteten jährlichen Rundbrief die CEOs der Unternehmen, in die BlackRock investiert, auf eine Net-Zero-Ökonomie ein. „Kein anderes Thema hat für unsere Kunden höhere Priorität als der Klimawandel“, schrieb er.
Ein Land widersetzt sich
Doch halt! Es gibt noch ein „gallisches Dorf“, das sich dem allgemeinen „Anti-ESG-Trend“ widersetzt. In Deutschland nämlich hat sich der Bundesverband deutscher Banken (BdB) erst vor wenigen Tagen in einem Positionspapier zum Leitbild Nachhaltigkeit bekannt. „Transformation ist kein Kostenfaktor, sondern eine Investition in die Zukunft unseres Standorts“, heißt es darin. Und auch die deutschen Mitglieder der sich in Auflösung befindlichen NZBA geben sich weiter standhaft. „Die Nachhaltigkeitsstrategie und die Netto-Null-Ziele der Deutschen Bank sind unverändert gültig“, hieß es bei dem Geldhaus. Und auch die Commerzbank erklärte nach dem NZBA-Aus, an dem Ziel festzuhalten, die Treibhausgasemissionen des Kredit- und Investmentportfolios bis spätestens 2050 auf netto Null zu reduzieren.
Titelbild: dee karen/shutterstock.com