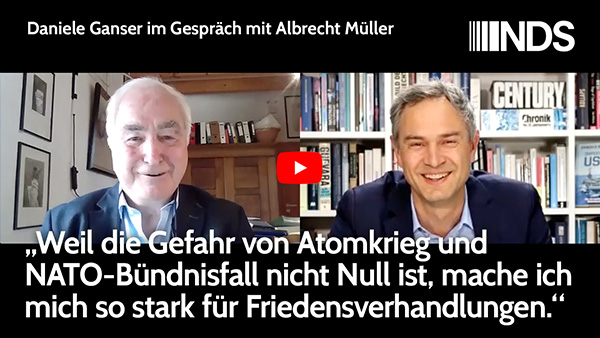Menschen ohne Zuhause, die auf der Straße, bei Freunden oder in Notunterkünften leben müssen – die soll es mit dieser Bundesregierung bis 2030 nicht mehr geben. Momentan zählt Deutschland noch über eine Million davon, und es werden immer mehr. Berliner Aktivisten zeigen, wie es laufen müsste: Konzerne enteignen! Ob das was für Schwarz-Rot ist? Von Ralf Wurzbacher.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Die Bundesregierung will die Wohnungslosigkeit überwinden – bis zum Jahr 2030. Man weiß gar nicht, ob man lachen oder weinen soll. Ernst ist die Sache allemal, ob für Union und SPD, steht auf einem anderen Blatt. Ihr Koalitionsvertrag jedenfalls hält fest: „Der Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit wird umgesetzt.“ Angesichts der bedrückenden Wirklichkeit muss gefragt werden: Wann geht’s denn damit los? Den nationalen Aktionsplan „Gemeinsam für ein Zuhause“ hatte die Ampel vor 19 Monaten beschlossen. Er macht sich das Ziel der Europäischen Union (EU) zu eigen, „gemäß den Grundsätzen der europäischen Säule sozialer Rechte (ESSR)“ bis Ablauf der kommenden fünf Jahre die Wohnungslosigkeit in allen Mitgliedsstaaten zu „beenden“. Bei schätzungsweise einer Million Menschen, die ihre Nächte unter freiem Himmel oder Brücken verbringen, gilt auch im kontinentalen Maßstab: Es gibt reichlich zu tun!
Im Besonderen gilt das für Deutschland. Nach der neuesten Hochrechnung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) waren über das gesamte Jahr 2024 betrachtet bundesweit 1,029 Millionen Menschen ohne feste Bleibe. Bei elf Prozent mehr, verglichen mit 2023, markiert das den nächsten in einer ganzen Serie an „Rekorden“. Seit 2021 hat sich die Zahl fast verdreifacht. Wohnungslos bedeutet das Fehlen eines mietrechtlich abgesicherten oder eigenen Wohnraums. Die Leidtragenden kommen in der Mehrzahl in öffentlichen Not- und Behelfsunterkünften unter. Zu unterscheiden ist davon die harte Obdachlosigkeit. Sie umfasst solche Personen, die sich unter widrigsten Bedingungen auf der Straße durchschlagen. Davon zählte die BAGW im Vorjahr 56.000, wobei auch hier die Kurve nach oben geht. 2023 lag die Zahl bei 54.000. Dabei ist noch von einer beträchtlichen Dunkelziffer auszugehen.
Ende nicht in Sicht
„Die Wohnungslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland hat einen Höchststand erreicht und ein Ende ist nicht in Sicht“, warnte Mitte November die BAGW-Vorsitzende Susanne Hahmann bei der Vorstellung der Ergebnisse. Als häufigste Auslöser von Wohnungslosigkeit nannte sie Miet- und Energieschulden, Konflikte im Wohnumfeld, Trennung oder Scheidung und Ortswechsel. Ein weiterer Treiber der Entwicklung ist die Zunahme an Eigenbedarfskündigungen. Sie sind ein inzwischen gängiges, nicht selten widerrechtlich genutztes Mittel, Mieter vor die Tür zu setzen, um noch mehr Kapital aus dem Wohneigentum zu schlagen.
Hinzu kommen Kürzungen im sozialen Sicherungssystem, wie etwa die verschärften Sanktionen im Rahmen der geplanten Reform des Bürgergelds. „Totalverweigerern“ sollen mithin sämtliche Leistungen einschließlich der Mietzahlungen gestrichen werden. Das stelle die Würde von Menschen infrage und führe dazu, dass sie ihr Zuhause verlieren, meint Hahmann. Dabei wirkt schon der Status quo problemverschärfend. Oft liegen die von den Jobcentern bewilligten Mietobergrenzen unter den realen Kosten, wodurch sich zusätzliche Notlagen ergeben, die am Ende zum Verlust der Wohnung führen können.
Politik und Behörden sind bemüht, das Problem möglichst kleinzurechnen. Offizielle Stellen operieren mit einer anderen Messlatte als die BAGW. Das Statistische Bundesamt erhebt alljährlich die Zahl der institutionell untergebrachten wohnungslosen Personen und dies auch nur an einem Stichtag, nicht im Jahresverlauf. Außerdem unterschlagen die Behörden Gruppen, die gemäß Wohnungsnotfalldefinition ebenfalls als wohnungslos gelten: Personen in Haft, in Gewaltschutzeinrichtungen, im Gesundheitssystem, in Betriebswohnungen, Selbstzahler in Billigpensionen, Monteursunterkünften oder Dauercamper. Zudem werden vor allem anerkannte Geflüchtete ohne Wohnung nicht oder nicht vollumfänglich von allen Kommunen übermittelt. All diese blinden Flecken sorgen dafür, dass die amtliche Statistik rund 500.000 weniger Wohnungslose ausweist und das Ausmaß der Misere so praktisch halbiert – wohlgemerkt auf dem Papier.
Bei Rauswurf Absturz
Aber die Realität zu verdrängen, hilft nicht weiter, am wenigsten den Betroffenen. Etwa darauf zu bauen, dass viele der Flüchtlinge im Land über kurz oder lang wieder das Land verlassen, bringt im Hier und Jetzt keinem etwas. Und der nächste Kriegsschauplatz könnte bei der erratischen Weltlage schon morgen aufmachen. Wovor die Regierenden seit vielen Jahren vor allem die Augen verschließen, ist die Kampfzone auf dem hiesigen Wohnungsmarkt. Die Zeiten sind lange vorbei, in denen Wohnungslosigkeit speziell Menschen in extremen individuellen Notlagen betraf: bei plötzlichem Jobverlust und persönlichen Schicksalsschlägen aller Art. Heute kann es jeden treffen, auch die mit festem Job, intakter Familie und bester Gesundheit. Immer mehr Menschen machen die Erfahrung, dass sie, sobald sie erst einmal raus sind aus ihrer Wohnung, einfach keinen adäquaten und erschwinglichen Ersatz finden.
„Der Mangel an bezahlbarem und bedarfsgerechtem Wohnraum sowie Armut sind die zentralen Gründe für Wohnungslosigkeit in Deutschland“, konstatiert die BAGW. „Der vorhandene Wohnungsbestand kann die stetig steigende Nachfrage nicht decken.“ Bei seit Jahren rückläufiger Bautätigkeit und gleichzeitig ins Obszöne gestiegenen Mieten bleiben zunehmend mehr auf der Strecke. Zum Beispiel rechnet der Berliner Senat bis 2029 mit 85.000 Wohnungslosen in der Hauptstadt, ohne Berücksichtigung der mutmaßlich nachrückenden Flüchtlinge. Bei aktuell offiziell 55.400 Betroffenen wäre das eine Steigerung um über 53 Prozent in nur vier Jahren.
Wie will man dieser Situation Herr werden? Der Wohnungsbau kommt seit Jahren nicht annähernd mit dem wachsenden Bedarf mit. Statt der versprochenen 400.000 neuen Einheiten waren es 2022 rund 294.000, 2023 dann 271.000, 2024 noch 250.000 und fürs laufende Jahr wird von 235.000 Fertigstellungen ausgegangen. Dabei ist die Zahl der Mieter in den zurückliegenden fünf Jahren laut Deutschem Mieterbund (DMB) um fast drei Millionen gestiegen.
Monströses Pulverfass
Das Wenige, was dazukommt, ist in der Mehrzahl der Fälle für die Breite der Bevölkerung ungeeignet, weil zu teuer. Gemäß dem neuesten DMB-Mietenreport waren im Vorjahr rund sechs Millionen Mieterhaushalte durch die hohen Kosten „extrem belastet“. Mehr als 12,8 Millionen Mieter leben in Angst, sich ihre Wohnung in Zukunft nicht mehr leisten zu können. Fast jeder Sechste, rund sieben Millionen Bürger, fürchtet ganz konkret den Verlust der eigenen vier Wände. Die Wohnungskrise hat schon heute große soziale Sprengkraft, in nur wenigen Jahren könnte ein monströses Pulverfass explodieren.
Neben den individuellen Nöten drohen auch volkswirtschaftlich massive Schäden. Wer mehr als 30, 40, mithin über 50 Prozent seines Haushaltseinkommens fürs Wohnen aufbringen muss, dem bleibt zum Konsumieren nicht viel übrig. Perspektivisch stehen hier gewaltige Kaufkraftverluste zu erwarten, die auch andere Wirtschaftssektoren hart treffen können. Dazu kommen sozialstaatliche Mehrausgaben, etwa für die Übernahme der Unterkunftskosten von Bürgergeldempfängern oder bei Wohngeld. Tatsächlich übersteigen solche und weitere Leistungen die öffentliche Förderung für den Neubau von Sozialwohnungen um ein Vielfaches.
2024 schoss der Staat allein 20 Milliarden Euro zu, damit Bedürftige ein Dach über dem Kopf haben können. Dagegen plant Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) für 2026 mit lediglich vier Milliarden Euro für die soziale Wohnraumförderung. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Bündnis „Soziales Wohnen“, dem unter anderem der DMB, die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) und der Caritas-Verband angehören, fordert Investitionen in Höhe von kurzfristig 50 Milliarden Euro. Mit dieser Hausnummer hantiert sogar Ministerin Hubertz, angeblich wollen Bund und Länder bis 2029 richtig ranklotzen. Versprechen dieser Art wurden früher verlässlich Opfer der Abrissbirne.
Geschenk für Bau- und Immo-Lobby
Seit Jahrzehnten ist der soziale Wohnungsbau ein Fass ohne Boden. Wegen der jährlich auslaufenden Bindungen und unzureichendem Nachschub hat sich der Bestand von über 2,8 Millionen im Jahr 1990 auf aktuell knapp über eine Million dezimiert. Dem stehen über elf Millionen Haushalte gegenüber, die per Wohnberechtigungsschein (WBS) Anspruch auf eine entsprechende Unterbringung haben. Drastisch bergab ging es mit der Förderung ab der Jahrtausendwende, als der Kurs der Entstaatlichung mit Schlagworten wie „Austerität“, „Schuldenbremse“ und „schwarze Null“ richtig Fahrt aufnahm. Aber selbst die von der Ampel proklamierte und jetzt von Schwarz-Rot aufgegriffene „Wohnungsoffensive“ ändert nichts an der Talfahrt. 2024 wurden 62.000 Sozialwohnungen errichtet, insgesamt gab es trotzdem 26.000 weniger als im Jahr davor.
Die Verhältnisse stimmen einfach nicht und die Prioritäten bleiben die falschen. Der Löwenteil des Hubertz-Etats von 13 Milliarden Euro fließt wie gehabt in den klassischen Wohnungsbau, der vor allem hochpreisige Segmente bedient. Ihr Mantra „Bauen, bauen, bauen“ gefällt vor allem den Platzhirschen der Branche, die auf maximalen Profit aus sind und nicht auf Mieter mit schmaler Geldbörse. Passend dazu taugt auch der durch die Ministerin aufgelegte „Bauturbo“, ein Gesetz zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, nicht zum Befreiungsschlag. Das Instrument setze einseitig auf hochpreisigen Neubau auf der grünen Wiese, werde Bodenspekulation, Versiegelung, Zersiedlung und die Klimakrise befeuern, aber dem Wohnungsschwund in Großstädten und Ballungszentren nicht beikommen, bemängelt etwa die Deutsche Umwelthilfe. Zitat: „Das ist ein Geschenk an die Bau- und Immobilienlobby.“
Bürger für Enteignung
Vielversprechend erscheint hingegen das Projekt der Initiative „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ (DWE) in Berlin. Sie will per Volksentscheid durchsetzen, dass die Bestände von Konzernen mit mehr als 3.000 Einheiten in Gemeineigentum überführt werden, womit das Land Zugriff auf rund 220.000 Wohnungen bekäme. Derzeit laufen die Vorbereitungen für einen zweiten Vorstoß, nachdem der erste ziemlich rüde abgewürgt wurde. Vor vier Jahren kam zwar die erforderliche Mehrheit an Unterstützern zustande. Eine Umsetzung hat der Senat wegen Unwillens allerdings bis heute verschleppt. Anders als damals sollen die Bürger beim neuen Anlauf über einen eigens erarbeiteten Gesetzentwurf abstimmen, den die Politik verpflichtend zu verwirklichen hätte.
Aus juristischer Sicht stünde einer Vergesellschaftung wohl nichts im Wege. Eine vom Senat eingesetzte Expertenkommission hatte dafür schon vor über zwei Jahren grünes Licht gegeben. Strittig bleibt derweil, was das kosten würde, sprich die Höhe der Entschädigungen. Nach einer vor zehn Tagen durch die DWE vorgelegten Studie könnten sich die Ausgleichszahlen in einer Bandbreite von zehn bis 17 Milliarden Euro bewegen, woraus Sprecherin Firdes Firat schloss: „Eine Finanzierung ist möglich, auch bei einer langfristig niedrigen Miete und einem guten Bewirtschaftungsstandard“.
Die Gegner der Pläne, wozu auch die Landesregierung gehört, versuchen den Preis so hinzubiegen, dass eine Rückverstaatlichung sich nicht rentieren würde. So kalkuliert der Landesrechnungshof einerseits mit einem Schadensausgleich in Höhe des Marktwertes von bis zu 42 Milliarden Euro, was das klamme Land finanziell überfordern würde. Ein zweites Szenario rechnet mit acht oder elf Milliarden Euro, was „unweigerlich zu Defiziten“ bei der Bewirtschaftung, zu höheren Mieten und weiteren Landeszuschüssen führe. Die DWE geht mit ihrer Kalkulation einen Mittelweg mit einer Entschädigung von 40 bis 60 Prozent des aktuellen Verkehrswerts und verspricht: „Berlin wird durch die Vergesellschaftung nicht ärmer, sondern reicher.” Die Dinge bleiben spannend. Ob und wann es zu einem zweiten Volksentscheid kommt, ist noch offen.
„Völlig unrealistisch“
Zur Erinnerung: Vor 21 Jahren wechselten in der Hauptstadt 65.000 Wohnungen für knapp zwei Milliarden Euro den Besitzer. Es waren 2004 SPD und PDS, die in gemeinsamer Regierungsverantwortung riesige städtische Wohnungsbestände zu einem Spottpreis an die Immobilienindustrie verschleuderten und so mit der Deutsche Wohnen den gefräßigsten Miethai der Hauptstadt großzogen, der inzwischen von der noch größeren Vonovia geschluckt wurde. Das Beispiel machte bundesweit Schule, zog eine gewaltige Privatisierungswelle nach sich, in deren Zuge der Staat seine wohnungspolitische Handlungsmacht weitgehend preisgab und die Bürger den freien Marktkräften auslieferte. Die Resultate zeigen sich heute mit voller Vehemenz: Sozialer Wohnungsbau in Auflösung, explodierende Mieten, Gentrifizierung, grassierende Wohnungs- und Obdachlosigkeit.
Seit zwei Wochen erinnert am Berliner Ostbahnhof eine Gedenktafel an die Opfer der harten Gangart. Daneben finden sich die Fotos von 30 Menschen, die in den jüngeren Jahren in näherem Umkreis den Tod fanden. „Gangway“, ein freier Träger für Straßensozialarbeit, will weitere dieser Mahnmäler in der Hauptstadt platzieren, als „Zeichen gegen die Gleichgültigkeit“, wie es in einer Mitteilung heißt. „Wenn Menschen auf der Straße sterben, mitten in einer wohlhabenden Stadt wie Berlin, dann ist das kein Naturereignis – es ist die Konsequenz gesellschaftlicher und politischer Entscheidungen.“
Aber will Schwarz-Rot nicht Schluss machen mit all dem Leid, bis 2030? Wer’s glaubt. Der Norddeutsche Rundfunk befragte dazu Jan Goering, einen Sozialarbeiter in Hannover. Sein Urteil: „Das ist völlig unrealistisch.“
Titelbild: Stephan Dost/shutterstock.com