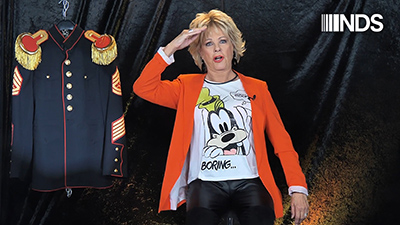SPD auf der Suche nach einer Neuorientierung
Schon nach dem Leitantrag, den der SPD-Parteivorstand dem Bundesparteitag vorgelegt hatte, war klar, dass Dresden bestenfalls eine Zwischenetappe auf dem Weg zu einer Neuorientierung und vor allem zu einer Selbstvergewisserung sozialdemokratischer Politik sein wird. Es wird viel Zeit brauchen, bis die SPD wieder ein glaubwürdiges Profil gefunden hat, das deutlichere Akzente gegenüber dem bisherigen Kurs erkennen lässt. Wolfgang Lieb
Sigmar Gabriel sagte am Anfang seiner Bewerbungsrede für den Parteivorsitz [PDF – 173 KB]:
„Am Anfang steht die Überprüfung unserer eigenen Politik. Überprüfen heißt, zu unterscheiden zwischen dem, was richtig war, was gut war und was das Land in den letzten elf Regierungsjahren der SPD weitergebracht hat, und dem, was nicht richtig war, was nicht so gut war und wo wir etwas falsch eingeschätzt haben. Lasst uns dabei nicht in allzu leichte Erklärungen flüchten: dass es nur daran gelegen habe, dass uns die Menschen nicht richtig verstanden hätten oder wir es nicht richtig erklärt hätten. Wer ein derartiges Wahlergebnis bekommt, der hat mehr als nur ein Kommunikationsproblem.“
Eine wirkliche Bestandsaufnahme oder gar eine inhaltliche Kritik der elfjährigen Regierungszeit hat Gabriel mit seiner Rede nicht geleistet. Er hat eine geschickte Rede aus einer Mischung von Demut und Aufbruch gehalten, die offenbar bei den Delegierten ankam. Mit 94,2 Prozent wurde Gabriel zum Parteivorsitzenden gewählt.
Doch was heißt das eigentlich bei den bekannt disziplinierten Parteitagsdelegierten schon? Auch seine Vorgänger, etwa Platzeck, er erhielt 92,2 Prozent, Kurt Beck, 95,45 Prozent, und selbst Franz Müntefering erhielt nach dem Sturz von Beck bei seiner Wiederwahl immerhin noch 85 Prozent der Stimmen.
Ohne eine veränderte Politik haben die jeweils begeistert gefeierten Personalwechsel den Abstieg der Partei nicht aufgehalten. Eine klare Korrektur oder eine Neubestimmung des Kurses hat Gabriel nicht vorgenommen, dafür liegt vielleicht der Abschied der SPD aus der politischen Verantwortung einfach noch nicht weit genug zurück. Weil er eine ungeschminkte Fehleranalyse vermied und klare Festlegungen auf kommende, jährliche Arbeitsparteitage verschob, geriet seine Rede auch sehr lang.
Zwar hat er anders als seine Vorgänger, für die Wahlniederlagen immer nur Betriebsunfälle waren, endlich zur Kenntnis genommen, dass die SPD seit 1998 10 Millionen Wählerinnen und die Hälfte ihrer Anhängerschaft verloren hat, aber Gabriel sucht die Ursache dafür in einem fehlenden „sichtbaren Profil“ und überdeckt damit, dass die SPD vom Profil der Union in der Großen Koalition kaum mehr unterscheidbar war.
Gabriel fragt zu Recht: Warum hat die SPD ausgerechnet in dieser Zeit der größten Finanz- und Wirtschaftskrise die Wahlen verloren, die, wie gesagt, geradezu nach sozialdemokratischen Antworten schreit? Er rettet sich damit aber nur über die entscheidende Frage hinweg, wo denn die sozialdemokratischen Antworten vor der Krise geblieben sind, und er sagt keinen Satz darüber, wie die sozialdemokratischen Finanzminister den Finanzspekulationen Tür und Tor geöffnet haben.
Er sieht mit Verweis auch auf den Niedergang der anderen sozialdemokratischen Parteien in Europa in den „schwierigen Beschlüssen– zur Arbeitsmarktreform, zur Leiharbeit, zur Rente –, die uns so sehr von unserer Wählerschaft entfernt haben“ nur „Symptome“ und nicht die eigentlichen Ursachen für Abfuhr durch die Wähler. Er umschifft dabei die Tatsache, dass auch die Sozialdemokraten in den Niederlanden, in Frankreich, in Italien und in Großbritannien vor allem deshalb im Niedergang sind, weil sie (vor allem ausgehend von Tony Blair und seinen ideologischen Beratern) die herrschenden wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Lehren als sozialdemokratische Erneuerung ausgegeben haben.
Immerhin gesteht Sigmar Gabriel ein, dass die SPD „eben in der Anpassung an die herrschende Lehre, die wir für die Mitte gehalten haben, auch Politikkonzepte entwickelt (hat), die schon große Teile unserer Mitgliedschaft innerlich nicht akzeptiert haben und die unsere Wählerschaft in ihrem Bedürfnis nach sozialer Sicherheit und sozialer Gerechtigkeit verletzt haben und bei ihnen nicht etwa Aufstiegsfreude, sondern Abstiegsängste geweckt haben.“
Doch auch solche Teileingeständnisse sind eben keine Distanzierung, sondern nach wie vor der Versuch, die „Ängste“ und die „verletzten Bedürfnisse“ auf das Unverständnis der Mitglieder und der Wählerschaft zu schieben.
Man müsse das, was der SPD dort an Kritik entgegengekommen ist, jetzt in der Partei erst einmal debattieren. „Aber ich sage euch: Es hilft auch nichts, wenn wir aus der Zahl 67 eine 65 machen oder wenn wir sagen, wir gehen zurück auf „Los“. Es geht doch eigentlich darum, dass wir uns jetzt die Zeit nehmen, um das Verhältnis von Arbeit und sozialen Sicherungssystemen zu klären. Wir müssen die Frage klären, wie einer, der gearbeitet hat und der vielleicht mit 62 schon nicht mehr kann, ohne dramatische Einkommens- und Rentenverluste bis ins Rentenalter kommt.“
„Meine Mutter ist Krankenschwester gewesen, und ich kenne keine Krankenschwester, die mit 67 noch einen Patienten heben kann“, ruft Gabriel aus. Wie eine solche Krankenschwester mit 62 Jahren ins Rentenalter kommen soll, ohne 5 mal 3,6, also 18 Prozent Renteneinbuße hinnehmen zu müssen, darauf gibt Gabriel leider keine Antwort.
Auf der abstrakten Ebene des politischen Koordinatensystems waren neue Töne zu hören:
„Die politische Mitte in Deutschland war nie ein fester Ort, nie eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft oder in der Wählerschaft. Die politische Mitte definiert sich nicht durch Einkommens- oder Berufsgruppen und übrigens auch nicht durch bestimmte politische Einstellungen, denen man sich anzupassen habe. Die politische Mitte Willy Brandts war etwas ganz anderes. Sie war kein fester Ort, sondern sie war die Deutungshoheit in der Gesellschaft. Die politische Mitte in einem Land hat der gewonnen, der in den Augen der Mehrheit der Menschen die richtigen Fragen und die richtigen Antworten bereithält.
Aber Willy Brandt und die SPD haben nicht ihre Antworten angepasst, sondern sie haben um die Deutungshoheit in dieser Gesellschaft gekämpft.
Ihre Fragen, die Fragen und Antworten der SPD und die Anfragen und Antworten Willy Brandts, waren emanzipatorisch, aufklärerisch und damit eben links… Das Konzept der politischen Mitte, wie es seit ein paar Jahren in Deutschland interpretiert wird, ist etwas ganz anderes. Wir haben uns einreden lassen – und mit uns viele andere in der Sozialdemokratie Europas -, die politische Mitte sei etwas Festgelegtes, an das man sich anpassen müsse, wenn man Wahlen gewinnen will. Der Politologenglaube, man müsse sich einer vermeintlich festgelegten Mitte annähern, wenn man noch Wahlen gewinnen will, statt sie mit eigenen Antworten und Konzepten wieder für sich zu gewinnen, ist – so glaube ich – die eigentliche Ursache für unsere Wahlverluste.
Statt die Mitte zu verändern, haben wir uns verändert. Wir haben uns schrittweise der damals herrschenden Deutungshoheit angepasst, und mit uns viele andere sozialdemokratische Parteien in Europa.“
Wenigstens beim Streben in die „politische Mitte“ rückt Gabriel vom schlichten Wählermarktmodell etwa von Steinmeier und Steinbrück ab.
Auch zur innerparteilichen Demokratie schlägt Gabriel neue Töne an. Die SPD müsse „mehr Politik wagen“, eine „Politikwerkstatt für gesellschaftlichen Fortschritt“ sein. Es sollen jährliche „Arbeitsparteitage“ durchgeführt werden und „eine ständige Konferenz der Kommunalpolitiker“ eingerichtet werden. Zu wichtigen politischen Entscheidungen sollen Urwahlen durchgeführt werden.
Dass in der Partei ein Bedürfnis besteht sich einzumischen, zeigte die sechsstündige Generaldebatte um den Leitantrag. Zum ersten Mal seit langer Zeit wurde auf einem Parteitag wieder um Formulierungen gerungen. Zu wesentlichen Änderungen oder gar zu einem Alternativantrag kam es allerdings nicht. Ob die Kräfte in der SPD noch stark genug sind, eine Neuorientierung durchzusetzen, ist auch nach diesem Parteitag eine offene Frage. Zu viele Mitglieder, die an der SPD verzweifelten, sind abgewandert. Das schwache Abschneiden von Andrea Nahles zur Wahl als Generalsekretärin (mit 69,6 Prozent) lässt unterschiedliche Interpretationen zu: Es könnte die Rache der im Seeheimer Kreis organisierten Parteirechten ausdrücken, es könnten aber wegen Nahles anpasserischer Haltung auch viele Parteilinken in ihr keine Hoffnungsträgerin mehr gesehen haben.
Gabriels Beschreibung, was heute linke Politik ist, könnte man durchaus folgen: „Links heißt, dass man für Gesellschaften eintritt, die gerecht sind, weil Freiheit und Verantwortung, Freiheit und Solidarität, Freiheit und Gerechtigkeit aneinander gebunden sind. Diese Grundüberzeugung ist das, was für mich und für die Sozialdemokratie links ist.“ Doch um sich bloß vor dem Vorwurf eines „Linksrutsches“ zu schützen schränkt Gabriel gleich wieder ein: „Wenn wir links so verstehen, dann müssen wir uns doch nicht nach links öffnen, sondern wir müssen unsere politischen Konzepte daraufhin überprüfen, ob sie diesem Anspruch auf Freiheit und Verantwortung gerecht werden.“ Wenn es konkret wird, dann gibt es eben nur Prüfaufträge.
Interessant ist auch, dass Gabriel die Formel „Innovation und Gerechtigkeit“ aus dem Schröder/Lafontaine-Wahlkampf des Jahres 1998 wieder aufgriff und bedauerte, dass man diese „Mehrheitsformel“ aus dem Blick verloren habe. Aber statt den Blick wieder auf die damalige Programmatik zu richten, bezieht er sich als Grundlage auf den sog. „Deutschlandplan“ von Frank-Walter Steinmeier. Von einer die Unternehmenslogik sprengenden makroökonomischen Wirtschafts- oder von Konjunkturpolitik liest man dort kaum etwas. Der Plan malt ein Wolkenkuckucksheim, aber kein neues Konzept aus der Krise, und schon gar keine Antwort findet man dort darauf, wer für die Krise bezahlen soll. Dort fehlt darüber hinaus jegliche Vision für einen Ausbau des Sozialstaats. Dabei soll doch nach Gabriel der Sozialstaat gerade das „Kernprojekt der Sozialdemokratie“ sein.
Immerhin will die SPD im Jahr 2010 ein neues Steuerkonzept vorlegen. Gabriel erklärt sich zum Vorsitzenden des „Fanclubs der Vermögensteuer“, er spricht die „Börsenumsatzsteuer“ an und nennt die ungerechte Vermögensverteilung beim Namen – doch gleichzeitig will er den Bock zum Gärtner machen und sich auf Rat von Peer Steinbrück stützen.
Immerhin haben die 500 Delegierten bei der Vermögensteuer gegen die Empfehlung der Parteispitze entschieden.
„Ja, wir wollen soziale Marktwirtschaft. Aber wir wollen noch mehr: Wir wollen soziale Demokratie in Deutschland … Das ist mehr als nur Spielregeln für die Unternehmen“, ruft Gabriel aus. Und als wichtigste Richtungsfrage erkennt er: „Wer bestimmt die Regeln, die Ökonomie oder die Politik?“ Gabriel sieht in der Privatisierung das „Gegenmodell zur Solidarität“: „ Wer privatisiert, der zerstört Solidarität und betreibt Klientelpolitik. Das müssen wir bekämpfen.“
Ein neuer Tonfall auch bei der Lohnpolitik: „Produktivitätssteigerung und Inflationsrate gibt mehr Lohn.“ Er kritisiert die Auswirkungen der Föderalismusreform für die Bildungspolitik und verlangt deutlich mehr Geld für die Bildung. Wollte man den Wert der OECD-Staaten erreichen, bräuchte man jährlich 20 bis 25 Milliarden. „Für Sozialdemokraten muss Bildung kostenfrei sein, vom Kindergarten bis zur Universität“.
Nicht mehr als Wischi-Waschi jedoch wiederum bei der Afghanistan-Politik: „Dort zu bleiben, ist ganz schlimm, rausgehen ist auch ganz schlimm zurzeit. Also lasst uns in den nächsten Wochen darüber in der Partei diskutieren.“
Auf dem Parteitag wurde in der Sache nichts Neues beschlossen, und schon gar nicht wurden alte Entscheidungen aus der sozialdemokratischen Mitregierung korrigiert oder gar zurückgenommen. Keine Mehrheit erhielt ein Antrag auf Rücknahme der Rente mit 67. Wie man da, wie der neue CDU-Generalsekretär Gröhe, von einer „Flucht in die linke Ecke“ reden kann, zeigt eigentlich nur, wie weit nach rechts die politischen Koordinaten in Deutschland schon verschoben sind.
Gabriels Rede setzte gewiss neue Akzente und gab auch Anstöße für eine Neuausrichtung der SPD, die Konkretisierung verschob er auf die zukünftigen „Arbeitsparteitage“, auf „Politikwerkstätten“ und auf mehr „Öffnung zur Gesellschaft“. Das ist immerhin ein Angebot an die Partei und wurde auf dem Parteitag begeistert aufgenommen. Man wird aber abwarten müssen, ob das Versprechen nach mehr Demokratie eingehalten wird, und was die Partei aus diesem Angebot macht.
Soviel sollte sie jedenfalls aus Steinmeiers mythomanischem Auftritt nach der Europawahl inzwischen auch gelernt haben: Allein die Begeisterung für eine Rede auf einem Parteitag kann die SPD nicht aus ihrem Tief herausführen.
Ein paar neue Leichtfeuer sind gesetzt, ob der „Tanker SPD“ aber seinen Kurs darauf einschlagen wird, das wird davon abhängen, ob diejenigen auf der Kommandobrücke lieber vorwärts fahren oder nur nach rückwärts blicken wollen und vor allem auch, ob die Mannschaft der SPD zu neuen Ufern aufbrechen kann. Schaut man sich auf der neuen Führungsebene nach wirtschafts-, energie- oder sozialpolitischer Kompetenz um, so sieht es etwa nach dem Ausscheiden der Sozialpolitikerin Ursula Engelen-Kefer oder des Energieexperten Hermann Scheer ziemlich duster aus. Ein gestandener Wirtschaftspolitiker ist nicht ausmachbar. Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern in dem um eine Stelle erweiterten engeren Vorstand ist nach wie vor auf dem Feld der Sozialpolitik ein unbeschriebenes Blatt.
Im Gegensatz zu Schröder, der als Parteivorsitzender die Partei mit seinem Amt erpressen konnte, und im Unterschied zu Müntefering, der in diesem Amt immerhin noch Disziplin mit Rücksicht auf die Regierungsbeteiligung einfordern konnte, ist allerdings Gabriel mit einer SPD in der Opposition auf die Zustimmung der Basis der Partei angewiesen, wenn er sein Amt als Parteivorsitzender verteidigen will.
Schon die Landtagswahl im Mai in Nordrhein-Westfalen wird die Nagelprobe dafür sein, ob die Signale, die der Parteitag in Dresden gesetzt hat, ausreichen, um wieder Vertrauen schaffen zu können. Und Glaubwürdigkeit erreicht man bekanntlich am besten, indem man sagt, was man tun will, und dann auch tut, was man sagt.
Der neue Fraktionsvorsitzende Steinmeier hat sich bei seiner Rede anders als im Vorfeld des Parteitags mit seinen Verteidigungsreden auf die Agenda 2010 deutlich zurückgehalten. Aber er konnte das Loblied auf sein vorausgegangenes politisches Handeln doch nicht ganz lassen:
„Wir wissen, dass eine Partei, die nicht zu ihrer Geschichte steht, auch keine Zukunft gewinnen kann. Dabei vergessen wir nicht, dass wir dieses Land aus dem schwarz-gelben Muff der 90er-Jahre geholt haben, dass wir dieses Land geöffnet haben und dass wir dieses Land nach vorne gebracht haben.“
Über das Festhalten an seiner eigenen Geschichte gestand er immerhin zu:
„Das heißt natürlich Bereitschaft zu einer ehrlichen, offenen und fairen Diskussion. Diese Bereitschaft haben wir, und wir diskutieren.“
Ansonsten arbeitete in seiner Parteitagsrede an seinem Profil als Oppositionsführer und kritisierte den Koalitionsvertrag von Schwarz-Gelb wie schon im Bundestag.
Müntefering hatte einen matten Abgang. Dass es sich als noch amtierender Parteivorsitzender gehört dem Kanzlerkandidaten zu danken, ist eine Frage der Höflichkeit. Steinmeier und damit auch sich selbst zu versichern, man habe kein Wort zurückzunehmen und man habe im Wahlkampf viel Zustimmung erfahren, sind eher Anzeichen von Altersstarrsinn.
Müntefering bekennt allerdings:
„Die Dimension der Niederlage ist das Erschreckende. So etwas bildet sich nicht in einem Jahr und nicht einmal in einer Legislaturperiode heraus. Der Wille und die Bereitschaft, genauer hinzusehen, tiefer nach den Gründen zu schürfen, ist deshalb verständlich und nötig.“
Aber diese Bereitschaft, genauer hinzuschauen, ist bei Müntefering offenbar nach wie vor kaum vorhanden. So verteidigt er mit alten, oft widerlegten Argumenten seine Rentenpolitik und das „Fördern und Fordern“ der Agenda-Politik. Es sei gut gewesen „für unser Land und gut für uns als Partei“, seit 1998 regiert und mitregiert zu haben. Er belegte das weniger mit konkreten Fakten als mit allgemeinen Betrachtungen über die Veränderung der „gesellschaftlichen Bedingungen für Politik“.
Er arbeitete sich merkwürdigerweise an der FDP-Formel „Leistung muss sich wieder lohnen“ ab, und versuchte, dieser Kampfparole der Liberalen für Steuer- und Abgabensenkungen eine sozialdemokratische Interpretation entgegen zu stellen: „Leistung muss sich lohnen, das heißt für uns: Garantie gibt es nicht, aber alle müssen die Chance haben. Alle müssen die Chance haben, etwas zu leisten und dafür eine gerechte Belohnung zu bekommen.“
Mit dieser Definition von Chancengerechtigkeit lässt sich allerdings eine klare Abgrenzung zu den liberalen Positionen nur schwer begründen: „Da wir den Aufstieg nicht leichtfertig und massenhaft versprechen und den so definierten Abstieg nicht überall verhindern können, betrachten uns potenzielle Aufsteiger als uninspiriert und uninteressant, und die, die sich vor Abstieg fürchten, als nicht hinreichend sozial. Die Aufklärung dazu ist uns bisher nicht hinreichend gelungen, die Debatte auch nicht.“ So einfach mit der Gerechtigkeit sei es eben nicht.
Müntefering fällt nicht viel mehr ein, als die Berufung auf Helmut Schmidts „pragmatisches Handeln zu sittlichen Zwecken“, und er sieht damit offenbar den von ihm wesentlich bestimmten Kurs für gerechtfertigt an.
Für Müntefering liegt der Hauptgrund für die Niederlage nach wie vor darin, dass die Partei diesen Kurs nicht wirklich akzeptiert habe:
„Eine Partei, die SPD, beschließt 2005 ihr Wahlprogramm fast einstimmig, dann auf einem Parteitag den Koalitionsvertrag auch fast einstimmig, sie akzeptiert die Logik der Situation und sagt Ja zum Regieren. Aber sie ist im Herzen unglücklich und kritisiert, dass sich die Handelnden an Beschlüsse halten, die man auf dem Parteitag gemeinsam gefasst hat. Was nun? – Kein Wunder jedenfalls, dass die Wählerinnen und Wähler das alles, vor allem aber uns selbst, nicht recht verstehen, liebe Genossinnen und Genossen! So ist es.“
Dass schon mit Schröders die SPD völlig überraschenden Ausrufung der Agenda 2010, mit dessen Neuwahl-Coup im Jahr 2005 und danach mit der Zustimmung zur Großen Koalition die Parteitage gar keine Möglichkeit mehr hatten, ihre Zustimmung zu verweigern, lässt Müntefering nach wie vor nicht gelten. Deshalb mokiert er sich auch über den Vorwurf, er sei „ein autoritärer Knochen“: Er sei „diesbezüglich unerkannt durch die lange Zeit der Ämter gekommen.“
Das kann man nur noch als den ignoranten und selbstbezogenen Abschied eines Politikers verstehen, der als Generalsekretär der SPD, als Fraktions- und zweimaliger Parteivorsitzender und auch als Vizekanzler seine Rolle als „Parteisoldat“ immer nur als diejenige eines „Unteroffiziers“ zur Durchsetzung von politischen Positionen in der SPD verstanden hat – von Positionen, die über die Köpfe der Partei hinweg entwickelt und entschieden wurden.