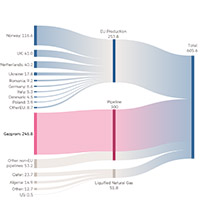NachDenkSeiten-Leser sind einfach große Klasse. Hier vier weiterführende Mails zum Artikel über die Abwesenheit ökonomischen Sachverstands.
Auf den Artikel von heute Mittag kamen weiterführende Mails, die wir Ihnen unmittelbar zur Kenntnis geben wollen: Die erste ist eine Mail an Herrn Professor Leggewie zu dessem unseligen Auftritt in den Tagesthemen. Darin enthalten sind die 2017-er Daten über Arbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit in Italien. Im zweiten Leserbrief wird die propagandistische Bedeutung der Begriffe Globalisierung, Digitalisierung, Populismus beleuchtet. Im dritten Leserbrief wird Macron in Aussicht gestellt, dass Frankreich mit ihm wegen makroökonomischen Unverstands ähnlich scheitern wird wie Italien. Der Schreiber des vierten Leserbriefs schickt einen Link auf ein Zitat von Oettinger mit der zynischen, antidemokratischen Botschaft. “Die Märkte werden Italienern beibringen wie man richtig wählt”. Das ist der Geist der sogenannten Demokraten. Albrecht Müller.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.