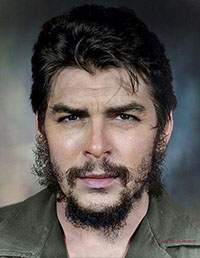Ein Regierungspräsident i. R. versucht den Ruf unseres Landes zu heilen – mit einem sehr guten Brief nach Wolgograd
Die meisten NachDenkSeiten-Leserinnen und Leser werden davon unterrichtet sein, dass unsere amtierende Regierung und der Bundespräsident ausgesprochen schäbig mit dem Gedenken an das Ende der Schlacht um Stalingrad und die vielen Opfern, Russen wie Deutsche und Menschen aus anderen Völkern umgegangen sind. Zum 75. Jahrestag am 2. Februar ist kein offizieller deutscher Vertreter in Wolgograd erschienen. Erstaunlich viele deutsche Medien haben sich über die Gedenkfeiern in Russland eher mit Spott als mit Sympathie und Trauer hergemacht. Der frühere Regierungspräsident von Braunschweig Karl-Wilhelm Lange, lange auch Präsident des Volksbundes deutscher Kriegsgräberfürsorge, hat an die ihm aus der Zusammenarbeit bekannte Museumsdirektorin Valentina Sorokoletova einen Brief geschrieben, den zu lesen und zu verbreiten wirklich lohnt. Albrecht Müller.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.