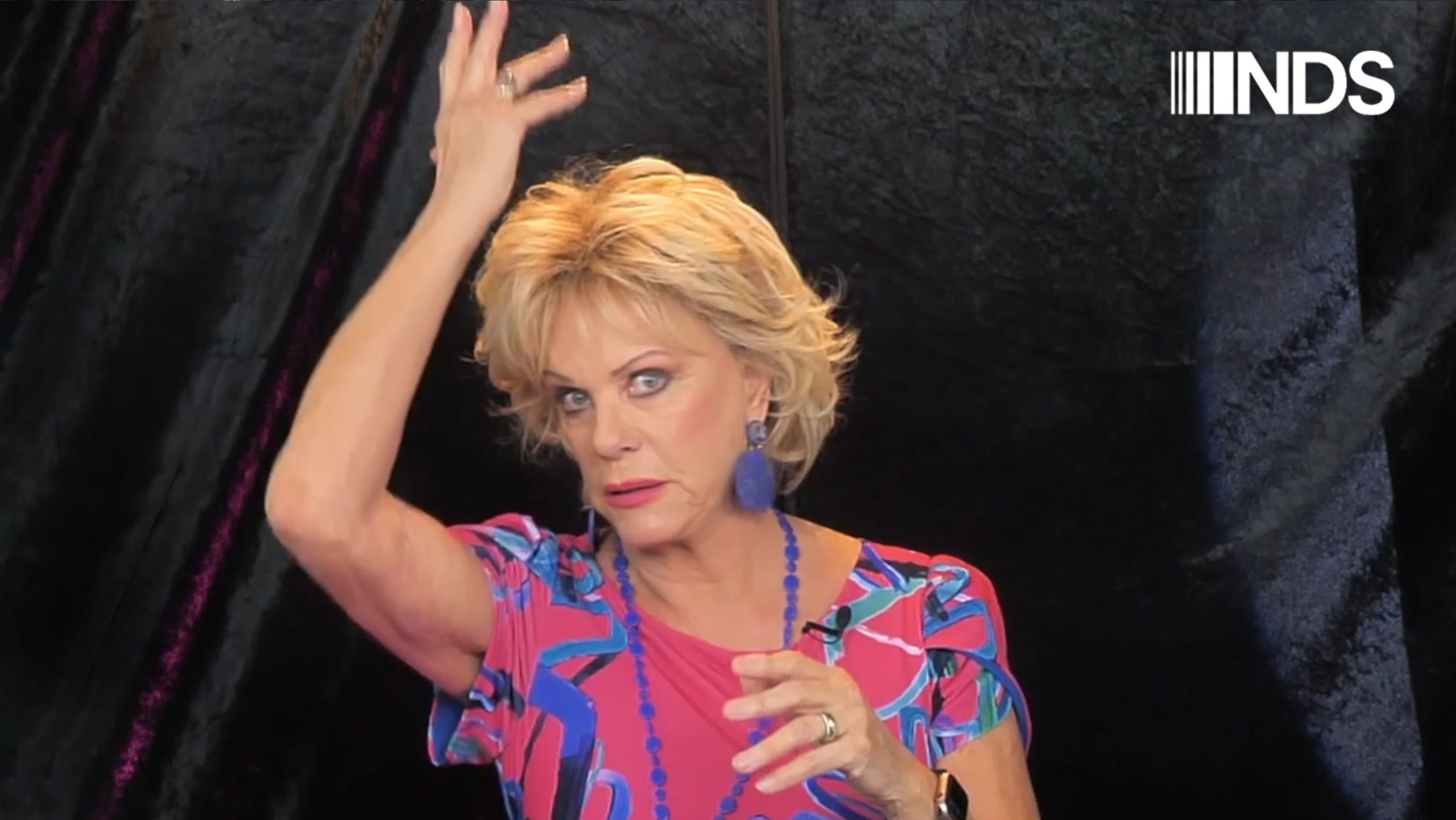Trotz historisch hoher Steuereinnahmen und jahrzehntelanger Wirtschaftsstabilität verharrt die Armutsquote in Deutschland auf hohem Niveau – und die Reichtumskonzentration wächst. Warum scheint die Bundesrepublik strukturell unfähig oder unwillig zu sein, dieser Entwicklung entgegenzuwirken? Eine Spurensuche zwischen statistischen Verzerrungen, strukturell eingebetteten politischen Interessen und dem schleichenden Bedeutungsverlust von Gleichheit als politisches Leitprinzip in der Demokratie. Von Detlef Koch.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Ein Paradox in Zahlen
Deutschland ist reich – und bleibt dennoch tief gespalten. Während das Bruttoinlandsprodukt Jahr für Jahr neue Höchststände erreicht, stagnieren Armutsquoten und vertiefen sich die sozialen Gräben. Die Statistik suggeriert oft Mäßigung, doch alternative Ungleichheitsmaße wie Palma-Ratio, Atkinson-Index oder das Median–Durchschnitts-Verhältnis erzählen eine andere Geschichte. Die offiziellen Erhebungen unterschätzen systematisch die tatsächliche Konzentration von Einkommen und Vermögen.
Warum die offiziellen Zahlen täuschen – und wem das nützt
Der sogenannte Top-Tail-Bias – die Unterschätzung der obersten Einkommens- und Vermögensschichten – führt zu einem verharmlosenden Bild. Der Gini-Koeffizient verfehlt die Spitzen, Befragungsdaten wie das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) erfassen Überreiche nicht, und Offshore-Vermögen bleiben meist auch außen vor. Diese Verzerrungen sind kein bloßes Statistikproblem, sondern sind beabsichtigt und haben politische Konsequenzen: Wenn Ungleichheit unsichtbar bleibt, fehlt der politische Druck zur Umverteilung.
Kapital schlägt Arbeit – und bleibt steuerlich privilegiert
Die funktionale Einkommensverteilung hat sich seit den 1990ern dramatisch verschoben: Die Lohnquote sank, Kapitaleinkommen wuchsen überproportional. Zugleich wurde das Steuersystem so umgebaut, dass hohe Einkommen aus Kapital- und Unternehmensgewinnen steuerlich begünstigt bleiben. Die Erbschaftsteuer – ohnehin gering – wird für Großvermögen nahezu außer Kraft gesetzt.
Ideologie des Reichtums: Warum Ungleichheit verteidigt wird
Zahlreiche Stimmen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft rechtfertigen nicht nur den Reichtum, sondern auch dessen politische Dominanz. Der Ökonom Thomas Straubhaar nennt die Erbschaftsteuer einen „Angriff auf die bürgerliche Gesellschaft“.
Brun-Hagen Hennerkes, langjähriger Chef der Stiftung Familienunternehmen, feierte im Jahr 2012 die weitgehende Steuerbefreiung unternehmerischer Erbschaften als gemeinschaftlichen Erfolg: „Wir können uns alle gegenseitig gratulieren, denn die jetzige Regelung dient dem Gemeinwohl“, so Hennerkes im SPIEGEL-Interview[1].
Friedrich A. von Hayek – Vordenker des Neoliberalismus – ging noch weiter und forderte eine Einschränkung demokratischer Macht, um „populistische“ Umverteilung zu verhindern. Er übte grundsätzliche Demokratiekritik aus liberaler Perspektive. In Law, Legislation and Liberty (1979) und anderen Schriften plädierte er für eine Einhegung der Demokratie, um diese vor vermeintlich zerstörerischen Gleichheitsbestrebungen zu „schützen“. In einem vielzitierten Wirtschaftswoche-Interview von 1981 machte Hayek klar, dass ungleiche Ergebnisse für ihn nicht nur hinnehmbar, sondern wünschenswert seien. Wörtlich stellte er fest:
„Ungleichheit ist nicht bedauerlich, sondern höchst erfreulich. Sie ist einfach nötig.“
Unterschiedliche Leistungsentgelte seien der Antrieb, „der das Sozialprodukt erst entstehen lässt“.
Diese Aussagen folgen einem einheitlichen Muster: Eigentum geht vor Gleichheit. Der politische Einfluss großer Vermögen wird dabei nicht als Störung, sondern als notwendige Schutzwehr gegen staatliche „Gleichmacherei“ legitimiert.
Arm bleibt, wer nicht zählt: politische und kulturelle Blockaden
Seit den Hartz-Reformen der Agenda 2010 wurde Armut zunehmend individualisiert und moralisch aufgeladen – wer bedürftig ist, gilt als „selbst schuld“. Gleichzeitig zeigen Daten, dass viele Bedürftige ihre Ansprüche nicht geltend machen – aus Scham, Misstrauen oder wegen bürokratischer Hürden. Politisch ist die Bekämpfung von Armut kein vorrangiges Ziel – weder bei der Haushaltspolitik noch bei steuerlichen Reformen. Auch der öffentliche Diskurs trägt zur Unsichtbarkeit bei: Armut wird meist punktuell thematisiert, aber strukturell ignoriert.
Demokratische Lücke: Warum Ungleichheit zur Systemfrage wird
Demokratie lebt von informierter Öffentlichkeit, politischer Gleichheit und sozialem Zusammenhalt. Doch die wachsende Ungleichheit höhlt all das aus. Wer reich ist, hat nicht nur mehr ökonomische Ressourcen, sondern auch mehr Einfluss auf Medien, Parteien und Politik. Wer arm ist, bleibt unsichtbar – in der Statistik wie in der Repräsentation. Die Folge ist eine gefährliche „demokratische Lücke“, in der Entscheidungen zunehmend von Eliten geprägt werden.
Ausblick: Für eine neue Verteilungsethik
Wenn Politik das Gemeinwohl wieder ins Zentrum rücken will, braucht es mehr als kosmetische Sozialreformen. Es braucht eine demokratische Revision der Eigentumsverhältnisse – mit fairer Besteuerung, echter Teilhabe und transparenter Verteilung. Dafür müssen sowohl die statistischen Instrumente als auch die politische Erzählung von Reichtum und Armut überarbeitet werden. Denn nur wer sieht, wie groß die Ungleichheit wirklich ist, kann sie auch wirksam bekämpfen.
Die politische Kultur Deutschlands ist geprägt von einem tief verankerten Willen zur Nichtumverteilung. Diese Haltung ist nicht bloß das Ergebnis von Ignoranz oder Denkfaulheit – sie wird aktiv vertreten, ideologisch gestützt und medial abgesichert. Die Gleichsetzung von Eigentum und Freiheit, die Stigmatisierung von Umverteilung als Neid oder Sozialismus und die faktische Steuerfreiheit großer Erbschaften zeigen: Die Demokratie in Deutschland ist längst keine egalitäre mehr. Es ist ein System, in dem die Macht des Geldes zur Macht über Regeln geworden ist.
Die Bundesrepublik nähert sich einer neuen Form der Feudalität – nicht, weil das Recht abgeschafft würde, sondern weil es strukturell asymmetrisch wirkt: nach oben schützend, nach unten fordernd.
Wer das ändern will, muss die politische Macht des Eigentums thematisieren – und sich dem Mythos verwehren, Ungleichheit sei der Preis für Leistung. In Wahrheit ist sie längst der Preis für eine Wahloligarchie zur Wiedererrichtung einer feudalen Herrschaftsordnung – oder, einfacher: für politische Willensbildung im Sinne der Besitzenden.
Titelbild: Tyler Olson / Shutterstock
[«1] Titel: “Warum sollen Reiche dümmer sein als andere?”
Autorin: Susanne Amann
Datum: 07.05.2012
Veröffentlichung: SPIEGEL ONLINE
Im Interview verteidigt Hennerkes die Erbschaftsteuerprivilegien für Familienunternehmen mit dem Satz:
„Wir können uns alle gegenseitig gratulieren, denn die jetzige Regelung dient dem Gemeinwohl.“