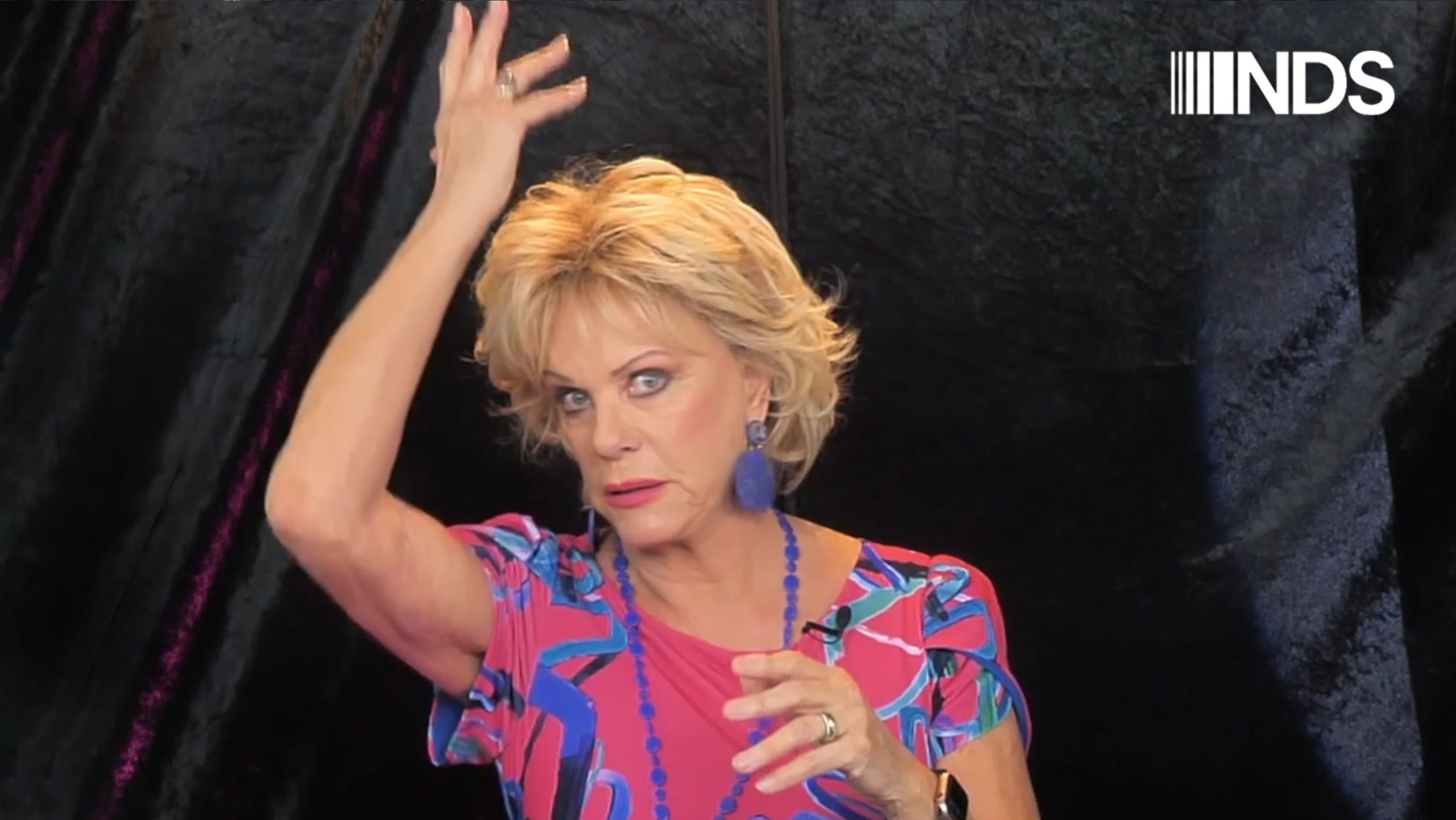Bahn-Chef Richard Lutz muss gehen. Sein bis 2027 datierter Vertrag wird vorzeitig aufgelöst. Lutz soll den Konzern noch so lange führen, bis ein Nachfolger gefunden ist. Aber „die Suche nach einem neuen Bahnchef, einer neuen Bahnchefin hat mit diesem Augenblick begonnen”, sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) am vergangenen Donnerstag. Von Rainer Balcerowiak.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Überraschend kommt dieser Rauswurf nicht. Eher ist man verwundert, dass er nicht schon viel früher erfolgte. Als Lutz, der seit 1994 im Bahn-Konzern tätig war, im März 2017 zum Vorstandsvorsitzenden berufen wurde, befand sich das bundeseigene Unternehmen bereits in einem katastrophalen Zustand. Seit der 1994 erfolgten Umwandlung der Deutschen Bundesbahn in eine Aktiengesellschaft und der politisch vorgegebenen Strategie, das Unternehmen zum Global Player der Logistikbranche zu machen und perspektivisch an der Börse zu platzieren, ging es steil bergab. Auf der einen Seite wurden seitdem zweistellige Milliardenbeträge mit fragwürdigen Investitionen in vielen Ländern (bis hin zur Transportlogistik für den australischen Weinexport) regelrecht verbrannt. Und auf der anderen Seite wurde der DB AG in ihrem eigentlichen Kerngeschäft – dem Schienentransport von Menschen und Gütern in Deutschland – ein rigoroses „Sparprogramm“ verordnet.
Die Infrastruktur – Schienen, Weichen, Stellwerke, Signalanlagen, Bahnhöfe, Ladepunkte für den Güterverkehr, Teile des rollenden Materials usw. – wurde buchstäblich zu Schrott gefahren, dringend notwendige Investitionen in die Ertüchtigung und Modernisierung des Systems blieben aus, Personal wurde abgebaut. Und wenn die DB AG ihre Milliarden mal nicht irgendwo im Ausland verbrannte, dann kaprizierte sie sich auf verkehrspolitisch sinnlose Renommierprojekte wie das Milliardengrab „Stuttgart 21“ oder den Ausbau einzelner Hochgeschwindigkeitsstrecken ohne deren Vertaktung mit Anschlusszügen. Und das Gesamtsystem Schiene wurde derweil immer maroder.
Lutz stand 2017 also vor einem Scherbenhaufen und versprach Besserung in allen zentralen Problemfeldern, also Digitalisierung, bessere und vor allem zügigere Planung und Realisierung von Bauarbeiten zur Sanierung und zum Netzausbau, rasche Modernisierung der Infrastruktur, besserer Service und vor allem mehr Pünktlichkeit. Zudem sollten die Voraussetzungen geschaffen werden, um bis 2030 einen „Deutschland-Takt“ nach Schweizer Vorbild einführen zu können – mit höherer Taktfrequenz bei den Hauptverbindungen und entsprechender Anbindung von Zubringerlinien im Regionalverkehr.
Immer neue Unpünktlichkeitsrekorde
Nicht nur davon ist inzwischen keine Rede mehr. Lutz hat die von ihm formulierten ambitionierten Ziele, die er bis zuletzt auf allen Bilanzpressekonferenzen wie ein Mantra vor sich her brabbelte, nicht nur nicht erreicht – vieles ist sogar noch deutlich schlimmer geworden. So sank die Quote der Fernzüge, die pünktlich bzw. mit maximal sechs Minuten Verspätung unterwegs waren, aktuell auf 56,1 Prozent, wobei ausgefallene Züge – jährlich über 100.000 – dabei noch gar nicht erfasst sind. Noch vor wenigen Monaten hatte Lutz für dieses Jahr einen „Zielkorridor zwischen 65 bis 70 Prozent“ bei der Pünktlichkeit angekündigt. Bei seinem Amtsantritt 2017 lag die Pünktlichkeitsquote noch bei 78,5 Prozent. Zwar wurde und wird jetzt einiges umfassend saniert, wie etwa die Riedbahn zwischen Frankfurt/M. und Mannheim und die Strecke Berlin-Hamburg, doch insgesamt pfeift die Infrastruktur nach wie vor auf dem letzten Loch und es fehlt überall Personal.
Lutz und mit ihm der gesamte DB-Vorstand haben es ferner geschafft, das innerbetriebliche Klima nachhaltig zu vergiften, vor allem im operativen Schienenverkehrsbereich. Die Überstundenberge wachsen und wachsen, die Arbeitsbedingungen haben sich teilweise deutlich verschlechtert. Und während die Konzernspitze versuchte, den Gewerkschaften einen „Sanierungstarifvertrag“ nach dem anderen aufzudrücken, hat sich der Vorstand trotz miserabler Bilanz millionenschwere „Erfolgsboni“ bewilligt. „Seit Jahren müssen wir zusehen, wie der Bahnvorstand ein System der skrupellosen Selbstbedienung immer weiter pervertiert und perfektioniert“, sagte dazu der damalige GDL-Vorsitzende Claus Weselsky im Dezember 2023 dem Spiegel, und weiter: „Trotz miserabler Zahlen macht sich das Management auf Kosten seiner Mitarbeiter die Taschen voll. Die Verkehrspolitiker, egal welcher parteipolitischen Couleur, schauen dabei zu.“ Das befeuerte auch einen der härtesten und langwierigsten Tarifkämpfe im Konzern, bei dem die GDL nach zahlreichen Streiks die stufenweise Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich durchsetzen konnte – was Lutz noch wenige Wochen vor dem Abschluss kategorisch ausgeschlossen hatte.
Lutz darf jetzt noch als „lame duck” auf seinem Posten weiterwursteln, bis die politischen Entscheidungsträger einen Nachfolger gefunden haben. Anschließend kann sich der 61-jährige Manager auf 2,4 bis 2,8 Millionen Euro Abfindung freuen und ein paar Jahre später eine üppige Pension im mittleren sechsstelligen Bereich genießen. Die Suche nach einem Nachfolger dürfte nicht ganz einfach sein. Eine interne Lösung kommt angesichts der Mitverantwortung des gesamten Bahn-Managements an der desaströsen Lage wohl nicht in Frage. Lutz war ja so eine Lösung. Vor seiner Berufung zum Vorstandsvorsitzenden war er als Finanzvorstand tätig. Und ob sich Top-Manager mit ausgewiesener Schienenverkehrsexpertise so einfach für den Spitzenjob bei diesem maroden Konzern begeistern lassen, ist ziemlich fraglich.
So berechtigt der Rauswurf des gründlich gescheiterten Bahn-Chefs Richard Lutz auch sein mag – viel mehr als ein Bauernopfer ist das zunächst mal nicht. Denn kein Manager der Welt könnte einen bundeseigenen Konzern, für den letztlich die jeweilige Bundesregierung – allen voran das Verkehrsministerium – die verkehrspolitischen Leitplanken und finanziellen Rahmenbedingungen setzt, mal eben locker auf einen vernünftigen Kurs bringen. Vielmehr muss die gesamte Schienenverkehrspolitik und mit ihr auch der gesamte dysfunktionale Konzern mit seinen über 200 Tochterfirmen vom Kopf auf die Füße gestellt und radikal umgekrempelt werden.
Grundprämisse müsste dabei sein, den Schienenverkehr ohne Wenn und Aber als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge zu begreifen, als zentrale Säule der öffentlichen Mobilität und einer ökologisch und logistisch gebotenen Verkehrswende. Grundlage dafür ist die Infrastruktur, die komplett aus dem Konzerngeflecht und dessen Finanzströmen herausgelöst und in unmittelbare staatliche Trägerschaft überführt und auskömmlich finanziert werden muss. Angesichts des maroden Zustands ist es eine Herkulesaufgabe, das System wieder auf hohem Niveau funktionstüchtig zu machen; damit die Bahn wieder ihrem eigentlichen Bestimmungszweck dienen kann: Menschen (und auch Güter) pünktlich, komfortabel und mit bundesweit getakteten Umsteigeverbindungen von A nach B zu bringen.
Natürlich gibt es noch weitere große Baustellen, die die Struktur des Konzerns betreffen, aber ohne eine Fokussierung auf die Infrastruktur bleibt alles Stückwerk. Womit wir wieder bei der politischen Verantwortung wären. Und da stehen die Zeichen eben nicht auf sozialer Daseinsvorsorge und Infrastruktur, sondern auf Kriegswirtschaft, und das auch langfristig. Dauerhaft sollen, wenn die „Sondervermögen“ verballert sind, fünf Prozent des BIP, das entspricht 43 Prozent des Bundeshaushalts, in die Aufrüstung fließen. Und wer immer künftig an der Spitze der Deutschen Bahn AG stehen wird – das ist sein Rahmen.
Berlin als „leuchtendes Beispiel“
Zum Schluss lohnt noch ein aktueller Blick in die deutsche Hauptstadt, wo die Berliner S-Bahn GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Deutschen Bahn AG, den seit vielen Jahren „normalen“ Krisenmodus überwunden hat. Denn jetzt steht das einst weltweit bewunderte und für den Berliner ÖPNV existenzielle System aus Stadtbahn, Ringbahn und Nord-Süd-Achsen regelrecht vor dem Kollaps.
Inzwischen fallen fast täglich Stellwerke und Signalanlagen aus – mit erheblichen Folgen für den Verkehr. Es handelt sich um Monumente einer längst überholten Technologie, die obendrein ziemlich verschlissen sind. Ihre „Sensoren“ melden in steter Regelmäßigkeit volle Gleise (obwohl die gar nicht voll sind), was zum Stopp der Züge führt. Dazu kommen auch regelmäßig Störungen durch – ebenfalls teilweise sehr betagte – Weichen. Am Montag waren zeitweilig 12 der 16 Berliner S-Bahn-Linien davon betroffen. Die Züge müssen dann mit einem komplexen manuellen Prozess durch die Engpässe geschleust werden. Das dauert und führt dann unweigerlich zu sich aufschaukelnden Verspätungen bis hin zur zeitweisen Einstellung ganzer Linien.
Probleme mit der Stellwerks- und Signaltechnik sind nichts Neues bei der S-Bahn, bei der jahrzehntelang „gespart“ wurde. Warum sich das jetzt extrem häuft, weiß anscheinend niemand so richtig. Eine Bahn-Sprecherin machte unter anderem „extreme Temperaturschwankungen“ (sic!) dafür verantwortlich. Und sie hatte frohe Kunde: Innerhalb der „nächsten zehn Jahre“ (sic!) sollen alle alten Stellwerke ausgetauscht werden. Um die akuten Probleme möglichst bald in den Griff zu bekommen, habe man ferner eine spezielle Gruppe aus Fachleuten gebildet, die den genauen Ursachen nachgehen und Lösungen finden soll. Und Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) lud am Mittwoch auch zu einem „Krisengipfel“ zum S-Bahn-Chaos, was dem rbb am Abend sogar eine Sondersendung wert ist. Die Nutzung der S-Bahn wird jedenfalls auf absehbare Zeit einem Lotteriespiel ähneln. Für Senatorin Bonde mag das alles ziemlich frustrierend sein, zumal sie längst auf visionären Pfaden unterwegs ist. Sie will für die chronisch klamme Stadt mal wieder eine Magnetschwebebahn bauen, man gönnt sich ja sonst nichts. Beruhigend ist allerdings, dass sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht neue Chefin der Deutschen Bahn wird.
Titelbild: NGCHIYUI / Shutterstock