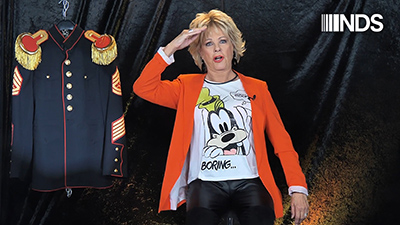Vom braunen Jucken – Ein Rückblick auf die Tat des Anders Behring Breivik
Zur Erinnerung: Am 22. Juli 2011 zündete der 32-jährige Norweger Anders Behring Breivik zunächst im Regierungsviertel in Oslo Bomben, wobei sieben Menschen ums Leben kamen. Dann fuhr er zur Insel Utoya und eröffnete das Feuer auf Jugendliche, die dort ihre Ferien in einem Lager der Norwegischen Arbeiterpartei verbrachten. Im Laufe von 60 Minuten erschoss er 69 Jugendliche. Ein Deutungsversuch von Götz Eisenberg
In der Frankfurter Rundschau vom 28. Juli 2011 findet sich ein ausführliches Interview mit Jostein Gaarder über die Auswirkungen des Massakers von Utoya. „Waren Sie je auf der Insel Utoya“, wird er gefragt und antwortet: „Ich habe sie oft aus der Ferne betrachtet, wenn ich im Auto auf der Straße am Festland an ihr vorbeifuhr. Aber ich war selbst noch nie dort. Es ist eine sehr schöne, grüne Insel, in einem kleinen See gelegen, 40 Minuten von Oslo entfernt. Die norwegische Arbeiterpartei richtet dort seit Jahrzehnten Sommer-Camps für Jugendliche aus. Das muss man sich als Kombination aus politischen Diskussionen und Vorträgen und eben Sommerferien vorstellen, mit allem was dazu gehört. Ich kenne viele Norweger, darunter auch einige bedeutende aus Politik und Gesellschaft, für die Utoya Teil ihrer Jugend ist, eben ein ganz besonderer Ort. Die einen haben dort ihre späteren Ehefrauen getroffen. Für andere war es der Ort, wo sie sich zum ersten Mal verliebten oder das erste Mal Fußball spielten.“
Nachdem ich dieses Interview und vor allem die eben zitierte Passage gelesen hatte, erschloss sich mir eine Dimension der Tat des Anders Behring Breivik, die so in den mir bekannten Deutungsversuchen bisher nicht zur Sprache gekommen ist. Utoya wird in Norwegen auch „Insel der Liebe“ genannt, es gilt als der beste Ort zum Verlieben. Da wachsen nicht nur die Sozialisten der Zukunft heran, sondern da wird auch gevögelt, da vermischen sich die Leiber! Ein freier Geist wohnt in einem befreiten Körper, wie schon Wilhelm Reich wusste. Klar, dass da einem verklemmten Zeitgenossen wie Anders Breivik das Messer in der Tasche aufgeht – wenn ihm schon nichts anderes aufgeht.
Es genügt nicht, den Kopf voller rechter oder faschistischer Gedanken zu haben, man muss auch über ein gehöriges Potenzial an Hass verfügen, das die Ideen scharf macht und ihren Träger zur Tat drängt. Manchmal sind die Ideen allerdings nur eine Art nachproduziertes Alibi, ein ideeller Überbau, der die Funktion hat, den an sich reinen, frei flottierenden Hass zu rechtfertigen. Auch Täter wie Cho Sueng-Hui, der 2007 in Virginia 32 Studenten erschoss, oder Sebastian B. aus Emsdetten, der 2006 in seiner ehemaligen Schule um sich schoss und Rauchbomben zündete, haben Texte hinterlassen, in denen sie ihre Weltsicht kund taten und ihr Handeln zu erklären versuchten, wenn auch nicht in der akribischen und graphomanischen Form wie Anders Breivik. Aber die Kausalität zwischen Ideologie und Tat ist nicht unmittelbar und ungebrochen. Man kann auch so denken, ohne zum Massenmörder zu werden, und man kann zum Massenmörder werden ohne jeden rechten und menschenverachtenden Begleittext. Das politische Handeln ist mitunter nur die Maske eines seelischen Geschehens, oder wenn man lieber will: Der militante Anti-Islamismus ist in diesem Fall das Mittel, eine unerträgliche innere Leere und Strukturlosigkeit zu überwinden und ein an seiner männlichen Identität zweifelndes Milchgesicht zum Mann zu machen.
Energetisch werden amokartige Taten wie diese von Hass angetrieben. Was aber ist Hass und woher stammt er? Es ist, wie Theweleit und auch Glucksmann gezeigt haben, ein Hass auf Teile der eigenen Person, auf abgewehrte und mühsam in Schach gehaltene eigene Triebwünsche und Begierden. Und vor allem Hass auf Frauen, der die Faschisten aller Länder und Zeiten umgetrieben hat und bis heute um- und antreibt.
Gleich in den ersten Kapiteln seines Manifestes verurteilt Breivik die Idee von der Gleichberechtigung der Menschen, insbesondere der von Mann und Frau, die Freundschaft unter Rassen, Völkern und Kulturen sowie die offene Gesellschaft – aus all diesen Gründen sind die Sozialdemokraten, die für diese Ideen stehen, für ihn die Inkarnation alles Schrecklichen. Der Kampf, in den Breivik sich verwickelt sieht, findet aber vor allem in ihm selbst statt. Er ist eine Abwehrschlacht gegen triebhafte Impulse und durch sie ausgelöste Ängste. Er wendet sich, wie alle Faschisten, gegen die Vermischung der Rassen und Kulturen und träumt von der Reinheit und Homogenität des Volkskörpers.
Breivik entstammt einer Mittelklassefamilie. Der Vater ist ein der Sozialdemokratie nahestehender Diplomat, die Mutter Krankenschwester. Kurz nach der Geburt des Sohnes verlässt der Vater die Familie und wendet sich einer anderen Frau zu. Anders Breivik wächst bei der Mutter und dem Stiefvater auf. Vor dem Attentat lebt er wieder eine Zeitlang bei der Mutter. Auch als er woanders wohnt, kommt er jeden Sonntag zur Mutter zum Essen. Beruflich erleidet er in den letzten Jahren mit verschiedenen Projekten Schiffbruch. Beziehungen zu Frauen sind nicht bekannt. Nachbarn schildern ihn als schüchtern, ruhig und zurückhaltend. Dieses Profil teilt er mit den jungen Amokläufern der letzten Jahre. Wie viele zeitgenössische Massenmörder und Amokläufer trainiert auch Anders Breivik sich an der Spielkonsole beim Spielen von Ego-Shootern das Mitleid ab. Auf die Anschläge bereitet er sich mit dem Kriegsspiel „Modern Warfare 2“ vor. Mit 25 nimmt er sich eine Auszeit und spielt intensiv „World of Warcraft“. Auf diesem Weg verschafft er sich die nötige Grundhärte für das geplante Massaker. Während des systematischen Tötens auf der Insel trägt Breivik einen Stöpsel im Ohr und hört über einen iPod Musik. Er hat sich in eine Gamefigur verwandelt und auch die Choreographie seines Vorgehens scheint von Ego-Shootern inspiriert. Breivik kommt mir vor wie eine Kreuzung aus einem Freikorpsmann der 1920er Jahre und einem zeitgenössischen School-Shooter. Mit jenem teilt er die Verbräunung seines Hasses und den Rassismus, mit diesem den medialen Narzissmus und den Wunsch berühmt zu werden.
Das Manifest, das ich nur in Auszügen kenne, scheint mir das nachträglich verfasste Libretto zu einer Melodie zu sein, die Breivik schon lange in sich trug. Es ist der Versuch einer Versprachlichung eines Konflikts, für den ihm letztlich die Worte fehlen und den er sprachlich nicht wegarbeiten kann. Er scheint von Verschlingungsängsten umgetrieben zu werden, Wiederverschlingung durch eine präödipale, symbiotische Mutter, von der ihm die Ablösung nie wirklich gelang. Da sich der Grundkonflikt seinem Bewusstsein entzieht, werden seine Konturen und Themen in die Welt projiziert. Europa wird vom Islam überflutet und überschwemmt, der „Kulturmarxismus“ und „Multikulturalismus“ liefert Europa an seine Vernichter aus. Wie König Herodes, als er von der Geburt eines neuen Königs der Juden erfuhr, in Bethlehem alle Knaben unter zwei Jahren töten ließ, so tötet Anders Breivik auf der Insel Otoya den Nachwuchs der Norwegischen Arbeiterpartei, die sich in seinen Augen als Steigbügelhalter des Islam und des „Kulturmarxismus“ betätigt. War nicht auch der amtierende Ministerpräsident Stoltenberg einst hier in einem Sommerlager gewesen? Wenn er alle Jugendlichen tötet, würde er auch den künftigen Stoltenberg erwischen.
Die Frauen, schreibt er, sollte man „vor die Alternative stellen, Nonne, Prostituierte oder Mutter zu werden“. Mühsam errechnet er einen Quotienten für den Grad der Sexualmoral der Frauen in 17 europäischen Ländern und den USA. Skandinavien schneidet dabei erwartungsgemäß sehr schlecht ab. Er hat Sehnsucht nach der Rückkehr der Prügelstrafe für Kinder und des Patriarchats. Es sind im Kern die gleichen Motive und Themen, die Theweleit aus den Texten der Freikorps-Soldaten herauslas: Es sind Muttersöhnchen, die durch eine zur Schau gestellte Männlichkeit und Gewalt beweisen wollen, dass sie keine Memmen und Schwuchteln sind. Durch eine leib-seelische Panzerungen schützen sie sich vor Desintegration und psychischer Fragmentierung. Wer Täter wie Breivik verstehen will, sollte den Staub von Theweleits „Männerphantasien“ blasen und sich der Mühe unterziehen, die beiden Bände noch einmal zu lesen. Wir müssen diese Täter zu verstehen versuchen, wenn wir ihnen ernsthaft begegnen und etwas entgegensetzen wollen. An Theweleit und Lloyd deMause geschult, käme es darauf an, die affektive Struktur ihrer Texte zu entschlüsseln und die in ihren Begriffen und Metaphern chiffriert zur Sprache gebrachten Körpergeheimnisse zu enträtseln.
Alle seine Intellektualisierungen und graphomanischen Rationalisierungen sind nur Chiffren für innere Ängste, seine wahnhaften paranoiden Verfolgungsphantasien verweisen auf seine eigenen aggressiven Bestrebungen: Alles, was er draußen von irgendwelchen finsteren, islamischen Mächten befürchtet, möchte er gern selbst anrichten und hat es dann ja auch angerichtet. Wenn es könnte, würde das in symbiotischer Gefangenschaft gehaltene Kind in seiner unermesslichen Wut die ganze Welt in die Luft sprengen. Der Erwachsene versucht es.
Es gibt, wie Nietzsche bereits wusste, so etwas wie einen Juckreiz unterdrückter Gefühle, der von einer übertriebenen Selbstbeherrschung ausgelöst wird: Das, was man in sich selbst verbissen und krampfhaft niederhält, setzt man aus sich heraus und bekämpft es dort in Gestalt von Minderheiten und Abweichlern oder allem, was einem fremd vorkommt. Äußeres weist innen auf Verschüttetes – und das im Innern Verschüttete gibt keine Ruhe und heftet sich außen an Objekte, die es symbolisieren.
Das niedergedrückte und beschädigte Leben brütet über seinen Kompensationen und sinnt auf Rache. Auf der Basis eines an seiner Entfaltung gehinderten, durch pädagogische Dressur partiell getöteten Lebens entwickelt sich eine Tendenz, sich am Anderen schadlos zu halten und zu verfolgen, was einem lebendiger vorkommt: „Der da, der reißt sich nicht so zusammen wie ich!“ Spielerisch-provokant hat diesen Mechanismus eine Berliner Punkerin entlarvt, die in den Anfangsjahren der Punk-Bewegung mit ihrem schrillem Outfit und bunten Haaren in ein Taxi einstieg und vom Fahrer gefragt wurde: „Wat bist‘n du für eene?“. Sie antwortete ihm: „Gestatten, ich bin Ihr Trieb!“
Ressentiments und Feindseligkeit schlagen dem um sein Glück Betrogenem aus allen Poren. Auf Anzeichen von einem Mehr an Glück und Lebendigkeit wird er mit Härte und Grausamkeit reagieren. „Gleiches Unrecht für alle“, avanciert zur unausgesprochenen Maxime seines ungelebten Lebens. Der Faschismus setzte dieses Ressentiment politisch in Gang, er war und ist psychodynamisch die Wiederkehr des Verdrängten: „Wenn die toten Wünsche auferstehen, werden sie verwandelt in die Masse der Umzubringenden“, heißt es bei Theweleit.
In dem Maße, wie wir Objekt und Opfer solcher Erziehungsprozesse geworden sind, sind wir alle partiell Getötete und tragen in uns den Widerstreit des Toten mit dem Lebendigen aus. Ein Teil von uns ist durch haltende, schützende und wärmende Körper und frühe Liebesobjekte belebt und bewohnt, der andere durch Abwesenheiten, Strafen, Kälte und Verlassenheit unbewohnt, entlebendigt, anästhesiert, im Extremfall totgestellt. Zwischen diesen beiden in uns miteinander ringenden Prinzipien herrscht kein ruhiges, homöostatisches Gleichgewicht und jeder Mensch muss sich entscheiden, welches von beiden die Oberhand über sein und in seinem Leben gewinnen soll. Entscheidet man sich nicht, hat man sich auch entschieden: Der Überhang der gesellschaftlichen Objektivität, der aufgehäuften und zu Kapital gewordenen toten Arbeit der vergangenen Generationen wird dafür sorgen, dass im Zustand scheinbarer Balance das tödliche Prinzip den Sieg davonträgt. Affirmation ans Tote oder Emanzipation, auf diese existentielle Frage antwortet jeder mit seinem Lebenslauf.
Die Erzeugung des Menschlichen ist das Kriterium von Emanzipation, weniger die abstrakte politische Entscheidung zwischen links und rechts. Geschichtliche Erfahrungen haben uns schmerzhaft darüber belehrt, dass auch vermeintlich linke Entwürfe in den Sog einer tödlichen und todbringenden Produktionsweise geraten können, wenn sie sich von der regulativen Idee der Emanzipation als der Erzeugung des Menschlichen allzu weit entfernen. Es gibt in Gestalt des Toten in uns einen fortdauernden Faschismus weit unterhalb des Kopfes, einen Faschismus der Gefühle oder der Gefühllosigkeit, der uns zu einem lebenslangen Austrag des Kampfes nötigt. Wer resigniert und sich der Schwerkraft des Realen überlässt, gibt dem Toten in sich Raum zur Entfaltung, das sich mit dem Überhang des Toten draußen mannigfach verflicht und durch dieses gestützt wird. „Der Tod tritt ein, wenn das Leben nichts mehr hat, das es zu verteidigen gilt“, schreibt John Berger in seinem Buch „Mit Hoffnung zwischen den Zähnen“.
Die Tat des Anders Behring Breivik hat uns daran erinnert, dass es nach wie vor so etwas gibt wie Klassenkampf und dass dieser von der Gegenseite mit aller Härte und Brutalität und ohne jede Rücksichtnahme geführt wird. Der Kampf hat eine Innenseite, in der es um die innerpsychische Hegemonie des Lebendigen über das Tote oder des Toten über das Lebendige geht und nicht um höhere Produktivität und die proletarische Kontrolle einer immer effektiveren Ausbeutung der Natur. Zwischen Achtung und Verachtung des Lebendigen verläuft die Trennungslinie, nicht zwischen Links und Rechts, dem veralteten bürgerlichen Gegensatz, dessen Austrag immer nur neue Varianten von Macht und Naturbeherrschung hervorbringt und die Dominanz des Toten über das Lebendige zu verewigen droht. Gegen den tödlichen Hass der Faschisten können wir nur auf die Energien der Lebenstriebe und die Entwicklung einer sinnlichen Vernunft setzen, die die Aggressivität, Brutalität und Hässlichkeit der etablierten Lebensweise nicht länger zu ertragen vermag.
Das Vorurteil fungiert als ein „Schlüssel, um eingepresste Bosheit loszulassen“, schrieb Max Horkheimer. Wenn es uns also darum zu tun ist, eine versöhnte Gesellschaft zu errichten, käme es darauf an, gesellschaftliche Lebensverhältnisse zu schaffen, unter denen den Menschen weniger Bosheit eingepresst wird als heute und in deren Rahmen sie Fremde und das Fremde nicht mehr fürchten müssten. Ob das gelingt, hängt entscheidend davon ab, wie die Gesellschaft mit ihren nachwachsenden Generationen umgeht. Es kommt darauf an, Bedingungen zu schaffen, unter denen Kinder ihre „psychische Geburt“ (Margaret Mahler) vollenden und zu wahren Menschen mit menschlichen Eigenschaften und Fähigkeiten heranwachsen können. Nur so bilden sich die psychischen Voraussetzungen wahrhafter Demokratie aus, die vor allem in der Fähigkeit bestehen, mit Ambivalenzen, Schwebezuständen, offenen Fragen und Konflikten umgehen zu können. Diese reifen, gewissermaßen dialektischen Subjekt- und Ich-Funktionen, die Menschen instand setzen, unlösbare Widersprüche prüfend in der Schwebe zu belassen, Dissens und Verschiedenheit zu ertragen, nach Kompromiss und vernünftigem Ausgleich zu suchen, stehen auf dem Spiel oder bilden sich zurück, wenn Massen von Menschen unter dem Druck von Angst und aufkeimender Wut auf einfachere Mechanismen der psychischen Regulation regredieren. Das ursprünglich schwache Ich gewinnt seine Stärke erst aus einem nicht-selektiven Umgang mit einer ambivalenten Umgebung, und droht unter Spannung und Stress auf die Ebene archaischer Spaltungen zurückzufallen.
Auch unter durchschnittlichen Erwachsenen bleibt das Bedürfnis wirksam, unerträgliche Spannungszustände und kognitive Dissonanzen durch Spaltung und Projektion zu entschärfen. Wenn die Unübersichtlichkeit eskaliert und die Wirklichkeitskonstruktionen unter dem Einbruch von allzu viel Unvertrautem, das sich den gewohnten Wahrnehmungsweisen und Deutungsmustern nicht fügt, zu erodieren drohen, schlägt die Stunde der populistischen Vereinfacher und Fanatiker. An den Grenzen zum Anderen radikalisieren sich die Differenzwahrnehmungen, und man versucht, die gefährdete eigene Identität dadurch zu retten, dass man, was nicht sichtlich Seinesgleichen ist, auszugrenzen und zu bekämpfen beginnt. Das Bild des „Bösen“, das den verunsicherten Menschen in Gestalt des jeweiligen Sündenbocks im Innern und des Feindes im Äußeren präsentiert wird, ist das beste Gefäß für alle möglichen diffusen Bedrohtheitsgefühle. Weil unter der Schicht normalen, angepassten Verhaltens primitive internalisierte Objektbeziehungen und um die Spaltung gruppierte Abwehrmechanismen latent fortbestehen, geraten Demokratie, Rechtsstaat und Vernunft in Krisenzeiten regelmäßig in Gefahr. Ein gewisses Maß an sozialer Sicherheit und Angstfreiheit ist unabdingbare Voraussetzung einer demokratischen Gesellschaft.