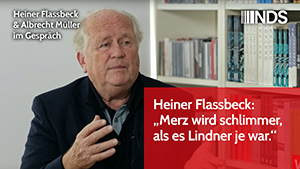Mit dem Angriff Israels und kurz darauf der USA auf den Iran entdeckten ein paar Schlaumeier, dieser militärische Angriff stelle einen Bruch oder könnte einen Bruch des Völkerrechts darstellen. Für manche schien es wohl der erste Völkerrechtsbruch des Westens überhaupt zu sein. Damit lagen sie zumindest noch vor den Ignoranten, die selbst diesen Angriff auf den Iran noch als völkerrechtlich gedeckt sehen und eine Rechtskonformität des Angriffs herbeiillusionieren wollen. Von Alexander Neu.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Besonders erheiternd empfand ich einen politikwissenschaftlichen Beitrag hierzu in einem der führenden US-amerikanischen Fachmagazine für außen- und sicherheitspolitische Fragen – Foreign Affairs – mit dem zunächst richtigen Titel „Might Unmakes Right – The Catastrophic Collapse of Norms Against the Use of Force“ („Macht zerstört Recht – Der katastrophale Zusammenbruch von Normen gegen die Anwendung von Gewalt“) angesichts der Trump‘schen Außenpolitik mit Blick auf territoriale Ansprüche gegenüber Kanada, dem Gazastreifen und Dänemark (Grönland); ganz so, als ob der Bruch grundlegender internationaler Normen wie des Gewaltverbots eine Erfindung des derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump sei. Zwar konzedieren die Autoren im Laufe des Beitrages noch das eine oder andere völkerrechtliche Fehlverhalten der USA, aber den möglichen Dammbruch sehen sie nur jetzt bei Donald Trump. Diese Darstellung über den erst jetzt erkennbaren Völkerrechtsnihilismus ist bei nüchterner Betrachtung nichts weniger als der äußerst durchsichtige Versuch, Sand in die Augen ihrer Leser zu streuen.
Den Schwachen vor dem Starken schützen
Die Wahrheit aber ist: Seitdem es das Völkerrecht gibt, wird es gebrochen; meist von den Starken gegenüber den Schwachen, obschon der rechtsphilosophische Gedanke hinter einer auf Recht basierten Ordnung (gemeint ist nicht die unsägliche „regelbasierte internationale Ordnung“) den Schwachen vor dem Starken schützen soll. Einer der großen politisch-ideengeschichtlichen Vordenker im Zeitalter der Aufklärung, der dieses formulierte, war der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau. In seinem Werk „Der Gesellschaftsvertrag“ forderte er das Primat des Rechts gegenüber dem anarchischen Naturzustand. Während im Naturzustand das Recht des Stärkeren gelte, müsse das Ziel einer staatlichen Rechtsordnung, die Gleichheit ihrer Bürger vor dem Gesetz und durch das Gesetz, gewährleistet sein. Somit schütze das Recht die Schwachen vor den Starken. Dieser von ihm formulierte Gesellschaftsvertrag lässt sich auch auf die internationale Politik übertragen: Statt Staatenanarchie mit dem Recht des Starken, mithin der Groß- und Supermächte, die den Krieg als legitimes Mittel der Interessendurchsetzung zur Grundlage hat, soll das Völkerrecht, also das Internationale Recht, schwache Staaten vor den starken schützen, also den Krieg als Mittel der Politik vermeiden, ächten, verbieten.
UNO als System der kollektiven Sicherheit und das wacklige Gewaltmonopol
Nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges wurde die UNO geschaffen. Es war ein erneuter Versuch, nach dem Scheitern des Völkerbundes in den 1930er-Jahren, die internationalen Beziehungen, die Anarchie der Staatenwelt zu verrechtlichen und zu institutionalisieren. Das Ziel war es, mit der UNO ein globales System der kollektiven Sicherheit zu schaffen, um den Krieg als „Geißel“ der Menschheit zu überwinden. Im Gegensatz zur staatlichen Verfasstheit existiert ein auf Recht basierendes Gewaltmonopol auf der internationalen Ebene nur rudimentär, da es keinen Weltstaat gibt. Das rudimentäre Element eines Gewaltmonopols, um überhaupt eine Handlungsfähigkeit der UNO herbeizuführen, ist der UNO-Sicherheitsrat als Entscheidungs- und Machtzentrum. Dieses zentrale Machtgremium trägt gemäß Art. 24 Abs. 1 der UNO-Charta die „Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit“. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, wurde dem UNO-Sicherheitsrat das ausschließliche Recht zuerkannt, eine „Bedrohung oder ein Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung“ festzustellen (Art. 39 UN-Charta) bzw. entsprechende Maßnahmen einschließlich der Anwendung von Gewalt (Art. 41 – 42 UNO-Charta) gegen den Rechtsbrecher anzuordnen, woraus dem Sicherheitsrat das Gewaltmonopol erwächst.
In diesem Sicherheitsrat sitzen die fünf permanenten Mitglieder: Frankreich, Großbritannien, USA, China und die Sowjetunion, später Russland – also die offiziellen Atomwaffenstaaten. Die Schaffung dieses Entscheidungszentrums und besetzt durch die damaligen – teilweise bis heute bestehenden – Großmächte war und ist ein Kompromiss zwischen drei Polen:
Der erstens auch in der UNO-Charta fixierten souveränen Gleichheit (Artikel 2, Abs. 1 UNO-Charta) aller Staaten, zweitens der Notwendigkeit eines wie auch immer gearteten Gewaltmonopols der UNO und drittens den realen Machtverhältnissen auf dem Globus nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Und dass das Gewaltmonopol von den Großmächten beansprucht wurde und wird und nicht durch Wahlen der Gesamtheit der Mitglieder der UNO, ist eben den realpolitischen Machtverhältnissen geschuldet.
Und, wie effektiv das ohnehin nur rudimentäre Gewaltmonopol auf politischer Ebene, also im UNO-Sicherheitsrat, funktioniert, hängt ausschließlich von der jeweiligen Interessenkonstellation der fünf permanenten Sicherheitsratsmitglieder ab. Besteht eine umfassende Einigkeit, ist der Sicherheitstrat politisch handlungsfähig. Besteht die Einigkeit nicht, so kann mit Hilfe des Vetos ein Beschluss blockiert werden. Über die Frage, ob das Vetorecht noch zeitgemäß oder überhaupt sinnvoll ist, scheiden sich die Geister. Es wäre ein ganz eigener und sehr umfänglicher Beitrag, der hier indessen nicht abgehandelt werden kann.
Die UNO als dem Anspruch nach Garant der kollektiven Sicherheit besitzt entgegen der fixierten Zielsetzung in der Charta (Artikel 43 UNO-Charta) kein eigenes Schwert zur Durchsetzung des Rechts.
Dieses Schwert wurde jedoch von Anfang an nicht dem UNO-Sicherheitsrat an die Hand gegeben, da sich die Staaten nicht bereit erklärten, der UNO auch faktisch Truppen unterzuordnen und somit ihre jeweilige Entscheidungs- und Befehlskompetenz über die Truppen an die UNO zu delegieren. Hierdurch kamen die Staaten ihrer Verpflichtung nicht nach, wodurch der Sicherheitsrat zum vorwiegend formalen und somit weitgehend impotenten Inhaber des Gewaltmonopols degradiert wurde, der in Anlehnung an Stalins Machtdefinition, wie viele Panzer denn der Papst habe, nicht die materielle Basis besitzt, das formale Gewaltmonopol auch praktisch durchzusetzen.
Wozu sich die Gründungsstaaten der UNO-Charta durchrangen, waren Ersatzlösungen, die bei genauerer Betrachtung der Gründungsphilosophie und dem Ziel der kollektiven Sicherheit eher zuwiderlaufen als diese erfüllen:
Die beiden Ersatzlösungen sind die freiwillige und temporäre Zurverfügungstellung militärischer Fähigkeiten und Truppen (Art. 48 und Art. 53. Abs. 1 UN-Charta)) – entweder als UNO-Blauhelmtruppen unter direktem UNO-Kommando (UNO-geführt) oder aber, und das ist der Schwerpunkt, als UNO-mandatierte Truppen, die von Truppenstellerstaaten auch selbst geführt werden und sich militärisch-operationell der Kontrolle der UNO faktisch entziehen. Die Trennschärfe zwischen vom UNO-Sicherheitsrat mandatierter Zwangsmaßnahme (Artikel 43, UNO-Charta) und der kollektiven Selbstverteidigung (Artikel 51 UNO-Charta) zur Unterstützung eines angegriffenen Staates, bei denen die helfenden Staaten mitunter auch eigene Interessen verfolgen, verschwimmt mitunter. Es ist schon auffällig, dass sich bei UNO-mandatierten Einsätzen gerne Großmächte und von Großmächten geführte Staatenkoalitionen so selbstlos anbieten, um ein UNO-Mandat durchzusetzen. Dabei geht es wohl weniger um internationale Solidarität und den Willen zur altruistischen Durchsetzung des UNO-Gewaltmonopols als vielmehr um die militärische Durchsetzung nationaler Interessen, legitimiert durch ein UNO-Mandat. Mit anderen Worten, das Völkerrecht, die UNO und ihre Charta sind der Gefahr der Instrumentalisierung ausgesetzt, indem staatlichen Partikularinteressen ein rechtliches Mäntelchen (UNO-Sicherheitsratsmandat) umgehängt wird. Das wäre das Recht des Stärkeren im rechtlichen Gewande.
Respektierung des Rechts
Aber auch ungeachtet der ultimativen Machtprojektion, also der Anwendung militärischer Mittel durch die UNO oder im Auftrage derselben, soll der Staatenverkehr unter dem Dach und im Rahmen des UNO-Rechts auch so vonstattengehen. Dies setzt selbstverständlich auch die Zuverlässigkeit gegenüber den Vertragspartnern, d.h. die Vertragstreue hinsichtlich der geschlossenen bilateralen und multilateralen Verträge voraus. Hierzu habe ich diese Rechtspyramide zur Visualisierung der unterschiedlichen Stufen der Zuverlässigkeit im Internationalen Recht entworfen:
Rechtspyramide
Die Bona-fide-Ebene („Treu und Glauben“ – auch in Artikel 2 Abs. 2 UNO-Charta fixiert) unterstellt ehrenhaftes Verhalten. Jeder Vertragspartner soll sich aufgrund der Ehre an den geschlossenen Vertrag bzw. die Rechtsnormen gebunden fühlen.
Der Rechtsgrundsatz der Pacta-sunt-servanda-Ebene unterstellt eine gewisse Rationalität zwischen den Vertragspartnern, aus langfristiger gegenseitiger Berechenbarkeit den Vertrag bzw. die Rechtsnormen zu respektieren. Diese gegenseitige Berechenbarkeit dient dem Wohle aller Vertragspartner. Der Ansatz wirkt auf den ersten Blick altruistisch, beherbergt jedoch einen rational-determinierten egoistischen Kern: Bin ich zuverlässig, so kann ich das von meinem Vertragspartner auch mir gegenüber erwarten.
Die materielle Ebene hingegen verweist auf die Kraft der puren Macht, sei es die polizeiliche (innerstaatlich), die militärische oder die wirtschaftliche Potenz (zwischenstaatlich) eines Staates.
Diese Macht ist es, die im Zweifelsfall die Respektierung des Rechts erzwingt. Zeithistorisch ist hier auf die Zeit der Bipolarität zu verweisen: Die militärische Macht beider Pole veranlasste beide Blöcke, die internationalen Rechtsnormen, wenn vielleicht nicht aus tiefer Rechtsüberzeugung, so doch aus Furcht vor der Vergeltung des anderen Blocks, weitgehend zu respektieren. Der NATO-Angriffskrieg auf Jugoslawien wäre unter den Bedingungen des Kalten Krieges mit hoher Wahrscheinlichkeit nur um den Preis eines Weltkrieges möglich gewesen.
Das Zeitalter der unipolaren Weltordnung verdeutlicht hingegen, dass mit der Abwesenheit der materiellen Gegenmacht die beiden übrigen Ebenen, die Vernunftebene und die Ebene der Ehre, kraftlos bleiben. Der zivilisatorische Gedanke, sich auch ohne Druck rechtskonform zu verhalten, unterliegt der Verlockung, sich in der Gunst der Stunde Vorteile zu verschaffen. Ein Blick in den Melierdialog des Thukydides aus der griechischen Antike offenbart, wie wenig die Menschheit sich doch unter dem zivilisatorischen Gesichtspunkt weiterentwickelt hat:
„(…) da ihr so gut wißt wie wir, daß im menschlichen Verhältnis Recht gilt bei Gleichheit der Kräfte, doch das Mögliche der Überlegene durchsetzt, der Schwache hinnimmt.“ (Thukydides: „Geschichte des Peloponnesischen Krieges“.).
Internationales Recht als Waffe der Großmächte statt der Schwachen
Das Recht, welches den Schwachen vor dem Starken schützen soll, kann auch in sein Gegenteil verkehrt werden.
Unter den Bedingungen der nun zu Ende gehenden unipolaren Weltordnung gab es zwei Möglichkeiten der Rechtsentwicklung:
Die Erste wäre die Wünschenswerte gewesen. Der Westen als Sieger des Kalten Krieges und globaler Hegemon für über 20 Jahre hätte sich an die Spitze der internationalen Rechtsordnung als deren ehrlicher Hüter setzen können. Die übrige Welt hätte sich dem wollend oder gezwungen anpassen können und müssen. Eine internationale Rechtsstaatlichkeit, nicht nur auf dem Papier der UNO-Charta, sondern auch gelebt, hätte etabliert werden können. Die Verbannung des Kriegs wäre auf lange Zeit zur Realität geworden. Die Menschheit hätte sich auf die realen Risiken und Gefahren konzentrieren können, wie Umwelt, Artenerhaltung, Klima, Gesundheit, Bildung und Armutsbekämpfung.
Und die andere Möglichkeit, die dann auch tatsächlich umgesetzt wurde: Die Sieger des Kalten Krieges nahmen die Trophäen und wollten der Welt ihre Ordnungsvorstellung aufzwingen, inklusive militärischer Machtprojektion – teils erfolgreich, teils misslungen. Das Internationale Recht wurde nicht gepflegt und vorbildlich gelebt, sondern ganz im Sinne der Denkschule des (Neo-)Realismus für die eigene Machtakkumulation instrumentalisiert. Ein Völkerrechtsbruch jagte den nächsten:
- Unterstützung der Sezessionsbestrebungen in Jugoslawien und diplomatische Anerkennung der jugoslawischen Teilrepubliken als neue Staaten.
- Völkerrechtswidriger NATO-Angriffskrieg auf die Bundesrepublik Jugoslawien zur gewaltsamen Herauslösung der südserbischen Provinz Kosovo, danach rechtswidrige diplomatische Anerkennung des Kosovo als Staat.
- Völkerrechtswidriger Angriff und Regime Change gegen den Irak 2003.
- Eigenmächtige Uminterpretation des UNO-Sicherheitsratsmandates zu Libyen 2011 mit anschließendem Regime Change.
- Rechtswidrige militärische Einsätze auf dem Staatsgebiet Syriens als Anti-IS-Einsatz deklariert.
- Und nicht zuletzt der Angriff Israels auf den Libanon sowie Israels und der USA auf den Iran.
- Und nicht zu vergessen die ebenfalls gemachten rechtswidrigen Handlungen Russlands, die den Rechtsbrüchen des Westens folgten, nachdem diese die Präzedenzfälle geschaffen hatten: diplomatische Anerkennung Süd-Ossetiens, Abchasiens, der östlichen und südlichen Territorien der Ukraine mit anschließender Annexion. Die völkerrechtswidrige Integration der Krim in die Russische Föderation sowie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine selbst.
Nun hörte ich im Bundestag wie auch von einigen Völkerrechtlern immer wieder das Argument: „Keine Gleichheit im Unrecht“, soll heißen, wenn Akteur A sich rechtswidrig verhält, ist das keine Berechtigung für Akteur B, es auch zu tun.
„Keine Gleichheit im Unrecht“ – Widerspruch
Dem halte ich Folgendes entgegen: Im innerstaatlichen Recht ist das tatsächlich so; wie sollte ein Staat auch anders funktionieren. Ansonsten bricht die Staatlichkeit zusammen. Aber, im innerstaatlichen Recht einer repräsentativen Demokratie ist zwischen Rechtssetzenden und Rechtsunterworfenen dahingehend zu unterscheiden, dass zwar alle Rechtsunterworfene, aber nur einige Hundert Bundestagsabgeordnete auch die Rechtssetzenden sind – es ist eine fiktive Identität. Die rechtliche Verbindlichkeit gilt für alle. Rechtsbrüche haben keine dem Internationalem Recht vergleichbare Präzedenzfallwirkung.
Im Internationalen Recht sind nicht nur alle Rechtsetzenden auch Rechtsunterworfene, sondern alle Rechtsunterworfene sind auch Rechtsetzende. Es handelt sich also um ein konsensuales Recht – ein Recht, dass nur dann in Kraft tritt, wenn alle zustimmen oder aber auch Mehrheiten souverän akzeptiert werden. Selbst wenn ein Staat nachträglich einem Vertragswerk beitreten will, er also an der konsensualen Ausarbeitung nicht beteiligt war, kann dieser Staat dem fertigen Vertragswerk beitreten oder eben auch nicht – er hat die souveräne Entscheidungsmacht. Anders im innerstaatlichen Recht: Da hat das frisch Geborene oder der Migrant nicht das Recht, sich dem Rechtssystem rechtskonform zu entziehen, nur weil es / er bei Ausarbeitung des Gesellschaftsvertrages nicht mitwirken konnte.
Und dieser konsensuale Ansatz im Internationalen Recht widerlegt die Forderung des „Keine Gleichheit im Unrecht“. Denn wenn es so wäre, gäbe es den Begriff des Präzedenzfalles nicht, der auch das Internationale Recht im Sinne des Völkergewohnheitsrechts weiterentwickeln kann, wenn der Rechtsbruch häufig genug praktiziert („Übung über einen längeren Zeitraum“) und von anderen Staaten akzeptiert (Rechtsüberzeugung) wird. Würden immer nur die eine Großmacht oder das Staatenkartell das Recht brechen, und die übrigen Staaten würden weiterhin das Recht respektieren, so entstünde eine Machtasymmetrie respektive die bereits bestehende Machtasymmetrie würde vertieft und zementiert, und das abgesichert durch einseitig ausgelegte rechtliche Argumente. Dass die sich disziplinierenden Staaten an einer solchen nachteiligen Entwicklung kein dauerhaftes Interesse haben können, bedarf wohl keiner vertieften Ausführungen.
Wenn der Konsens des konsensualen Rechts, mithin des Internationalen Rechts von einem Staat oder einer Staatengruppe mehrfach aufgebrochen wird, dann erodiert für die übrigen Vertragsstaaten die Verpflichtung zur Vertragstreue. Alles andere wäre eine direkte Negation der staatlichen Souveränität. Die Staaten, die sich jenseits des konsensual vereinbarten Rechts bewegen, zerstören es. Und die Krönung des rechtsnihilistischen Agierens findet dann statt, wenn der/die rechtsbrechende/n Staat/en die übrigen Staaten – auch mit militärischer Gewalt – zur Einhaltung des Rechts zu zwingen versuchte/en, während sie selbst sich aus diesem Recht faktisch verabschiedet haben, sich dann aber ganz selbstbewusst als Verteidiger des Internationalen Rechts zu präsentieren versuchen (Stichwort: „regelbasierte internationale Ordnung“). Das Recht würde aus machtpolitischer Motivation maximal instrumentalisiert und somit in seinem Wesen zerstört. Das sich herausbildende Konstrukt wäre eine dem innerstaatlichen Monarchismus vergleichbare monarchistische Staatenwelt. Der Starke steht über dem Gesetz, und das Gesetz dient faktisch der Sicherung seiner Macht.
Ausblick
Ob das UNO-Völkerrecht noch zu retten ist, daran kann man berechtigte Zweifel hegen:
- Politische Entscheidungen – mit bisweilen universellem Geltungsanspruch – auf der internationalen Bühne finden zunehmend jenseits der UNO in regionalen und interregionalen Foren statt: G-20; G-7, BRICS, NATO, EU, SCO etc.
- Die Verweigerung, UNO-Gremien (insbesondere den UNO-Sicherheitsrat) angesichts der veränderten Machtkonstellationen entsprechend zu reformieren.
- Der instrumentelle und selektive Verweis auf UNO-Normen zwecks Rechtfertigung jeweils eigener politischer Interessensdurchsetzung (beispielsweise Souveränitätsprinzip versus externes Selbstbestimmungsrecht).
- Die Anstrengungen, die UNO-Charta durch eine „regelbasierte internationale Ordnung“ sprachlich als auch in der Anwendung zu ersetzen, sind unübersehbar.
Die menschlichen Anstrengungen, aus Fehlern zu lernen und eine stabilere und kriegsresistentere Ordnung aufzubauen, fanden zumeist nach großen, von Menschen gemachten Katastrophen statt:
- Der westfälischen Frieden nach dem 30-jährigen Krieg 1648, der das moderne Völkerrecht etablierte und damit einhergehend das bis heute gültige, jedoch zunehmend missachtete Souveränitätsprinzip festigte.
- Der Wiener Kongress 1815 in Folge der Napoleonischen Kriege, der das Mächtegleichgewicht (Europäisches Mächtekonzert, also eine multipolare Ordnung) in Europa vereinbarte und für über 50 Jahre, je nach Betrachtung auch für fast 100 Jahre eine relative Stabilität auf dem Kontinent hervorbrachte. Diese Ordnung basierte auf einer relativen Ausgewogenheit der Machtpotenziale ihrer fünf Staaten – Preußen, Österreich, Russland, Frankreich und Großbritannien –, siehe die antike Erklärung Thukydides‘ zum Peloponnesischen Krieg.
- Der Briand-Kellogg-Pakt und der Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg, die den Angriffskrieg ächteten.
- Die UNO nach den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs. In der Charta wurden der Angriffskrieg verboten und die Friedenspflicht fixiert. Friedensbrechende Staaten, zumindest gemäß der Charta, sollen durch das gemeinsame Handeln der Staaten im Rahmen der UNO auch unter Verwendung militärischer Maßnahmen zur Rückkehr zum Frieden gezwungen werden können.
Aber wenn die Erinnerungen an die Schrecken des Krieges verblassen, scheint auch die Disziplin, geltendes Recht fortwährend zu respektieren, zu verblassen. Und wenn dann auch noch die Moral als politischer Kompass einzieht, dann ist kein Platz mehr für Recht, Souveränität und friedliche Koexistenz. Dann bleibt vermeintlich nur noch das Schlachtfeld. Und nach der nächsten Schlacht kommt wieder das „Nie wieder“.
Nur, im Nuklearzeitalter auf eine Katastrophe als Katalysator für eine bessere Welt zu setzen, ist eine ganz schlechte Idee.
Titelbild: Shutterstock / Oselote
Analyse: Internationale Verträge gegen Atomwaffen und ihre Wirkkraft
Eine völkerrechtliche Einordnung des bisherigen Krieges zwischen Israel, USA und dem Iran
Analyse: Drohnen als neue Waffensysteme auf den Schlachtfeldern des 21. Jahrhunderts
„Bundeswehr soll konventionell zur stärksten Armee Europas werden“ – Egal, was es kostet