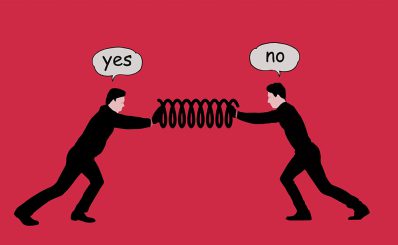Beim „Whataboutism“ handelt es sich, von Ausnahmen abgesehen, nicht um einen formellen Argumentationsfehler, sondern um ein Instrument der psychologischen Kriegsführung. Mit dieser Methode kann man jemanden kritisieren und ihn gleichzeitig auf die eigenen Argumentationsregeln festnageln. Von Klaus Mendler.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Neulich war die Autorin Juli Zeh in der SRF-Sendung „Sternstunde Philosophie“ zu sehen, und es gab in diesem Gespräch einen sehr irritierenden Moment: Als es um Donald Trump ging, machte Juli Zeh deutlich, dass sie die moralische Empörung der Moderatorin Barbara Bleisch nicht teilen kann, und dass sie Trump nicht als schlimmsten US-Präsidenten aller Zeiten sehe, denn es habe andere Präsidenten gegeben, die z.B. für Millionen von Toten in Vietnam verantwortlich zeichnen. Daraufhin (bei Minute 15:35) entgegnete Moderatorin Bleisch:
„Aber ist das nicht Whataboutism, man guckt, was haben andere gemacht …“
Dieser Begriff Whataboutism geistert schon seit längerer Zeit durch die Medien, aber noch nie kam er mir so deplatziert vor wie hier. Nach meinem vorläufigen Verständnis bedeutete Whataboutism ein rhetorisches Ablenkungsmanöver: Konfrontiert mit einem Vorwurf, verweist der Beschuldigte auf andere, die das Gleiche wie er oder noch Schlimmeres gemacht hätten.
Aber was hat dies mit der vorliegenden Situation zu tun? Wenn man Donald Trump irgendeine Schweinerei vorwirft, und er antwortet darauf: „Aber was ist mit Nixon?“, dann wäre das in der Tat Whataboutism. Aber Juli Zeh ist nicht Trump, auch keine Anhängerin von ihm, sondern sie betrachtet die amerikanische Politik aus einer neutralen Position, und dies ändert alles. Sie muss keinen Vorwurf von sich ablenken, weil ihr gar nichts vorgeworfen wird.
Kein Wunder also, dass Frau Zeh mit Leichtigkeit den Einwand der Moderatorin abschmettern konnte. Sie wies darauf hin, dass es völlig legitim sei, verschiedene Präsidenten miteinander zu vergleichen, schon allein, weil Vergleichen eine grundlegende Methode des menschlichen Denkens sei.
Damit war der Fall eigentlich erledigt, aber mir ging die Frage nicht aus dem Kopf: Was hat es eigentlich genau auf sich mit diesem „Whataboutism“?
Das rhetorische Manöver, um das es hier geht, ist alles andere als neu. Schon vor rund zweitausend Jahren sagte Cicero über seinen Prozessgegner Verres: „Was wird er also sagen? Dass andere es ebenso machten. Aber was soll das beweisen? Sucht man Einwände gegen eine Anklage, oder Gesellschaft für die Auswanderung ins Exil?“ – Also woher plötzlich die Aufregung um diesen Begriff?
Eng verwandt mit dem Whataboutism ist das aus der klassischen Argumentationskunst bekannte Tu-quoque-(„du auch“)-Argument. Hierbei handelt es sich um eine fehlerhafte Argumentation, bei der eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Kritik umgangen wird, indem man dem Kritiker entgegenhält, er würde selbst auch machen, was er beim anderen kritisiert. Der Fehler liegt darin, einfach eine Gleichheit von Kritiker und Kritisiertem zu unterstellen, aber wenn zwei Personen dasselbe tun, ist es nicht immer dasselbe.
Manchmal allerdings doch! Man muss hier deshalb immer genau hinschauen. Beispiele: Ein Vater sagt zu seinem 12-jährigen Sohn, er solle keinen Alkohol trinken, und der sagt daraufhin: „Du trinkst doch auch!“ Dieses Argument ist falsch, weil es ein Unterschied ist, ob Kinder oder Erwachsene Alkohol trinken. Aber wenn ein Erwachsener zu einem anderen Erwachsenen sagt: „Du sollst keinen Alkohol trinken“, und der antwortet: „Was willst du von mir, du säufst doch genauso viel wie ich!“, dann ist das nicht so einfach von der Hand zu weisen. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Kritik findet zwar auch hier nicht statt, aber der Kritisierte kann sie zu Recht ablehnen, weil der Kritiker gar keine Legitimität hat, ihn zu kritisieren.
Zurück zum eigentlichen Begriff „Whataboutism“. Eine kleine Internetrecherche führt schnell zu dem Ergebnis, dass dieses Wort erstmals 1974 in Irland auftauchte, zunächst in Variationen wie „Whataboutists“ oder „Whataboutery“. Dies war die Zeit des Nordirlandkonflikts, in dem sich katholische und protestantische Gruppierungen bürgerkriegsartig bekämpften. Am 30. Januar 1974 veröffentlichte The Irish Times einen Leserbrief eines gewissen Sean O’Conaill, in dem dieser sich über die „Whataboutists“ beklagte, die auf jede Verurteilung der IRA mit einem Beispiel für noch schlimmere Taten der Gegenseite antworten würden. Dieser Begriff wurde in der Folgezeit von verschiedenen Journalisten aufgegriffen, die den „Whataboutism“ dann dafür verantwortlich machten, dass der Bürgerkrieg immer weitergehe.
Mr. O’Conaills Leserbrief lässt keinen Zweifel daran, auf welcher Seite er im Nordirlandkonflikt steht: Eindeutig für die Protestanten, gegen die IRA. Auch die Journalisten, die den Begriff weitertragen, bedienen sich der typischen rhetorischen Mittel aus der Werkzeugkiste der Kriegspropaganda, wie sie in der Liste des Lord Ponsonby nachzulesen sind: Unsere Gegner sind alleine für den Konflikt verantwortlich, unsere Gegner begehen absichtlich schreckliche Kriegsverbrechen, wir dagegen höchstens aus Versehen. Auch der Vorwurf des Whataboutism wird in diesem Interesse verwendet. Dieser Begriff stammt also keineswegs aus einem philosophischen Seminar über argumentative Logik, sondern aus der Praxis der psychologischen Kriegsführung.
In den folgenden Jahren begann der Aufstieg des Begriffs „Whataboutism“ im Kalten Krieg, als Vorwurf westlicher Politiker und Journalisten gegen die Sowjetunion, wenn z.B. die USA den Sowjets Menschenrechtsverletzungen vorwarfen und die im Gegenzug auf den Rassismus in den USA hinwiesen. Man kann dies als typische Tu-quoque-Situation sehen: Zwei Alkoholiker werfen sich gegenseitig Alkoholismus vor. Aber es gibt hier noch andere Aspekte zu bedenken. „Die Weltgeschichte ist das Weltgericht“ (Friedrich Schiller), und kein philosophischer Debattierclub, in dem nur die Logik des stärkeren Arguments zählt. Vor Gericht gibt es auch Mittel wie den Befangenheitsantrag, und man sollte den sowjetischen Vorwurf in diesem Sinne verstehen: Ihr habt keinerlei moralische Berechtigung, über uns zu urteilen! Ist das Whataboutism? „Hohes Gericht, der Staatsanwalt hat gar kein abgeschlossenes Studium und ist außerdem betrunken!“ – „Whataboutism!“ Die Absurdität liegt hier auf der Hand.
In jüngerer Zeit wird der Vorwurf des Whataboutism häufig gegen Russland gerichtet. Typisches Beispiel: Der Westen bezeichnet die Abspaltung der Krim von der Ukraine als unzulässig, weil ein solcher Schritt gegen das Völkerrecht verstoße. Aus Russland kommt daraufhin die Erwiderung, die Abspaltung des Kosovo von Serbien sei vom Westen aber ohne weiteres akzeptiert worden. – „Whataboutism!“
Auch hier ist der Vergleich mit einer Gerichtsverhandlung aufschlussreich, denn die genannte Argumentation ist im Prinzip einfach nur der Hinweis auf einen Präzedenzfall. Was soll daran unzulässig sein? Natürlich ist der eine Fall nicht genau identisch mit dem anderen, aber sie sind doch vergleichbar. In beiden Fällen geht es darum, dass eine Region, die bislang Teil eines größeren Staates war, ihre Bürger über eine Sezession abstimmen lässt und sich dann gemäß dem Mehrheitsentscheid für unabhängig erklärt. Im ersten Fall (Kosovo) hat das „Weltgericht“ der westlichen Staaten die Sezession akzeptiert und damit quasi einen Präzedenzfall geschaffen. Warum sollte es nicht legitim sein, bei der Krim-Frage darauf hinzuweisen? Im Gegenteil: Wenn ein Gericht einmal einen Freispruch und dann in einem gleichartigen Fall eine Verurteilung verhängt, ist es zwingend geboten, diesen Widerspruch aufzugreifen und zu kritisieren.
Fazit: Beim „Whataboutism“ handelt es sich, von Ausnahmen abgesehen, nicht um einen formellen Argumentationsfehler, sondern um ein Instrument der psychologischen Kriegsführung. Mit dieser Methode kann man jemanden kritisieren und ihn gleichzeitig auf die eigenen Argumentationsregeln festnageln. Der Kritisierte hat dadurch nicht die Möglichkeit, dem Kritiker die Legitimität abzusprechen oder den Kontext der Kritik zu hinterfragen. Der „Whataboutism“ hat einen Platz in der Liste der Manipulationsmethoden verdient.
Leserbriefe zu diesem Beitrag finden Sie hier.
Titelbild: robertindiana / Shutterstock