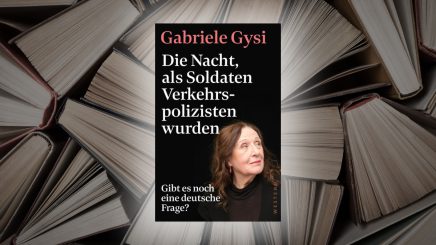Freie Meinungsäußerung als demokratische Diskussionskultur beleben

Dass es sich bei der freien Meinungsäußerung um die Freiheit der Gesamtbevölkerung handelt, sich in einem demokratischen Diskussionsprozess für das verantwortungsbewusste Bewältigen von gesellschaftlichen Herausforderungen zu engagieren, dämmert auch den Vertretern der gegenwärtigen werteorientierten Demokratie. Leider nicht als eine Chance, sondern als eine Gefahr. Somit zeigt die mediale Politöffentlichkeit kein Interesse an der Verwirklichung des urdemokratischen Ideals von einer Bevölkerung, die sowohl fachlich als auch geistig-moralisch in der Lage wäre, nicht nur praktisch das alltägliche Überleben zu meistern, sondern dabei auch die Folgen des gesellschaftlichen Handelns verantwortungsbewusst zu überschauen und somit Fehlentwicklungen gar nicht erst entstehen zu lassen. Von Pentti Turpeinen.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.