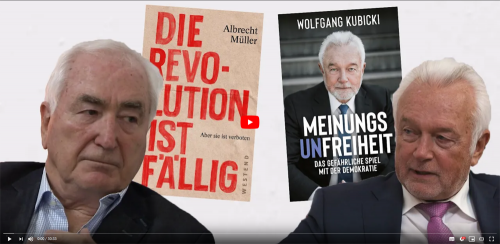Es sind Zahlen, die man zunächst gar nicht glauben mag. Vor einem Monat begann China mit dem Bau eines Wasserkraftwerks im tibetischen Hochland, dessen Leistung mehr als der Hälfte der gesamten deutschen Stromerzeugung entspricht. Bereits in fünf Jahren soll die Medog Hydropower Station fertiggestellt sein und 2033 ihren kommerziellen Betrieb aufnehmen. In Deutschland droht die Energiewende derweil am Trassenbau zu scheitern. Allein um den Strom des Medog-Wasserkraftwerks in das mehr als 2.500 Kilometer entfernte industriereiche Perlflussdelta zu transportieren, wird China Leitungen bauen müssen, die ungefähr die zehnfache Kapazität der hierzulande bis 2050 projektierten Hochspannungsübertragungsleitungen haben. Diese Zahlen sollten verdeutlichen, wo sich die wirtschaftliche Zukunft abspielt. Von Jens Berger.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Dieser Artikel liegt auch als gestaltetes PDF vor. Wenn Sie ihn ausdrucken oder weitergeben wollen, nutzen Sie bitte diese Möglichkeit. Weitere Artikel in dieser Form finden Sie hier.
Wenn man sich über das Wasserkraftprojekt im tibetischen Medog informiert, kommt man aus den Superlativen gar nicht mehr raus. Gebaut wird das Wasserkraftwerk am Oberlauf des Flusses, der in Indien Brahmaputra und in Bangladesch Jamuna genannt wird. Hier im chinesischen Tibet heißt er Yarlung Tsangpo, kurz Tsangpo. Das Einzugsgebiet des Tsangpo ist der nördliche Himalaya. Hier verläuft er auf rund 1.700 Kilometer in West-Ost-Richtung, bevor er auf die Dihangschluchten trifft, die ihrerseits ebenfalls ein Superlativ bilden – rund 500 Kilometer lang und bis zu 6.000 Meter tief, die mit Abstand größte Schlucht der Welt. Erst 2002 gelang es Abenteurern zum ersten Mal, diesen Abschnitt mit einem Kajak zu befahren, zuvor waren beim Versuch mehrere Abenteurer ums Leben gekommen. 2002 sind auch die ersten Ideen der chinesischen Regierung ans Licht gekommen, in diesem unwirtlichen Gebiet ein Wasserkraftwerk zu bauen.
Es gibt wohl kaum ein Gebiet auf dem Planeten, das sich zumindest von den Daten her besser dazu eignen würde. Bevor der Tsangpo die indische Grenze erreicht, durchläuft er in den Dihangschluchten eine 50 Kilometer lange Biegung, über die er ganze 2.000 Höhenmeter verliert – und dies bei einem Durchfluss, der dem des Rheins an der Mündung in die Nordsee entspricht. Für einen klassischen Staudamm wäre dies nicht händelbar. Daher gehen die Chinesen auch einen anderen Weg. Das Konzept des Medog-Wasserkraftwerks sind vier jeweils 20 Kilometer lange gigantische Rohre, die in den Berg gebaut werden und über die die 50 Kilometer lange schleifenförmige Passage durch die Schlucht samt ihrer 2.000 Meter Höhenunterschied abgekürzt wird. Entlang der Rohre wollen die Chinesen dann in Kaskaden fünf gigantische Turbinenkraftwerke bauen, die jährlich stolze 300 Terawattstunden Strom generieren können.
300 Terawattstunden? In ganz Deutschland wurden im letzten Jahr 431 Terawattstunden Strom erzeugt. Umgerechnet auf die Kraftwerksleistung entspricht dies 34,3 Gigawatt und damit mehr als 22 Atomkraftwerken von dem Typ, die in Deutschland 2023 abgestellt wurden. Das Medog-Wasserkraftwerk wird bei Inbetriebnahme das mit großem Abstand größte Kraftwerk der Welt sein – mehr als dreimal so leistungsstark wie der bisherige Spitzenreiter, der Dreischluchtendamm, der im Westen Chinas den Yangtze staut.
Man sollte das Medog-Projekt trotz seiner Superlative aber nicht isoliert betrachten. Seit der Jahrtausendwende hat China in Tibet ganze 193 Wasserkraftprojekte gestartet. Wenn diese Projekte erst einmal alle am Netz sind, sprechen wir über eine Gesamtleistung von über 500 GW, also mehr als 300 Atomkraftwerken. Das erklärt vielleicht auch die strategische Wichtigkeit Tibets für China. Ohne diese gigantischen Kapazitäten wäre es wohl auch unmöglich, China bis zum Jahr 2060 CO2-neutral und unabhängiger von importierten Energieträgern zu machen, wie es die Regierung in Peking geplant hat.
Eine Mammutaufgabe stellt jedoch nicht nur der Bau, sondern auch der Transport der gewonnenen Energie innerhalb Chinas dar. Allein für das Medog-Wasserkraftwerk ist ein rund zehnmal so leistungsstarkes Hochspannungsübertragungsnetz notwendig, wie es Deutschlands Energiewende bis 2050 für das gesamte Land geplant hat und an dessen Umsetzung man zurzeit wegen der Kosten und Planungsfragen zu scheitern droht. Während es hierzulande nahezu unmöglich scheint, den Strom der Windräder aus dem Norden über wenige hundert Kilometer zu den Großabnehmern im Westen und Süden zu transportieren, scheint es in China kein Problem damit zu geben, die zehnfache Menge zu den Großabnehmern in die tausende Kilometer entfernten Industrieregionen im Osten des Landes zu transportieren. Um es klar zu sagen: Wenn wir von der Energiewende sprechen, spielt China in der Champions League und Deutschland bestenfalls in der Kreisklasse.
Hierzulande mag die Energiewende zwar ein vieldiskutiertes Thema sein, konkret passiert jedoch vergleichsweise wenig. Dazu nur eine Zahl: In China wird derzeit pro Jahr (!) mehr als doppelt so viel regenerative Energie ans Netz genommen, wie es in Summe überhaupt in Deutschland gibt. Zurzeit sind mehr als 35 Prozent der weltweit installierten Gesamtleistung der regenerativen Energien in China, beim Zubau beträgt der chinesische Anteil fast 50 Prozent. Deutschland liegt beim Zubau bei mageren 3,2 Prozent, das ist weniger als der deutsche Anteil am weltweiten Bruttoinlandsprodukt. Beim Zubau regenerativer Energien ist Deutschland also im globalen Maßstab kein Vorreiter, sondern schlicht und einfach unterdurchschnittlich, Kreisklasse halt.
Lesen Sie dazu auch die Artikel: „Die Energiewende stockt – dies ist ein politisches Versagen und ökologisches sowie ökonomisches Desaster“, „Deutschland will „die Energiewende in die Welt tragen“? Schuster, bleib bei deinem Leisten“ und „Zurück zum Atom? Energiepolitische Tagträumereien im Wahlkampf“
Wenn wir über Stromerzeugung sprechen, sollte es jedoch nicht „nur“ um die vorhandene Industrie oder auch Klimafragen gehen. Die Welt – also die Welt außerhalb Deutschlands – steht gerade eben am Beginn einer neuen technischen Revolution. Das KI-Zeitalter ist eingeläutet. Alleine in den USA werden in diesem Jahrzehnt Rechenzentren entstehen, die mehrere hundert Terawattstunden Energie benötigen. Aktuell plant die Trump-Regierung dafür den Bau von zehn großen Atomkraftwerken und auch die AI-Konzerne selbst investieren derzeit in die Atomkraft. Man munkelt übrigens, dass dies auch einer der Gründe für Donald Trump sei, gute wirtschaftliche Beziehungen zu Russland aufzubauen, hat Russland – zumindest in diesen Kapazitäten – doch derzeit ein Monopol bei der Uranaufbereitung für Atomkraftwerke.
Im Wettbewerb um die Zukunft der Künstlichen Intelligenz liefern sich die USA und China ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wie viel zusätzliche Energie China für KI-Rechenzentren benötigt, ist nicht öffentlich bekannt, es dürfte sich jedoch auch hier um einen Bedarf im dreistelligen Terawattstundenbereich pro Jahr handeln. Und hier schließt sich der Kreis. Auch wenn es dazu keine Quellen gibt, liegt es auf der Hand, dass Tibet ein idealer Standort für chinesische KI-Rechenzentren sein könnte. Anders als traditionelle Industriestandorte sind Rechenzentren vergleichsweise unabhängig von normalen Standortfaktoren. Was zählt, ist einzig und allein sehr viel günstige Energie. Und die scheint Tibet ja zuhauf zu besitzen. Vielleicht muss China den Strom von Medog und Co. also gar nicht tausende Kilometer weit in die „alten“ Industriezentren transportieren?
Aber auch solche Fragen spielen in „Old Europe“ keine Rolle. KI ist hier kein großes Thema. Deutschland baut ja Autos. Wie lange noch? Nun, dies wäre genügend Stoff für einen weiteren Artikel. Begrüßen wir also das chinesische Jahrhundert. Zài jiàn.
Titelbild: ZCOOL HelloRF/shuttestock.com