Als die USA eine brutale chinesische Eroberung Taiwans unterstützten – „The Struggle for Taiwan“
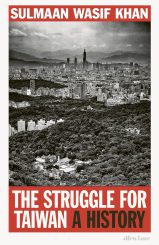
In der westlichen Vorstellung wird Taiwan fast ausschließlich als blühende Demokratie dargestellt, die von einem totalitären Nachbarn belagert wird – eine moralische Klarheit, die Forderungen nach militärischer Verteidigung und ideologischer Solidarität befeuert. Sulmaan Wasif Khans meisterhaftes Geschichtswerk „The Struggle for Taiwan“ von 2024 leugnet weder die demokratische Lebendigkeit der Insel noch die Bedrohung durch die Volksrepublik China. Khan, Professor für Internationale Beziehungen und Geschichte an der Fletcher School, verkompliziert dieses Bild jedoch mit einer düstereren, beunruhigenderen Erzählung. Er deckt eine Geschichte auf, in der die USA nicht die Verteidiger der taiwanesischen Selbstbestimmung waren, sondern die Hauptförderer ihrer Eroberung durch ein brutales chinesisches Regime. Khan argumentiert, dass die derzeitige Gefahr in der Taiwanstraße die bittere Frucht der imperialistischen Kartenplanung Japans und der Vereinigten Staaten ist, eines Jahrhunderts zynischer Manöver, in denen die Vereinigten Staaten an der Ausbeutung Chinas beteiligt waren und dann Taiwan einer Diktatur übergaben, die ihre Bevölkerung jahrzehntelang terrorisierte. Eine Rezension von Michael Holmes.


















