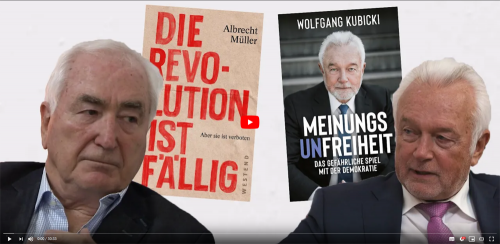Vor 30 Jahren wurde das Abkommen von Dayton geschlossen. Zuvor hatten Regierungen westlicher Staaten während der Kriege in Ex-Jugoslawien nicht nur ernsthafte Friedensbemühungen vermissen lassen, sondern konstruktive Lösungen immer wieder sabotiert. Sie nahmen die Eskalation des Krieges vor allem in Bosnien aus geostrategischen Erwägungen heraus billigend in Kauf und heizten diese mitunter sogar wissentlich und vorsätzlich an. Von Günther Auth.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Die politische Krise, die schlussendlich zum Staatszerfall Jugoslawiens führen sollte, entzündete sich an Volksabstimmungen, die im Zeitraum von Dezember 1990 bis März 1992 in den Teilrepubliken Slowenien, Kroatien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina durchgeführt wurden. Die wahlberechtigten Bürger der vier Teilrepubliken waren aufgefordert, über den Verbleib ihrer Republiken im föderalen Gesamtstaat zu entscheiden. In allen vier Teilrepubliken votierte eine Mehrheit für die politische Unabhängigkeit. Die Ergebnisse in Slowenien, Kroatien und Mazedonien lagen jeweils bei ca. 90 Prozent. Das Referendum in Bosnien-Herzegowina ergab nur etwas über 60 Prozent an Zustimmung für den Austritt, da die meisten bosnischen Serben das Referendum boykottierten. Im Zeitraum von Juni 1991 bis März 1992 erklärten die vier Teilrepubliken einseitig ihren Austritt aus dem Bundesstaat Jugoslawien. Kroatien und Slowenien wurden nach einer Übergangsfrist am 15. Januar 1992 von der EU anerkannt; die Anerkennung Bosnien-Herzegowinas folgte am 6. April 1992; Mazedonien wurde am 8. April 1993 unter dem Namen ‚Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien‘ von der Generalversammlung der Vereinten Nationen anerkannt.
Der verengte Blick auf den ethnischen Nationalismus
In der wissenschaftlichen Debatte wurden die zeitgleich ablaufenden Unabhängigkeitsbestrebungen der Teilrepubliken überwiegend auf historisch und soziokulturell bedingte Konflikte zwischen den Volksgruppen sowie auf ökonomische Disparitäten und Spannungen bei der Umverteilung des gesamtstaatlich erwirtschafteten Sozialprodukts zurückgeführt[1]. Laut David Gibbs bestand zwischen diesen Faktoren ein direkter Zusammenhang, insofern „[…] the rising level of ethnic tensions tended to correlate with regional economic inequality.“[2] Das lag nicht zuletzt daran, dass die führenden politischen Kräfte in den wohlhabenderen Republiken Slowenien und Kroatien Jugoslawien schon seit den 1970er-Jahren als ein Umverteilungsprojekt zu ihren Lasten beschrieben hatten, während die Führungsschichten in den ärmeren Republiken den Bundesstaat als einen überlebenswichtigen Solidaritätsrahmen verteidigten. Einer der Hauptgründe für die ökonomische Krise Jugoslawiens lag in der hohen Schuldenlast, die seit den weltwirtschaftlichen Turbulenzen während der 1970er-Jahre ständig anwuchs und in den 1980er-Jahren eine Höhe von rund 20 Milliarden US-Dollar erreicht hatte[3]. Die dadurch heraufbeschworene Zahlungsunfähigkeit Jugoslawiens wurde von westlichen Gläubigerstaaten (v.a. USA, Deutschland, Großbritannien und Frankreich) mit harten IWF-Auflagen beantwortet.
Die erzwungene Abwertung des jugoslawischen Dinars, erhebliche Kürzungen bei den Sozialausgaben, umfänglicher Subventionsabbau, Preisliberalisierung und Privatisierungsdruck führten in Jugoslawien sukzessive zu einer hohen Inflation, die vor allem in Serbien, Kosovo, Mazedonien und Bosnien zu Produktionsrückgang, Betriebsschließungen, Lohnkürzungen und Massenarbeitslosigkeit führte[4], während die exportorientierten Teilrepubliken Slowenien und Kroatien von der Währungsabwertung profitierten. Die unmittelbare Folge daraus war steigender Argwohn zwischen den Teilrepubliken, v.a. nachdem die Regierungen in Slowenien und Kroatien ankündigten, die ärmeren Republiken nicht mehr länger finanzieren zu wollen. Die sich zuspitzenden Verteilungsprobleme zwischen der Bundesregierung und den Teilrepubliken verstärkten die bestehenden nationalistischen Ressentiments: „This economic polarization led to social polarization.“[5] Und beides zusammen ließ eine ohnehin konfliktgeladene Situation immer weiter eskalieren.
In der westlichen Medienöffentlichkeit waren die ökonomischen Probleme Jugoslawiens in den 1990er-Jahren zwar ein Thema[6]. Die journalistische Berichterstattung fokussierte sich in den sogenannten Qualitätsmedien aber insgesamt viel stärker auf die vermeintliche ‚Sprengkraft‘ ethnonationalistischer und religiöser Animositäten unter den Volksgruppen der Teilrepubliken. Diese verengte Wahrnehmung der Krise manifestierte sich in der Verwendung stereotypisierender Schlagworte wie z.B. dem der ‚Balkanisierung‘[7], was im Einklang mit dem triumphalistischen und chauvinistischen Zeitgeist stand, den regierungsnahe Propagandisten aus US-amerikanischen Denkfabriken (RAND) ganz entscheidend geprägt hatten.
Eine prominente Stimme gehörte Francis Fukuyama, der zu dieser Zeit als Direktor im Policy Planning Staff des US-Außenministeriums fungierte und dessen Botschaft auch in Europa große Resonanz erfuhr: der ‚demokratische Westen‘ wäre das Produkt einer beispielhaften Erfolgsgeschichte, in der sich die dazugehörigen Gesellschaften aus dem Atavismus religiöser und ethnonationalistischer Befindlichkeiten emanzipiert hätten[8]. Parallel dazu prophezeite der nicht minder einflussreiche Politikwissenschaftler und US-Regierungsberater Samuel Huntington in Seminaren, Talks und Vorträgen, u.a. vor dem Council on Foreign Relations und dem American Enterprise Institute, dass zukünftige Konflikte weniger zwischen Staaten als zwischen konsolidierten Kulturkreisen bzw. ‚Zivilisationen‘ wie z.B. der ‚westlich-christlichen‘ und der ‚islamischen‘ verlaufen würden[9].
Obwohl solche Erzählungen von der vermeintlichen ‚Zivilisiertheit‘ liberaler Demokratien und der scheinbar manifesten ‚Gewaltaffinität‘ ethnonationalistisch geprägter Gesellschaften schon zur Zeit ihrer Veröffentlichung auffällig unterkomplex anmuteten und sich bei näherer Beschäftigung als intellektuell unbefriedigend und analytisch weitgehend substanzlos erwiesen[10], verrät ihre Rezeptionsgeschichte, wie nachhaltig die dort beschworenen Stereotypen und Denkfiguren die Vorstellungswelt westlicher Gesellschaften und ihrer Funktionseliten prägen sollten. So verdeutlicht ein Beitrag von Ex-Staatsminister Michael Roth aus dem Jahr 2020, dass es in der deutschen Medienöffentlichkeit ca. 30 Jahre nach Ausbruch der Krise immer noch möglich war, in einer rückblickenden Bewertung darauf hinzuweisen, dass die Konflikte, die zum Staatszerfall Jugoslawiens führten, primär oder sogar ausschließlich aufgrund eines ‚längst überholt geglaubten Nationalismus‘ ausgebrochen und auch eskaliert wären[11].
Für informierte Beobachter des Geschehens war schon früh klar, dass sich die hegemonialen Rahmenerzählungen über die Jugoslawien-Krise in den westlichen Gesellschaften durch einen viel zu niedrigen Grad an Komplexität auszeichneten: Die Zahl der politisch relevanten Akteure war von Anfang an viel zu klein, und die Völker der jugoslawischen Teilrepubliken wurden in einer unrealistischen Manier als weitgehend homogene nationale Einheiten dargestellt, die über stabile, geschichtlich gewachsene Identitäten, klare Präferenzen und feststehende kulturelle Eigenschaften verfügten. Vor allem bewirkte der vorherrschende Diskurs, dass den verschiedenen Parteien eindeutige Motive (‚Angriff/Verteidigung‘) sowie ästhetische Eigenschaften (‚orthodox/christlich‘) zugesprochen werden konnten; und dass einzelne Politiker als omnipotente Strippenzieher hinter den nationalen Einheiten fungierten.
So traten ‚die Serben‘ in der westlichen Berichterstattung weithin als die Bösen in Erscheinung, vornehmlich verkörpert durch Slobodan Milosevic, der angeblich ein Memorandum der Serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste (SANU) zum Anlass genommen hatte, um in der serbischen Außenpolitik das Projekt eines ‚Großserbien‘ im Sinne einer one-man-show zu verfolgen[12], weswegen er in der westlichen Presse auch als alleiniger Verursacher der Krise betrachtet werden konnte. „Jörg Reissmüller, publisher of the Frankfurter Allgemeine Zeitung […] waged a campaign against Slobodan Milosevic and Serbian nationalism that had a major role in shaping German opinion about the conflict.”[13] Viele emotionalisierte Laien sahen sich darob veranlasst, die komplexen Zusammenhänge gar nicht erst nüchtern zu analysieren, sondern gleich moralisch zu bewerten, weswegen sich viele vorschnell mit ‚den (armen) Opfern‘ identifizierten und ‚die (brutalen) Täter‘ verurteilten[14].
Der Beitrag, den Politiker und Journalisten mit ihrer undifferenzierten Wortwahl für den Krisenverlauf und die verhängnisvolle Eskalation leisteten, lässt sich schwer beurteilen. Nicht jedem von ihnen dürfte bewusst gewesen sein, wie unausgewogen und realitätsfern ihre Beiträge tatsächlich waren. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der öffentliche Diskurs mit seiner Schwarz-Weiß-Malerei und der geradezu grotesken Personalisierung von Verantwortlichkeit eine wesentliche Rolle dabei spielte, dass sich viele unkritische Konsumenten der täglichen Berichterstattung ein völlig verzerrtes Bild der Vorkommnisse machten. Am Ende bleibt zu konstatieren, dass „[s]uch historical simplifications helped legitimate later interventions by NATO, which have been directed entirely against the Serbs. However, […] the Serbs were only one party to the breakup of Yugoslavia, and that the other ethnic groups bear at least as much of the blame. Milosevic was surely a villain, but he was not the only villain, nor was he the only cause of the breakup.“[15]
Mit etwas mehr gesundem Menschenverstand und historischer Sensibilität wäre es leicht möglich gewesen, die plakativen Unterscheidungen in der öffentlichen Berichterstattung als Produkte effekthascherischer und auch geopolitisch motivierter Propaganda zu durchschauen, da nicht zuletzt „[t]he Tudjman-led and diaspora-supported Croatian nationalism was just as bad as, if not worse than, Serbian domestic nationalism.“[16] Zwar kam im kroatischen Nationalismus der späten 1980er- und frühen 1990er-Jahre nicht mehr derselbe Ustascha-Faschismus zum Ausdruck wie zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Die Geschichte des kroatischen Nationalismus seit dem ‚Kroatischen Frühling‘ anno 1971 ist offensichtlich sehr viel komplizierter. Aber dennoch kann es zumindest unter wissenschaftlichen Kriterien als gesichert gelten, dass die im Namen der kroatischen nationalen Befreiung in Jugoslawien zwischen den späten 1970er- und den späten 1980er-Jahren verübten Terrorakte gegen jugoslawische bzw. serbische Einrichtungen und Symbole einen substanziellen Einfluss auf die gewaltsamen Auseinandersetzungen hatten, die zur Auflösung Jugoslawiens und zur Gründung des unabhängigen Staates Kroatien führten[17].
Die sich im Jahr 1990 anbahnende Krise Jugoslawiens konnte also zu keinem Zeitpunkt allein auf religiös und ethnonationalistisch bedingte Animositäten der beteiligten Volksgruppen zurückgeführt werden. Zumal fielen diese nicht plötzlich vom Himmel, sondern wurden von gut organisierten Kräften ‚erzeugt‘[18]. Die ethnonationalistisch und religiös bedingten Animositäten bewirkten auch nur im Zusammenhang mit dem Streit um die Mittelverteilung zwischen den Teilrepubliken eine Stimmung, in der die Volksabstimmungen bzw. die darauffolgenden Austrittserklärungen zum Auslöser für die militärische Eskalation werden konnten[19]. Es ist daher auch nicht falsch, wenn entsprechende Hinweise im Wikipedia-Eintrag zu den Jugoslawienkriegen betonen, dass die Krise durch eine komplexe Vermischung von ethnischen, religiösen und schweren ökonomischen Problemen verursacht wurde, denen sich Jugoslawien seit den 1980er-Jahren ausgesetzt sah[20].
Der geopolitische Kontext
Allerdings bleiben solche Beschreibungen unvollständig, wenn sie den Beginn, den Verlauf und die Eskalation der Jugoslawien-Krise nicht vor dem Hintergrund der geopolitischen Situation verstehen. Am Ende ist es für ein tieferes Verständnis der Entwicklung unabdingbar, sowohl die Rolle westlicher Regierungen als auch den Einfluss von nationalistischen Organisationen im Exil zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang wären etwa die engen Verbindungen der kroatischen Diaspora zur amtierenden Republikanischen Partei in den USA zu nennen[21], verbunden mit der Tatsache, dass der spätere Präsident Kroatiens, Franjo Tudjman, bereits vor 1990 regelmäßig in die USA und nach Kanada gereist war, wo er sich mit exilkroatischen Organisationen, wie nicht zuletzt der radikal-separatistischen ‚Norval‘ Gruppe, vernetzte[22]. Auf diese Weise konnte er vom politischen Zugang, der Sichtbarkeit und den Lobbykapazitäten solcher Kräfte profitieren. Wie weit der Einfluss exilkroatischer Kräfte im politischen System der USA tatsächlich reichte, ist aufgrund des Fehlens konkreter Belege schwer zu beurteilen. Gruppen wie ‚Norval‘ waren jedoch auf ihre Weise mitverantwortlich für die Entstehung einer Atmosphäre, in der weitreichende politische Entscheidungen betreffend das weitere Schicksal Jugoslawiens getroffen wurden.
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang etwa, dass die US-Regierung unter George Bush, Sr. im November 1990 den amerikanischen Kongress unter Druck setzte, den Foreign Operations Appropriations Act von 1991 zu verabschieden. Dieses Gesetz richtete sich zwar nur beiläufig auf Jugoslawien, hatte aber eine immense Wirkung. Denn die mit dem Gesetz verbundene Zielsetzung machte es zu einem Instrument wirtschaftlicher Kriegführung im Sinne einer coercive diplomacy gegenüber der Bundesrepublik Jugoslawien[23] – und zwar just zu einem Zeitpunkt, als ultranationalistische Eliten wie Josef Peterle, Franjo Tudjman und Alija Izetbegović in den Teilrepubliken Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina damit beschäftigt waren, die ökonomische Krise des Gesamtstaates mit großzügiger finanzieller Unterstützung aus den USA wahlkampftaktisch zu politisieren[24].
Der Foreign Operations Appropriations Act 1991 war ein Haushaltsgesetz, das festlegte, wie die USA ihr Außenhilfe-Budget für 1991 ausgeben sollten. Der kurze Abschnitt zu den Leistungen für Jugoslawien sah konkret vor, dass jede jugoslawische Teilrepublik, die innerhalb von sechs Monaten keine Unabhängigkeit erklärte, jegliche US-Finanzhilfe verlieren würde[25]. Die Republiken hätten bei einem Verbleib im Bundesstaat kein Geld mehr für eigene Entwicklungsprojekte, Infrastruktur, Verwaltung oder humanitäre Hilfe aus dem US-Haushalt erhalten. Das politische Signal der US-Regierung an die Teilrepubliken war damit eindeutig und bestand darin, dass ein zögerliches Verhalten im de facto bereits eingeläuteten Prozess des jugoslawischen Staatszerfalls von der US-Regierung nicht akzeptiert worden wäre. Nach dem sogenannten Nickles Amendment, einer Gesetzesänderung, für deren Wortlaut die bereits erwähnten Gruppen aus der kroatischen Diaspora in den USA mitverantwortlich waren[26], verlangte das Gesetz separate Wahlen in jeder der sechs jugoslawischen Teilrepubliken und schrieb obendrein noch die Genehmigung durch das US-Außenministerium sowohl der Wahlverfahren als auch der Wahlergebnisse als Bedingung für jede zukünftige Unterstützung vor[27].
Besonders bemerkenswert wird dieser Schritt durch die Tatsache, dass die US-Regierung unter George Bush, Sr. in ihrer offiziellen diplomatischen Rhetorik stets die Einheit und den Fortbestand Jugoslawiens als Staat betonte. In der nach innen gerichteten Kommunikation war jedoch vom genauen Gegenteil die Rede: Die USA würden nämlich die politischen Forderungen der Separationsbewegungen in Slowenien und Kroatien unterstützen[28]. George Szamuely kommt mit Blick auf die Vorgehensweise der US-Regierung anlässlich der Entwicklungen in Jugoslawien zu dem Schluss, dass „[t]he United States had been playing a disingenuous and dangerous game toward Yugoslavia for some time. While outwardly expressing its support for Yugoslav unity, Washington acted to ensure disintegration.”[29] Auch Michael Parenti beschreibt die Strategie der US-Regierung als „[…] supporting Yugoslavia with words while undermining it with deeds.“[30]
Der von außen angeheizte ‚Bürgerkrieg‘
Die jugoslawische Bundesregierung reagierte auf die Unabhängigkeitserklärungen Sloweniens und Kroatiens im Juni 1991 mit der Mobilisierung und Verstärkung der Jugoslawischen Volksarmee (JNA), um die Sezession der Teilrepubliken militärisch zu unterbinden. Auf den sogenannten Zehn-Tage-Krieg in Slowenien (27. Juni – 7. Juli 1991) folgte der vierjährige Kroatienkrieg (August 1991 – 14. Dezember 1995). Nach der Unabhängigkeitserklärung Bosnien-Herzegowinas am 3. März 1992 zog die Regierung in Belgrad den größten Teil der JNA-Truppen aus der Teilrepublik ab. In der Folge begannen serbische Milizen – mutmaßlich mit logistischer und materieller Unterstützung aus Serbien – am 6. April 1992 eine militärische Offensive gegen bosnische und kroatische Gebiete in Bosnien. Die danach immer wieder aufflammenden Kämpfe in den Städten, systematische ethnische Säuberungen ländlicher Gebiete und schockierende Massaker an der Zivilbevölkerung dauerten bis zu den verstärkten Luftangriffen der NATO-Streitkräfte auf serbische Stellungen in den Jahren 1994 und 1995 an. Mit der Unterzeichnung des Dayton-Abkommens am 21. November bzw. 14. Dezember 1995 und dem darin vereinbarten Waffenstillstand endeten die Kampfhandlungen in Bosnien. Die damit völkerrechtlich besiegelte Unabhängigkeit Bosnien-Herzegowinas markierte das faktische Ende des Bundesstaates Jugoslawien.
Entsprechend dem hegemonialen Narrativ wurden militärische Offensiven, Übergriffe auf die Zivilbevölkerung und systematische Vertreibungen in der westlichen Medienberichterstattung ganz überwiegend von serbischen Kräften verübt[31]. „While the racist and aggressive actions of Milosevic undoubtedly were one set of factors, they were far from being the only factors. Franjo Tudjman was just as racist and aggressive as Milosevic; the persecution of ethnic Serbs in Croatia was just as morally objectionable as the Serb-perpetrated atrocities in Kosovo.“[32] Weitgehend unbeachtet blieben in der westlichen Medienöffentlichkeit eine ganze Reihe ‚unbequemer Fakten‘ der Kriegsgeschehnisse; etwa, dass bereits vor dem Ausbruch militärischer Auseinandersetzungen in Kroatien anno 1991 Serben in Schulen und am Arbeitsplatz diskriminiert bzw. misshandelt und dass sogar Wohnhäuser in serbisch besiedelten Gebieten in die Luft gejagt wurden. In Pakrac und in Plitvice griffen kroatische Einheiten die serbische Zivilbevölkerung an. Am 1. Juli 1991 wurde der Polizeichef in Osiek von einem kroatischen Polizisten ermordet, nachdem er sich für eine friedliche Lösung zwischen kämpfenden Kroaten und Serben eingesetzt hatte. Im Juli und August 1991 richteten sich kroatische Artillerieangriffe auf die überwiegend von Serben bewohnten Gebiete in Borovo Selo, Mirkovci und Dalj. Im November 1991 lösten kroatische Angriffe auf 18 Dörfer in Westslawonien massive Flüchtlingsbewegungen nach Serbien aus[33].
Der stellvertretende Oberbefehlshaber des US European Command (EUCOM) von 1992 bis 1995, General Charles G. Boyd, wies in seiner Beurteilung der Geschehnisse im zerfallenden Jugoslawien darauf hin, dass eine tragfähige Konfliktlösung erfordert hätte, die Sachlage so zu sehen, wie sie tatsächlich war, und nicht manipulative Zerrbilder als Wirklichkeit auszugeben[34]. Ethnische Säuberungen wurden in der westlichen Berichterstattung nur dann Anlass für Empörungen, wenn die serbische Seite dafür verantwortlich gemacht werden konnte. Dagegen schien es irrelevant, wenn Serben von kroatischen Truppen aus Gebieten vertrieben wurden, die von den Vereinten Nationen geschützt wurden. Dieses Informationsungleichgewicht zeigte sich auch darin, dass Berichte über serbische Missetaten aus Slowenien, Kroatien und Bosnien oft ungeprüft übernommen wurden, obwohl die in Rede stehenden (militärischen) Auseinandersetzungen manchmal gar nicht stattgefunden hatten, die Opferzahlen übertrieben und die vermeintlichen Gräueltaten jugoslawischer bzw. serbischer Armeeeinheiten frei erfunden waren[35].
Um eine existenzielle Bedrohung für den ‚zivilisierten‘ und ‚demokratischen‘ Teil Europas glaubhaft machen zu können, ‚bewiesen‘ westliche Propagandisten die Unmenschlichkeit der Serben durch plastische Beispiele; etwa, dass sie generell weder ältere Menschen noch Frauen und Kinder verschonten und vor ihrer Ermordung in Konzentrationslagern einsperren und grausam verstümmeln würden; oder dass sie zwischen 20.000 und 100.000 muslimische Frauen in Bosnien auf offizielle militärische Anweisung[36] hin misshandelt, vergewaltigt und dann ermordet hätten[37]. Nach dem Dafürhalten von Charles Boyd, einem Beobachter vor Ort, hätte eine weniger voreingenommene Haltung dabei helfen können, auch solche Tatsachen zu berücksichtigen, dass in Bosnien „[…] the Serbs are not trying to conquer new territory, but merely to hold on to what was already theirs.“[38]
Das wurde jedoch dadurch erschwert, dass sich der ganze Unmut der US-Regierung von vornherein und ausschließlich auf Serbien richtete, u.a. weil die Milosevic-Regierung den Forderungen nach ‚freien Wahlen‘ nicht nachkam und außerdem die albanische Bevölkerung im Kosovo unterdrückte[39]. Mit der umgehend kultivierten Unterscheidung zwischen ‚guten‘ und ‚bösen‘ Republiken wurde es dann auch leichter für die Regierungen der übrigen westlichen Staaten, die vermeintlich demokratischen Parteien in Jugoslawien militärisch zu unterstützen, ohne sich den Vorwurf gefallen lassen zu müssen, völkerrechtswidrig ins Geschehen einzugreifen, was die meisten westlichen Staaten allerdings bis März 1991 getan hatten[40]. Die deutsche Regierung hatte schon im Jahr 1990 damit begonnen, Kroatien heimlich beim Aufbau eines eigenen Geheim- und Sicherheitsdienstes zu helfen: „It thus appears that Germany was actively preparing the Croatians for independence and giving them the institutional wherewithal to achieve this.”[41]
Begleitet wurden solche Hilfeleistungen von militärischer Unterstützung. „Arms shipments and military advisers poured into the secessionist republics of Slovenia and Croatia, particularly from Germany and Austria.”[42] Dazu gehörten auch schwere Waffen wie z.B. Panzer- und Flugabwehrraketen[43]. „German instructors even engaged in combat against the Yugoslav People’s Army.”[44] Auch Italien und Ungarn belieferten Kroatien schon seit 1990 mit Waffen[45]. Die USA forcierten ihr Engagement, als sich das Kriegsgeschehen auf Bosnien ausweitete, insofern „[…] CIA personnel and retired US military officers, under contract to the Pentagon, trained and guided Muslim armed units. It is a matter of public record that the CIA fueled the Bosnian conflict.“[46] Dabei war die völkerrechtliche Lage eindeutig: Art. 2 Abs. 7 der Charta der Vereinten Nationen verbietet als ius cogens kategorisch jegliche Einmischung eines Staates in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines anderen Staates gehören. Und die Resolutionen 713 und 757 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vom 25. September 1991 bzw. 30. Mai 1992 ließen auch keinen Zweifel daran, dass Waffenlieferungen und sonstige militärisch relevante Unterstützungen an die Teilrepubliken völkerrechtswidrig waren.
Noch entscheidender ist am Ende jedoch die Tatsache, dass Regierungen westlicher Staaten nicht nur ernsthafte Friedensbemühungen vermissen ließen, sondern konstruktive Lösungen immer wieder sabotierten. In Verletzung der unbedingten völkerrechtlichen Friedenspflicht aus Art. 1 Abs. 1 der Charta der Vereinten Nationen nahmen sie die Eskalation des Krieges vor allem in Bosnien aus geostrategischen Erwägungen heraus billigend in Kauf und heizten diese mitunter sogar wissentlich und vorsätzlich an. Schließlich musste anno 1992 allen Regierungsverantwortlichen der westlichen Staaten klar gewesen sein, was der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Javier Pérez de Cuéllar, in einem Brief an Hans van den Broek, den Präsidenten des Ministerrates der Europäischen Gemeinschaft (EG), am 10. Dezember 1991 betonte, dass nämlich eine verfrühte Anerkennung Bosnien-Herzegowinas aufgrund des Widerstands der bosnischen Serben, die vor Ausbruch des Krieges immerhin einen Anteil von 31,4 Prozent bzw. ca. 1,37 Millionen der Gesamtbevölkerung in Bosnien ausmachten, „[…] could widen the present conflict and fuel an explosive situation especially in Bosnia-Hercegovina and also Macedonia; indeed, serious consequences could ensue for the entire Balkan region. I believe, therefore, that uncoordinated actions should be avoided.“[47]
Erst als die militärischen Auseinandersetzungen zur Belagerung Sarajevos und der Tötung von ca. 10.000 Zivilisten führten, arbeiteten Cyrus Vance im Auftrag der Vereinten Nationen und David Owen im Auftrag der EU den Vance-Owen Plan aus. Der am 4. Januar 1993 unterbreitete Plan sah vor, Bosnien in fünf autonome Provinzen aufzuteilen, einen Waffenstillstand durch Blauhelme der UNPROFOR-Mission überwachen zu lassen, die Rückkehr aller Vertriebenen zu ermöglichen, den Schutz der Rechte ethnischer Minderheiten sicherzustellen und einen politischen Rahmen zur Umsetzung der Vereinbarungen zu schaffen. Offensichtlich scheiterte der Plan kurz vor seiner Annahme daran, dass die neue US-Regierung unter Bill Clinton sowohl die bosnische als auch die kroatische Seite überzeugen konnte, sich doch nicht auf die Vorschläge einzulassen[48]. In der Folge eskalierten die Kämpfe erneut und der zunehmend ‚totale ethnische Konflikt‘ mündete in weitere Massaker an Zivilisten, wie in Ahmići (April 1993, Kroaten gegen Bosnier), Stupni Do (Oktober 1993, Bosnier gegen Kroaten) und Srebrenica (Juli 1995, Serben gegen Bosnier).
Die Kalküle der US-Regierung lagen mutmaßlich darin, den Erfolg einer unabhängigen Vorgehensweise der europäischen Regierungen zu torpedieren, den Ausgang des Bosnienkrieges im Sinne US-amerikanischer Interessen zu kontrollieren und Serbien als letztes realsozialistisches Land und Verbündeten Russlands weiter zu schwächen. „Worse, because of this, the impact of U.S. action has been to prolong the conflict while bringing it no closer to resolution.”[49] In der Konsequenz beendete der Zusammenbruch des Vance-Owen-Plans die diplomatische Unabhängigkeit der EU in geopolitischen Angelegenheiten und leitete den Übergang zu einer von Washington gesteuerten, militärisch herbeigeführten Ordnung in Europa durch das Dayton-Abkommen ein. Die US-amerikanische Dominanz in Europa manifestierte sich darüber hinaus in der allgegenwärtigen Zuständigkeit der NATO für sicherheitspolitische Angelegenheiten, was im Rambouillet-Abkommen (Februar – März 1999) einen weiteren sichtbaren Niederschlag fand. Dieses Abkommen, insbesondere der legendäre ‚Annex B’, war ein weiteres Mal „[…] part of a larger strategy orchestrated by the United States to block any possibility of a diplomatic settlement, and thus to create a pretext for war.“[50] (maschinelle Übersetzung: „… Teil einer umfassenderen Strategie der Vereinigten Staaten, um jede Möglichkeit einer diplomatischen Lösung zu blockieren und damit einen Vorwand für einen Krieg zu schaffen.“
Titelbild: Mr Frestea / Shutterstock
[«1] Vgl. Sabrina P. Ramet, Nationalism and Federalism in Yugoslavia, 1962–1991 (Bloomington: Indiana University Press, 1992); Lenard J. Cohen, Broken Bonds: Yugoslavia’s Disintegration and Balkan Politics in Transition (Boulder: Westview, 1995); Susan L. Woodward, Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution after the Cold War (Washington: Brookings, 1995).
[«2] David N. Gibbs, First Do No Harm: Humanitarian Intervention and the Destruction of Yugoslavia (Nashville: Vanderbilt University Press, 2009), 59.
[«3] Vgl. Woodward, Balkan Tragedy, a.a.O., 47-50.
[«4] Vgl. George Szamuely, Bombs for Peace: NATO’s Humanitarian War on Yugoslavia (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013), 43.
[«5] Woodward, Balkan Tragedy, a.a.O., 73.
[«6] Vgl. Gibbs, First Do No Harm, a.a.O., 69.
[«7] Vgl. Hansjakob Stehle, Die Balkanisierung des Balkans, Zeit Nr. 13/1991.
[«8] Vgl. Francis Fukuyama, The End of History?, The National Interest 16 (1989), 3-18.
[«9] Vgl. Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations?, Foreign Affairs 72:3 (1993), 22-49.
[«10] Vgl. John Gray, False Dawn: The Delusions of Global Capitalism (London: Granta, 1998),120–121
[«11] Vgl. Michael Roth, Inbegriff für kollektives Versagen, Die Welt, 05.07.2020, (zuletzt aufgerufen am 02.10.2025).
[«12] Vgl. Jasna Dragovic-Soso, Why did Yugoslavia disintegrate? An overview of contending explanations, in: Lenard J. Cohen (Hrsg.), State collapse in South-Eastern Europe: New perspectives on Yugoslavia’s disintegration (West Lafayette: Purdue University Press, 2008), 1-39, 18.
[«13] Woodward, Balkan Tragedy, a.a.O., 149. (Hbg. im Original)
[«14] Vgl. Ralph Piotrowski, Sprache und Außenpolitik: Der deutsche und US-amerikanische Diskurs zur Anerkennung Kroatiens, Univ. Diss. (Berlin, 2004), (zuletzt aufgerufen am 01.10.2025).
[«15] Gibbs, First Do No Harm, a.a.O., 46.
[«16] Raju G. C. Thomas, Self-Determination and International Recognition Policy: An Alternative Interpretation of why Yugoslavia Disintegrated, World Affairs 160:1 (1997), 17-33, 17.
[«17] Vgl. Mate Nikola Tokić, Croatian Radical Separatism and Diaspora Terrorism During the Cold War (West Lafayette: Purdue University Press, 2020), 175.
[«18] Vgl. Francesco Ragazzi, Governing Diasporas in International Relations: The Transnational Politics of Croatia and Former Yugoslavia (Abingdon: Routledge, 2017), 94.
[«19] Vgl. Gibbs, First Do No Harm, a.a.O., 69.
[«20] Vgl. Jugoslawienkriege.
[«21] Vgl. Chip Berlet, Chronology of 1988 Bush Campaign Controversy, in: Russ Bellant, Old Nazis, the New Right, and the Republican Party (Boston: South End, 1988), 124.
[«22] Vgl. Ragazzi, Governing Diasporas in International Relations, a.a.O., 82.
[«23] Vgl. Jovan Milojevich, Coercive Diplomacy as a Cause of War: Yugoslavia Revisited, Serbian Studies: Journal of the North American Society for Serbian Studies 29:1 (2018), 43–69.
[«24] Vgl. Michael Parenti, To Kill A Nation: The Attack on Yugoslavia (London: Verso, 2000), 26.
[«25] U.S. Congress, Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act, 1991, Pub. L. No. 101-513, 104 Stat. 2041 (1990), 2063.
[«26] Vgl. Donovan Kavish, Extending Sovereign Reach into Diaspora: Croatia and Eritrea in Comparative Perspective, MA-Thesis (Budapest, 2014), 20.
[«27] Vgl. Michael Parenti, The Rational Destruction of Yugoslavia.
[«28] Vgl. Kavish, Extending Sovereign Reach into Diaspora, a.a.O., 20.
[«29] Szamuely, Bombs for Peace, a.a.O., 63.
[«30] Parenti, To Kill A Nation, a.a.O., 25.
[«31] Vgl. Davor Pauković & Marko Roško, Western Newspapers and the War in Croatia, Collegium Antropologicum 47:2 (2023), 171–179.
[«32] Gibbs, First Do No Harm, a.a.O., 74. (Hbg. im Original)
[«33] Vgl. Vera Vratusa-Zunjic, The Intrinsic Connection Between Endogenous and Exogenous Factors of Social (Dis) integration: A Sketch of the Yugoslav Case, Dialogue 22-23 (1997), 21.
[«34] Vgl. Charles G. Boyd, Making Peace with the Guilty: The Truth about Bosnia, Foreign Affairs 74:5 (1995), 22-38, 23.
[«35] Vgl. Parenti, To Kill A Nation, a.a.O., 82.
[«36] Vgl. Boyd, Making Peace with the Guilty, a.a.O., 26.
[«37] Vgl. Parenti, To Kill A Nation, a.a.O., 82.
[«38] Boyd, Making Peace with the Guilty, a.a.O., 25.
[«39] Vgl. Szamuely, Bombs for Peace, a.a.O., 65.
[«40] Vgl. Woodward, Balkan Tragedy, a.a.O., 145.
[«41] Gibbs, First Do No Harm, a.a.O., 78.
[«42] Parenti, To Kill a Nation, a.a.O., 26.
[«43] Vgl. Gibbs, First Do No Harm, a.a.O., 78.
[«44] Parenti, To Kill a Nation, a.a.O., 27
[«45] Vgl. Woodward, Balkan Tragedy, a.a.O., 149.
[«46] Parenti, To Kill A Nation, a.a.O., 30-31.
[«47] Javier Pérez de Cuéllar, Letter to Hans van den Broek, 10. Dezember 1991, (zuletzt aufgerufen am 10.10.2025).
[«48] Vgl. Sarah Cécile Maurizi, The Bosnian War and the New Great Game: A Case Study in Strategy and Diplomacy, MA Thesis (St. Louis, 2012), 78-82; vgl. Gibbs, First Do No Harm, a.a.O., 142-148.
[«49] Vgl. Boyd, Making Peace with the Guilty, a.a.O., 33.
[«50] Gibbs, First Do No Harm, a.a.O., 190.