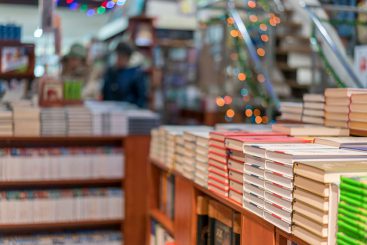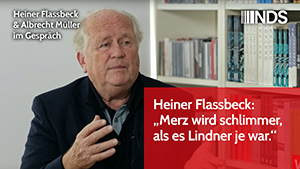Seit vielen Jahren ist in fast allen Wirtschaftsbereichen ein Trend zur Monopolisierung zu beobachten. Einige wenige große Akteure dominieren den jeweiligen Zweig und gehen gegen kleinere Unternehmen teilweise mit unlauteren Mitteln vor – auch weil sie um ihre Macht wissen. Auf dem deutschen Buchmarkt ist dafür vor allem Zeitfracht bekannt. Der Konzern mit Sitz in Kleinmachnow bei Berlin gehört neben Libri und Umbreit zu den drei wesentlichen Großhändlern – im Fachjargon „Barsortimente“ genannt. Der gesamte Buchhandel läuft praktisch über sie ab. Von Eugen Zentner.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Wer mit den Barsortimenten kooperieren will, muss sich zunächst bei ihnen bewerben. Lässt sich einer der Großhändler auf eine Zusammenarbeit ein, wird ein Vertrag geschlossen, wobei sich der jeweilige Verlag mit den Bedingungen einverstanden erklären muss. Bringt dieser dann ein Werk heraus, trägt er es samt ISBN-Nummer in das zentrale Verzeichnis lieferbarer Bücher ein. Die Barsortimente schauen regelmäßig dort hinein und entscheiden, ob sie die neu erschienenen Publikationen in ihren Lagerbestand aufnehmen. Oftmals ist das der Fall, weshalb Barsortimente fast jedes Buch über Nacht liefern können, sobald ein Buchhändler es bestellt. Jede Order wird somit über einen dieser drei Großhändler abgewickelt, ob sie nun bei Amazon, Thalia oder beim kleinen Laden um die Ecke erfolgt. Was viele Leser nicht wissen: In den meisten Fällen profitieren von einem solchen Geschäft nicht der Buchhändler und schon gar nicht der jeweilige Verlag, sondern die Barsortimente.
In Deutschland gibt es keine unmittelbare Regulierung der Preisspannen für Händler. Diese unterliegen letztendlich den Vereinbarungen der jeweiligen Parteien. Dennoch ist es nicht unüblich, dass gerade kleine Verlage den Großhändlern bei einer Bestellung bis zu 55 Prozent Rabatt gewähren müssen. Etwas höher fällt die Marge aus, wenn ein Buchhändler nicht über einen der drei Barsortimente ordert, sondern direkt beim Verlag. Vereinbart werden meist Rabatte zwischen 30 und 35 Prozent.
Diese Bedingungen sind gerade für kleinere Häuser existenzgefährdend. Im Grunde können sie nur überleben, wenn die Leser direkt bei ihnen bestellen. Doch das tun die wenigsten, entweder aus Bequemlichkeit oder, weil sie es einfach nicht wissen. Dessen sind sich die Barsortimente bewusst, insbesondere Zeitfracht, das die größten Marktanteile hat und sich aufgrund dieser Position erlaubt, die kleinen Verlage an der Nase herumzuführen. Wie das Unternehmen vorgeht, lässt sich an zwei Beispielen aus jüngster Vergangenheit zeigen.
2024 entschloss sich der Inhaber des Massel-Verlags, Martin Sell, mit Zeitfracht zu kooperieren, weil er sich dadurch eine größere Reichweite in Österreich und der Schweiz erhoffte. Als er Zeitfracht am 4. Oktober 2024 die erste Rechnung schickte, ging er davon aus, dass der Großhändler sie, wie vertraglich vereinbart, nach 90 Tagen begleichen würde. Doch es geschah nichts – auch in den Folgemonaten.
Insgesamt gingen 16 Rechnungen an Zeitfracht, im Wert von rund 6.000 Euro. Das ist ein Betrag, der kleine Verlage schnell in eine finanzielle Schieflage bringen kann. Sell, der seit 2023 kritische Sachbücher zum Zeitgeschehen verlegt und es dadurch noch schwieriger hat als die meisten seiner Mitkonkurrenten, bezeichnet diese Summe als Jahresziel. Er war auf den Forderungsbetrag angewiesen, um seinen Verlag weiter unterhalten zu können. Dementsprechend eifrig bemühte sich Sell um Aufklärung. Er schrieb E-Mails, bekam jedoch keine Antwort. Eine Reaktion blieb auch dann aus, nachdem er die ersten Mahnungen herausgeschickt hatte.
Schließlich nahm sich seine Mitarbeiterin der Sache an. Sie telefonierte und recherchierte, verfing sich aber in kafkaesken Strukturen. Sie probierte es zunächst unter mehreren Nummern am Standort in Stuttgart. Dort konnte ihr keiner weiterhelfen – oder wollte es nicht. Sie versuchte es dann an einem anderen Standort und bekam die Information, dass alle Mitarbeiter von der Chefetage die Erlaubnis hätten, nicht ans Telefon zu gehen. Aufgrund zahlreicher Beschwerden machen davon offenbar viele Gebrauch. Zugleich sagte ihr die Ansprechpartnerin freiheraus, dass Zeitfracht das Geld wohl nicht überweisen werde. Die Methode dieses besonders großen Großhändlers war also bekannt, nicht nur unter den Mitarbeitern, sondern auch unter diversen kleinen Verlagen. Als Sells Mitarbeiterin sich mit einigen in Verbindung setzte, berichteten sie ihr von den gleichen Erfahrungen: Der Großhändler bezahlt einfach nicht und reagiert auch nicht auf die Anschreiben.
In einer solchen Situation bleibt kleinen Verlagen nur der Rechtsstreit. Doch der kostet Geld. Zusätzlich ergibt sich das Problem, einen geeigneten Anwalt zu finden, der ein solches Mandat mit einem für ihn relativ niedrigen Streitwert annimmt. Zum finanziellen Aufwand kommen somit Strapazen hinzu sowie nervliche Anspannung und Zeitverlust. Ein so großer Akteur wie Zeitfracht weiß das; er weiß, dass nur wenige diesen Schritt wagen. Also bringt er sie in Zugzwang und lässt es darauf ankommen.
Wie unangenehm eine solche Geschäftsbeziehung mit Zeitfracht sein kann, weiß auch die Verlegerin Gesa Schöning zu berichten. Seit 2023 betreibt sie Etica.Media, ein ebenfalls kleines Haus, das überwiegend Bücher im Bereich der Gegenöffentlichkeit herausbringt. Zuvor war sie über zehn Jahre im Verlagswesen tätig gewesen, bevor sie selbstständig wurde. Ihr erster Verlag trug den Namen „Kirschbuch“. Obwohl es ihn schon seit einem Jahr nicht mehr gibt, verlangt Zeitfracht weiterhin eine höhere Geldsumme für Bücher, die der Großhändler vor fünf Jahren bestellt und nun zusammen mit einer Zahlungsaufforderung zurückgeschickt hatte. Nicht selten vereinbaren Barsortimente im Vertrag ein 100-prozentiges Remissionsrecht ohne zeitliche Begrenzung. Insofern sind Zeitfrachts Forderungen nicht zu beanstanden, aber sie bringen die Betreiber kleinerer Verlage in finanzielle Schwierigkeiten. Im Fall Schönings wirkt sich das insofern negativ aus, als durch die Rückzahlungen Mittel gebunden werden, die sie nicht als Ausgaben einkalkuliert hat.
Doch das ist nicht das einzige Problem, das ihr der Großhändler bereitet. Anders als Sell hat Schöning kein eigenes Lager, weshalb sie die Dienste eines Auslieferers in Anspruch nimmt. Das Logistikunternehmen ist eine Art Bindeglied zwischen kleineren und mittleren Verlagen und Großhändlern. Während Sell Buchauslieferung und Rechnungsstellung an Zeitfracht selbst erledigt, übernimmt es in Schönings Fall ein Fulfillment-Unternehmen. Dieses musste jedoch die gleichen Erfahrungen machen: Zeitfracht bezahlte über mehrere Monate keine Rechnungen, reagierte nicht auf Mahnungen und überwies die geforderte Summe erst dann, nachdem Schönings Auslieferer die Lieferungen gestoppt hatte. Dieses Prozedere wiederhole sich immer und immer wieder, sagt die Verlegerin.
Auch Sell ist mittlerweile an sein Geld gekommen, allerdings nur an den offenen Betrag aus den Rechnungen bis Januar. Zeitfracht beglich sie gerade zu dem Zeitpunkt, als der Münchner Verleger beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels die Aufnahmeunterlagen für eine Mitgliedschaft einreichte. Sell zielt damit unter anderem auf eine kompetente Rechtsberatung und institutionelle Hilfe ab, um Zeitfracht von seiner Hinhaltetaktik abzubringen.
Doch der Großhändler macht weiter Probleme. Abgesehen davon, dass ein Teil der Rechnungen nicht beglichen worden war, schickte er Sell 100 Exemplare des Werks „Der Super-Faschismus“ von Lisa Marie Binder zurück und machte von seinem Remissionsrecht Gebrauch, indem er dafür Geld forderte, das er lange Zeit zurückgehalten hatte. Besonders pikant: Sell hatte diese Bücher on demand drucken lassen und dafür sofort bezahlen müssen. Zudem sind die zurückgekommenen Exemplare in einem „miserablen Zustand“, wie der Verleger sagt. Es sei geradezu unmöglich, sie noch zu verkaufen. Hätte Zeitfracht damals weniger bestellt, hätte Sell keine so teure Überproduktion und nun auch keine unnötige Lagerhaltung.
Immerhin gelang es dem Verleger, einen Ansprechpartner dazu zu bewegen, eine Antwort-Mail zu schreiben. Darin wurde sogar zugesichert, die Differenz zwischen den offenen Forderungen und dem Betrag für die zurückgesandten Exemplare von „Der Super-Faschismus“ zeitnah zu überweisen. Doch das ist bis heute nicht geschehen.
Mit solchen Methoden kann Zeitfracht einen kleinen Verlag ganz einfach ruinieren. Andersherum hätte der Großhändler einen Hebel, die zurückgesandten Bücher in die Buchhandlung zu bringen und so für Vielfalt zu sorgen, wie Sell findet. „Dadurch würde er uns und anderen kleinen Verlagen eine Chance geben, auf dem Markt zu bestehen. Das wäre mehr soziale Marktwirtschaft und etwas weniger Haifisch-Kapitalismus.“
Dass hinter Zeitfrachts Gebaren Kalkül steckt, vermutet nicht nur Sell, sondern auch Schöning. Sie glaubt, dass der Großhändler die Rechnungsmodalitäten bewusst so lange ausreizt, bis die kleinen und mittleren Akteure auf dem Buchmarkt das Handtuch werfen. Nach ihrer Beobachtung gibt es zwischen Barsortimenten, großen Verlagshäusern und Händlern personelle wie institutionelle Verbindungen. So manche Großinvestoren sind in allen drei Sparten an den immer gleichen Unternehmen beteiligt. Deswegen bestehe das Interesse daran, die Marktanteile in der Hand einiger Weniger zu konzentrieren, sagt Schöning. Auch sie sieht einen Trend zur Monopolisierung auf Kosten der kleineren Akteure. Damit geht auch in diesem Wirtschaftssegment die Vielfalt verloren. Für eine liberale Demokratie, die Pluralismus zu ihren Grundkonstanten zählt, ist das eine gefährliche Entwicklung.
Titelbild: Petrychenko Anton/shutterstock.com