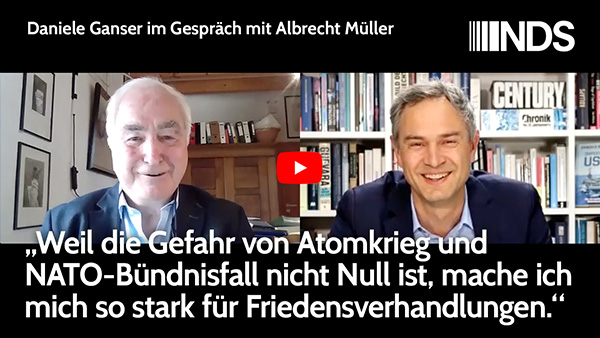Die in Deutschland und Europa grassierende Vogelgrippe steuert auf eine neue Rekordsaison zu. Einmal mehr gibt es das große Sterben in der Natur und in den Großställen der Geflügelindustrie. Über die Ursachen des Desasters herrscht weitgehend Konsens, über die Konsequenzen ebenso. Die Politik lässt dem Kommerz trotzdem freien Lauf. Union und SPD wollen sogar mehr davon. Schlecht bekomm’s. Von Ralf Wurzbacher.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Kraniche fallen tot vom Himmel oder verenden elendig in Seen, Teichen oder Feuchtgebieten. Dazu Berge von Geflügelkadavern, in Containern entsorgt, nachdem die Tiere im Gas qualvoll den Erstickungstod gestorben sind. Es ist kein schöner Anblick, der sich dieser Tage in freier Natur oder auf dem Fernsehbildschirm im heimischen Wohnzimmer bietet. Aber wohl einer, an den man sich wird gewöhnen müssen. Die Vogelgrippe fegt seit mehreren Wochen über weite Teile Deutschlands, Europas und Nordamerikas hinweg. Es ist schon jetzt die drittschwerste Welle, die die BRD seit dem ersten Auftreten der Variante H5N1 vor bald 30 Jahren erfasst hat. Die schlimmsten Seuchenzüge hatte es 2021 und 2022 gegeben. Vor vier Jahren hatte der Erreger nach amtlichen Zahlen 286 Geflügelfarmen, Zoos und private Haltungen befallen, und zwei Millionen Hühner, Puten und Enten wurden von Menschenhand getötet, nebst zahllosen Wildvögeln, die das Virus niederstreckte.
Allerdings grassierte die Vogelgrippe in den zurückliegenden zehn Jahren noch nie so früh in der Saison wie diesmal. Zwischen Ende August und Mitte Oktober registrierten Behörden Ausbrüche in zehn EU-Staaten. Mittlerweile sind Nutztierbestände in über 20 europäischen Ländern betroffen, in mehr als 30 wurden Fälle der hochpathogenen Aviären Influenza (HPAI) in freier Wildbahn bestätigt. Daneben wurde bei einer Möwe auf Madeira, der portugiesischen Inselgruppe vor der Nordwestküste Afrikas, das stark toxische H7-Virus nachgewiesen. Auch das ein Novum. Hierzulande hat die Seuche bis dato über 100 landwirtschaftliche Geflügelfarmen heimgesucht, schwerpunktmäßig in Norddeutschland, etwa Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Deutlich mehr als eine halbe Million Tiere sind getötet worden. Aber ebenso in Süddeutschland, in Baden-Württemberg und Bayern, geht das Virus inzwischen um. Zu befürchten ist, dass bei anhaltender Intensität der „Rekord“ von 2021 demnächst gebrochen wird.
Kranich ist schuld!?
Wie immer bei solchen Ereignissen stellt sich die Schuldfrage. Für die Geflügelindustrie ist der Fall klar: Der Erreger wurde von Wildvögeln eingeschleppt und hat von dort auf die Zuchtbetriebe übergegriffen. Allerdings hält das Gros der Experten dagegen. Demnach werden die Viren vor allem in den großen kommerziellen Geflügelfarmen freigesetzt und bahnen sich von dort den Weg in die Natur. Dafür spricht schon die Historie: Tatsächlich ist H5N1 im Jahr 1996 erstmals in einer Geflügelzucht in Südchina aufgetaucht, in der viele Enten in halbwilder Freilandhaltung auf engem Raum gehalten wurden. Vermutlich trat das Virus von dort aus seinen Vernichtungsfeldzug mit Hunderten Millionen Opfern um die Erde an.
Auch aktuell gibt es Indizien, die diese Version stützen. Nach Angaben des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) ist das Virus schon „in fünf Bundesländern in 15 Geflügelhaltungen“ festgestellt worden, ehe die ersten Kraniche verstarben. Die Entlüftungen der Tierfabriken und das Ausbringen von Geflügeldung auf die Maisäcker seien mögliche Ausbreitungswege. „Hingegen fliegt kein Kranich in eine geschlossene Stallung und verbreitet dort das Virus.“ Das klingt logisch. Wahrscheinlich sind Kraniche und andere Wildvögel nicht die Überbringer der Geflügelpest, sondern ihre ersten Opfer. Sie halten sich in diesen Wochen zu Hunderttausenden in Deutschland auf, um auf ihrer Route aus den osteuropäischen Brutgebieten in ihr Winterquartier im warmen Süden zu rasten und Kraft für die Weiterreise zu tanken. Stattdessen finden sie in Massen den Tod.
Australien abgenabelt
Aber weshalb richtet die Vogelgrippe speziell in der nördlichen Hemisphäre so viel Unheil an? Australien zum Beispiel blieb bisher komplett verschont, obwohl auch dort alljährlich sehr viele Zugvögel, aus der Arktis kommend, anlanden. Das lenkt den Verdacht auf eine andere, vielleicht die schwerwiegendste Quelle der Seuche. Der fünfte Kontinent importiert nur sehr geringe Mengen an Geflügel aus Übersee, über 99 Prozent des Verbrauchs werden aus heimischer Produktion gedeckt. Dahinter stehen strenge Einfuhrbestimmungen zum Schutz von Natur, Tierwelt und Verbrauchern vor Schädlingen und Krankheiten. Wo dagegen solche Regeln fehlen, hat H5N1 augenscheinlich leichtes Spiel.
Viele Wissenschaftler sehen deshalb im weltumspannenden Netz aus legalem Geflügelhandel und illegalem Wildtierschmuggel den Hauptherd für globale Epidemien. Auch die renommierte britische Naturschutzbiologin Diana Bell hat keinen Zweifel: „Milliarden von Vögeln werden so jedes Jahr rund um den Globus bewegt – eine menschengemachte Vogelwanderung.“ Wie sie in einem Interview mit der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft im März 2024 (hinter Bezahlschranke) erklärte, seien bei Ausbrüchen in vielen Ländern illegale Einfuhren als Ursache nachgewiesen worden, beispielsweise in Großbritannien, Kanada oder Italien. Selbst die ersten vor 30 Jahren von China ausgehenden Fälle im Westen seien so zu erklären, weil die Zugvögel zu der fraglichen Jahreszeit „in eine ganz andere Richtung“ unterwegs seien. „Es ist eben einfacher, wilde Vögel verantwortlich zu machen, als sich mit einer Milliardenbranche wie der Geflügelindustrie anzulegen.“
Erreger aus dem Brutkasten
Die moderne Massentierhaltung bietet „optimale“ Bedingungen zur Entstehung und Verbreitung von Viren. Mast- und Legefabriken mit Tausenden, Zehntausenden und mehr Federvieh auf engstem Raum bei mangelnder Hygiene und exzessivem Medikamenteneinsatz sind Brutstätten für alle möglichen Keime. Die Tiere sind permanent gestresst und als „Laborzüchtungen“ genetisch sehr gleichförmig, was einen Massenbefall mit Erregern und die Bildung von Mutationen begünstigt. Während jedoch Wildvögel für die Nahrungssuche zu geschwächt sind und rasch zugrunde gehen, werden infizierte Nutztiere weiter gefüttert. So können Viren auch in angeschlagenen Wirten überleben und so auf Artgenossen übergreifen. „Wenn man so will, wird diese hochpathogene Variante vom Menschen in der Geflügelzucht künstlich am Leben gehalten“, zitierte Spektrum der Wissenschaft in einem Bericht vom Montag (hinter Bezahlschranke) den Tiermediziner Oliver Krone vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW).
Die Wege der Keime aus den Geflügelfarmen ins Freie sind vielfältig, wie in einem neueren Beitrag der „Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt“ zu lesen ist. Neben dem Handel mit Tieren und Tierprodukten kommen kontaminierte Personen, Gegenstände, Streu und Futtermittel aus betroffenen Betrieben in Betracht. Das Forschungsprojekt Delta FLU der Europäischen Union, koordiniert vom deutschen Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), kam 2023 zum Ergebnis, dass menschliche Aktivitäten häufig die Ursache für neue Ausbrüche sind. Die EU-Agentur für Lebensmittelsicherheit EFSA stellte für einen Dreimonatszeitraum im Jahr 2022 fest, dass 86 Prozent der Ausbrüche in Europa „sekundär auf die Ausbreitung des HPAI-Virus zwischen den Betrieben zurückzuführen waren“.
Gefahr rückt näher
Auch eine Task-Force der Vereinten Nationen unter Beteiligung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nennt die landwirtschaftliche Vogelhaltung als Ursprung der aktuellen Geflügelpest. In einem Beitrag auf den Webseiten der EU-Kommission aus dem Jahr 2023 wird der Ursprung der Seuche auf 1996 in China datiert als „Folge der raschen Expansion des kommerziellen Enten- und Geflügelsektors“. Sie habe dann auf Wildvögel und „in seltenen Fälle auf Menschen“ übergegriffen. Spätestens hier wird die Bedrohung greifbar. Tatsächlich gibt es bis heute schon weit über 400 menschliche Todesfälle im Zusammenhang mit H5N1. Im Falle einer Infektion ist die Mortalität beachtlich hoch. Betroffen sind zumeist Personen in engem Kontakt zu landwirtschaftlich gehaltenen Vögeln. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch wurde bisher nicht nachgewiesen und wird unter Forschern, Stand jetzt, für unwahrscheinlich erachtet.
Eine Sicherheit für alle Zeiten ist das nicht. Nicht nur deutet ein Massensterben unter Nerzen in einer spanischen Pelzfarm im Oktober 2022 darauf hin, dass H5N1 sehr wohl von Säuger auf Säuger überspringen kann. Todesfälle gab es auch schon bei Katzen, Bären, Waschbären, Füchsen, Ottern, Robben, Kleinwalen und Seeelefanten. Beängstigend ist aber vor allem die Lage in der Vogelwelt, wo es immer mehr Gattungen trifft: Seeschwalben, Möwen, Kormorane, Basstölpel, Schwäne, Fasane, Greifvögel. Mit jeder neuen Welle, zumal bei größerer Häufung, werden mehr Tiere weggerafft und geraten mehr Arten in Gefahr. So als setzten ihnen schrumpfende Lebensräume, Verschmutzung und der Klimawandel nicht schon schwer genug zu.
Freiraum statt Panzer
Und dann sind da noch die Massen an Zuchttieren, die bei Verdacht vorsorglich ausgelöscht werden. Wenn in einem der gängigen Riesenställe nur ein Küken erkrankt ist, werden mit ihm Zehntausende in den Tod geschickt. Das ist allemal billiger, als sie zu impfen und tierärztlich zu überwachen. Schonung verspricht bei Gefahr im Verzug nur die Aufstallung, indem auch alle Freiland- und Biohühner in Käfige gepfercht werden, ohne Frischluft und Tageslicht. Vielleicht zeitigt die Sache aber auch etwas Gutes und stößt ein allgemeines Umdenken an. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentierte dazu treffend: „Für den Moment lenkt diese Tragödie die Aufmerksamkeit darauf, dass es hierzulande nicht nur Putensteaks, Hähnchenkeulen und Entenbrust gibt, sondern tatsächlich auch Puten, Hühner und Enten.“ Die werden schließlich auch in Normalzeiten gequält und im Eilverfahren auf Schlachtreife oder maximale Eierzahl hochgezüchtet. Bloß nimmt kaum einer Notiz davon.
Die Frage ist, ob wir diesen Preis und die vielen ökologischen Verwüstungen, die die Massentierhaltung provoziert, weiter zahlen wollen – nur weil uns ein Brathähnchen für fünf Euro so wichtig ist. Gefragt ist dabei zuallererst die Politik, die endlich die Weichen auf einen nachhaltigen Umgang mit Tier und Natur stellen muss. Jedes Jahr Vogelgrippe wird auf lange Sicht teurer als eine gezielte Förderung kleinbäuerlicher Strukturen mit überschaubaren Beständen, die ein Leben in Würde leben dürfen, und Bemühungen in Richtung einer allgemeinen Lebensstiländerung, die Flora und Fauna schont. Es geht nicht darum, den Menschen vorzuschreiben, was sie zu essen haben, sondern sie in die Lage zu versetzen, sich bewusster und gesünder zu ernähren. Dazu kann ein maßvoller Konsum von qualitativ besserem Fleisch gehören. Mit nur ein paar Milliarden Euro, die man nicht in Panzer und Drohnen steckt, wäre in der Hinsicht schon vieles zu bewegen.
Nicht mit dieser Bundesregierung: Die ist im Begriff, all das abzuräumen, was in puncto nachhaltiger Tierhaltung wenigstens in Ansätzen in die richtige Richtung hätte gehen können. Und sie will, dass die deutsche Fleischbranche noch mehr exportiert und dafür noch mehr Vieh ausbeutet. Solche Politiker zu wählen oder es zu lassen, könnte in vielleicht gar nicht so ferner Zukunft zu einer Überlebensfrage werden. Mindestens aber zu einer Frage des guten Geschmacks.
Titelbild: PeopleImages/shutterstock.com