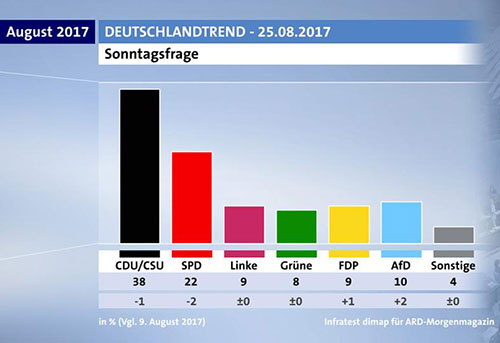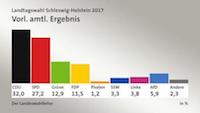Merkel-Land ist ein hohles Land. Mit viel Protz und wenig Empathie. 14 gute Gründe dafür, Angela Merkel nicht zu wählen.
Es geht dabei um nüchterne Feststellungen zur Bilanz von Angela Merkel. Die einzige Bitte an Sie, unsere Leserinnen und Leser: Bitte weitergeben und weitersagen – auch noch in den letzten Tagen vor der Wahl, damit die Nebelwand der Merkel-nahen Stimmungsmache beiseitegeschoben wird. Die Medienbewunderung für die jetzige Bundeskanzlerin ist nämlich sachlich nicht begründet. Jens Berger und Albrecht Müller.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.