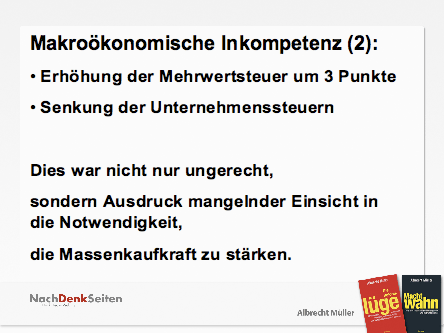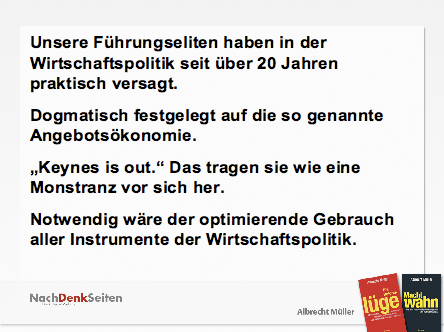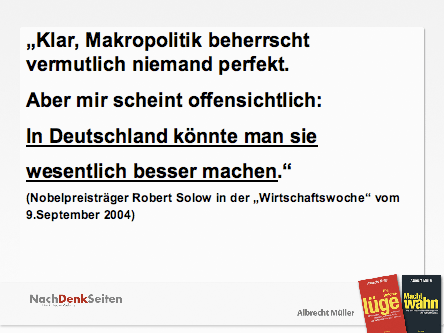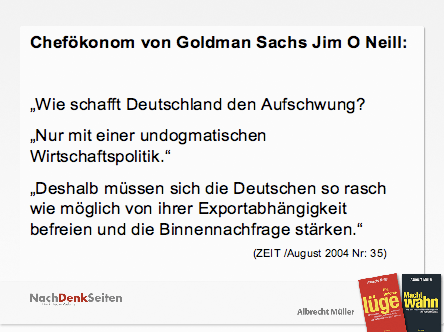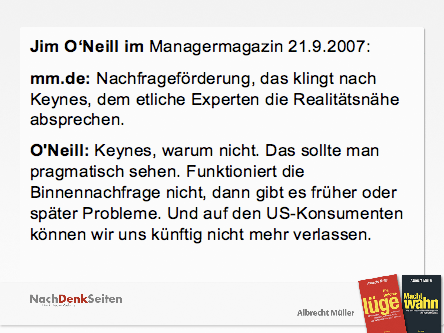Zum Versagen der Nationalökonomie. Der Schaden ist groß. Nach dem Verursacherprinzip wären Sanktionen angebracht.
Am 5. April widmete sich FAZNET dem Thema. Siehe Anlage 1. Ein lesenswerter Artikel; immerhin bestätigen die Autoren die Existenz und die Gefahr des Herdentriebs. Einiges fehlt und einiges ist falsch gesehen. Die Autoren analysieren zum Beispiel nicht, dass von einigen Ökonomen schon seit längerem die Unfähigkeit ihrer Kollegen zu einer vernünftigen Makropolitik explizit beschrieben worden ist, dass vor den Gefahren hoher Leistungsbilanzdefizite in den USA und entsprechender Überschüsse hier bei uns gewarnt wurde, und auch vor den Gefahren der Spekulation. Sie sehen nicht, dass das Versagen der in Expertengremien und in der veröffentlichten Meinung präsenten Ökonomen viel mit ihrer Interessenverflechtung mit Wirtschaft und Arbeitgebern zu tun hat. Albrecht Müller
- Die Fehleinschätzung der ökonomischen Entwicklung und die Unfähigkeit zur Optimierung der makroökonomischen Instrumente. Das hat etwas mit der Fixierung auf die Interessen der exportorientierten Großindustrie und auf Arbeitgeberinteressen zu tun.
Die vorherrschenden Ökonomen haben seit Jahren die ökonomische Entwicklung falsch eingeschätzt und vor allem falsch interpretiert. So haben sie fast alle das bisschen wirtschaftliche Belebung der Jahre 2005-2007 zum Boom erklärt, weil sie nicht weitere, die Konjunktur stützende Maßnahmen des Staates wollten. Die Mehrheit von ihnen wollte immer schon vermeiden, dass die Arbeitnehmer wieder in eine ebenbürtige Wettbewerbsposition auf dem Arbeitsmarkt kommen. Die meisten Wissenschaftler vertreten die Interessen der Arbeitgeberseite. Deshalb waren viele unterschwellige Vertreter einer Reservearmee von Arbeitslosen.
Das war vermutlich zum Beispiel auch der Hintergrund der Einlassung des Sachverständigenrates im Gutachten vom November 2000, die Konjunktur „laufe rund“. Wer genau hinschaute, wusste, dass dies nicht stimmt. Auch im Jahre 2000 gab es eine hohe Arbeitslosenrate von 10,7 %. Wie kann man da zu der Einschätzung kommen, die Konjunktur laufe rund? Die damalige Fehleinschätzung hatte Wirkung. Mit ihrem falschen Spruch hat der Sachverständigenrat den damaligen Bundesfinanzminister Eichel und die Bundesbank in ihrer prozyklischen Bremspolitik unterstützt. Sie sind mitverantwortlich für den Abbruch des kleinen Aufschwungs von 1997 bis 2001 und somit für den Verlust an Volkseinkommen und das Arbeitslosenschicksal vieler Menschen. Dafür sollten sie eigentlich büßen müssen! Weil sie nicht nur irrtümlich, sondern willentlich falsch beraten haben.
Die Autoren der FAZ gehen nicht darauf ein, dass vermutlich die Mehrzahl der Ökonomen oft auch deshalb falsch gelegen hat, weil sie mit ihrer Prognose eine bestimmte Politik initiieren wollten.
In den Jahren 2007 und 2008 haben die Forschungsinstitute wohl auch deshalb falsch prognostiziert, weil sie konjunkturpolitische, expansive Maßnahmen vermeiden wollten. Sie wollten mit ihren Prognosen noch bis in den Sommer 2008 hinein die restriktive Politik der Europäischen Zentralbank stützen.
Außerdem wollten sie mit allen Mitteln die Behauptung unterstützen, die Reformpolitik zeige auf dem Arbeitsmarkt und bei der wirtschaftlichen Entwicklung eine positive Wirkung.
Hinter den Fehlprognosen stecken also häufig auch politische Motive.
Der Artikel berichtet leider zu wenig von jenen Ökonomen, die die Unfähigkeit zu einer vernünftigen makroökonomischen Politik schon seit langem gesehen und kritisiert haben. Die eigenen Hinweise darauf in den NachDenkSeiten, in der „Reformlüge“ und in „Machtwahn“ lassen wir mal beiseite.
Zu erwähnen bleiben aber zum Beispiel der Bundesfinanzminister von 1998 bis 99, Oskar Lafontaine und sein Staatssekretär Heiner Flassbeck. Sie haben damals die Verwerfungen in den internationalen Währungsbeziehungen gesehen und wollten intervenieren. Daraus folgte ja gerade die leidenschaftliche Feindschaft der vielfach mit der Finanzindustrie verwobenen Medien und Politik gegen Lafontaine (siehe britische Sun mit der Schlagzeile: „Der gefährlichste Mann Europas“).
Mit Respekt zu erwähnen sind bei uns das IMK der Hans-Böckler-Stiftung und die Memorandum-Gruppe z.B.. Zu erwähnen sind weiter der Nobelpreisträger Robert Solow und der Chefökonom von Goldman Sachs, Jim O’Neill, mit Äußerungen vom August und September 2004. In Anlage 2 finden Sie interessante Auszüge aus einem Interview mit Jim O’Neill in der ZEIT vom August 2004. (Nicht allen seinen Äußerungen stimme ich zu, vor allem nicht den Belobigungen für die Agenda 2010 und für Strukturreformen sowie seine von Unkenntnis getrübten Einlassungen zu den Ladenöffnungszeiten).
O’Neill wunderte sich über die Borniertheit seiner deutschen Kollegen, über ihre dogmatische Feindschaft gegenüber Keynes und ihre damit bewiesene Unfähigkeit, die verschiedenen Instrumente der Ökonomie pragmatisch einzusetzen. Jim O’Neill hat auch auf die absurde Vorstellung seiner deutschen Kollegen hingewiesen, man müsse die Steuern der Spitzenverdiener und Unternehmen senken, statt den Wenigverdienern mehr Kaufkraft zukommen zu lassen.
Und dann hat er damals – 2004 – deutlich gemacht, welche Gefahren für Deutschland daraus folgen, dass die Leistungsbilanzdefizite in den USA steigen, während in Deutschland versäumt wird, die Binnenkonjunktur anzukurbeln. Er wies darauf hin, was es für uns bedeuten kann, wenn der Dollar in den Keller geht. Andere haben in ähnlicher Form schon damals auf diese Gefahren aufmerksam gemacht.
Das ist immerhin schon fast fünf Jahre her.
Robert Solow hat in einer klassischen Einlassung seinen deutschen Kollegen eine Brücke zu bauen versucht, indem er konzedierte, dass Makroökonomie schwierig sei. Aber er konnte sich dann doch die Anmerkung nicht verkneifen, eines sei sicher, man könne Makropolitik besser machen, als dies in Deutschland geschieht. Recht hat er.
In Anlage 3 habe ich dazu einige Folien zusammengestellt, die ich in Vorträgen und Lesungen beginnend mit dem September 2004 benutzte. - Kein Sensor für die Gefahren des Casinobetriebs, im Gegenteil Bewunderung
Die meisten deutschen Ökonomen hatten und haben vermutlich immer noch keinen Sensor für die Gefahren des Casinobetriebs. Sie haben die Blasenbildung eher bewundert; auch hier wieder an vorderer Front der Sachverständigenrat in seinem Gutachten vom November 2000 mit einer euphorischen Begrüßung der boomartigen Aktienentwicklung im IT-Bereich (da hatte übrigens schon der Zusammenbruch des Booms begonnen). - Zur Interessenverflechtung
Die beiden Autoren der FAZ gehen leider auch nicht auf die Interessenverflechtung vieler Wissenschaftler und die daraus folgenden Fehlprognosen und Fehlberatungen ein. Hierzu nur ein paar Beispiele:
Klaus Zimmermann (Präsident des DIW und zugleich Direktor des IZA, das der Niedriglohnlobby zuarbeitet), Raffelhüschen, van Suntum, Rürup, Sinn, Miegel, Börsch-Supan und viele mehr vertreten wirtschaftliche Interessen oder sind mit ihnen eng verflochten und geraten damit bei ihrer scheinbar wissenschaftlichen Arbeit in Kollision.
Konsequenzen:
Das Mindeste ist: Staatliche Förderung von Wissenschaftlern sollte es nur noch geben, wenn sie keine anderen Interessen vertreten oder von solchen Interessen mitfinanziert werden. Wir sollten die Institute der Wirtschaftswissenschaft zwingen, sich von ihren Chefs zu trennen, wenn diese weiterhin in Aufsichtsräten etwa von Versicherungsgesellschaften tätig sind, nebenher noch ein privates, von wirtschaftlichen Interessenverbänden oder von Firmen finanziertes Institut betreiben – wie Klaus Zimmermann z.B. oder Aufträge von Lobbyorganisationen entgegen nehmen.
Es sollte auch klar sein, dass sich Wissenschaftler zwischen ihrer Professur und privatwirtschaftlicher Interessenvertretung entscheiden müssen. Heute ist es nämlich so, dass viele ihr Renommee aus der Professur ziehen und dieses Renommee für die privaten Interessen einsetzen, und dass dann umgekehrt wiederum die Wahrnehmung ihrer privaten Interessen ihre Arbeit und ihre Äußerungen als Professor mitbestimmt.
Das sind alles unerträgliche Entwicklungen; sie sind nicht ganz neu, aber das ist kein Grund, damit fortzufahren.
Anlage 1
Viele Wissenschaftler sehen ein Versagen. Was ist schiefgelaufen? Die Ökonomen in der Sinnkrise
Von Lisa Nienhaus und Christian Siedenbiedel
05. April 2009 Es ist erstaunlich, dass alles trotzdem weitergeht. Während so manches Unternehmen sich weigert, überhaupt noch einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr zu wagen, scheint die Vorhersage für die gesamte Volkswirtschaft weitaus einfacher zu sein. Die professionellen Prognostiker jedenfalls machen weiter. Komme, was da wolle, sie geben ihr Votum ab. Minus drei Prozent, minus vier Prozent, minus fünf Prozent: Munter korrigieren sie das Wachstum nach unten – mit gewohnter Verve und Überzeugung.
Ein Frechdachs, wer nachzuschlagen wagt, was sie vor einem Jahr gesagt haben. Doch aufschlussreich ist es in jedem Fall. Anfang 2008 war die Welt nämlich noch in Ordnung. Die Ökonomen sprachen von einer Abkühlung im Jahr 2009. Ein Wachstum von 1,2 Prozent, 1,5 Prozent, 1,8 Prozent sei zu erwarten, hieß es damals, aber weiß Gott keine Rezession, nicht einmal Stagnation. Ach ja.
Dann kam die Krise – und mit ihr wurde offenbar, wie sehr die professionellen Prognostiker in Deutschland danebengelegen haben. Sie haben sich täuschen lassen, sind kollektiv der Illusion erlegen, die Finanzmärkte seien stabiler, als sie es tatsächlich waren. Sie haben die Kreditkrise erst nicht kommen sehen – und dann nicht geglaubt, dass sie sich zur Wirtschaftskrise auswachsen würde.
Jeder hätte warnen können
Das Versagen betrifft nicht nur die Institute der Konjunkturforscher. Es betrifft alle Ökonomen. Jeder von ihnen betrachtet die Weltwirtschaft oder Teile von ihr mit einiger Aufmerksamkeit. Jeder hätte warnen können. Doch kaum einer hat erkannt, was kommen könnte. Und die wenigen, die etwas ahnten, haben nicht laut genug um Hilfe gerufen.
Jetzt hat die Wirtschaftskrise die Ökonomen in eine Sinnkrise gestürzt. Die Debatte hat gerade erst begonnen. Die Fragen lauten: Was ist da schiefgelaufen? Und was kann Ökonomie überhaupt?
Quelle: FAZ
Anlage 2: Auszüge/Interview von DIE ZEIT (35/2004 ) mit Jim O’Neill
»Ein absurdes Verständnis von Wirtschaft«
Wie schafft Deutschland den Aufschwung? Nur mit einer undogmatischen Wirtschaftspolitik, sagt Jim O’Neill, Chefvolkswirt der US-Investmentbank Goldman Sachs. Ein ZEIT-Gespräch über Steuerschecks, Staatsschulden und das Weltbild deutscher Ökonomen
DIE ZEIT: Mister O’Neill, der Ölpreis steigt und steigt, überall sinken die Aktienkurse. Steht die Welt mit einem Bein in der nächsten Rezession?
Jim O’Neill: So weit ist es noch lange nicht. Allerdings sind wir an einem Wendepunkt. In den Vereinigten Staaten schwächt sich das Wachstum schon wieder ab, ich rechne dort demnächst nur noch mit drei Prozent. Das wird viele Investoren enttäuschen und den Rückzug aus dem Dollarraum antreten lassen. Der Dollar gerät dann unter Druck.
ZEIT: Welche Folgen hat das für Europa?
O’Neill: Keine guten. Ich gehe davon aus, dass der Euro weiter aufwertet. Noch vor Ende des Jahres wird der Kurs des Euro bei 1,32 Dollar stehen.
ZEIT: Was macht Sie so pessimistisch?
O’Neill: Das amerikanische Leistungsbilanzdefizit. Allein die asiatischen Zentralbanken finanzieren dieses Defizit, indem sie sich mit Dollarkäufen gegen eine Aufwertung ihrer eigenen Währung stemmen. Zudem gehen die ausländischen Direktinvestitionen in den USA massiv zurück. Insgesamt hat Amerika eine Finanzierungslücke von gut sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist langfristig nicht durchzuhalten. Irgendwann hören die asiatischen Zentralbanken auf, Dollar zu kaufen. Und dann kennt der Dollar nur eine Richtung – nach unten.
ZEIT: Und Deutschland?
O’Neill: Wird dann große Probleme bei den Exporten bekommen. Deshalb müssen sich die Deutschen so rasch wie möglich von ihrer Exportabhängigkeit befreien und die Binnennachfrage stärken.
ZEIT: Die meisten deutschen Ökonomen sehen den Handlungsbedarf nicht auf der Nachfrageseite der Volkswirtschaft, sondern auf der Angebotsseite – und fordern deshalb noch weitergehende Strukturreformen, etwa am Arbeitsmarkt.
O’Neill: Natürlich sind Strukturreformen wie die Agenda 2010 enorm wichtig. Aber ich halte auch längere Arbeitszeiten für eine gute Sache. Einer der Hauptgründe, warum die US-Wirtschaft in den vergangenen zehn Jahren so gut abgeschnitten hat, ist die längere Jahresarbeitszeit. Oder nehmen Sie die Ladenöffnungszeiten. Warum werden die in Deutschland nicht freigegeben? Ich war gerade auf Korsika im Urlaub. Das ist verrückt mit diesen Ladenöffnungszeiten in Kontinentaleuropa! Europa kann sein Wachstumspotenzial nur steigern, wenn alte Verkrustungen aufgebrochen werden. Kurzfristig allerdings helfen längere Arbeitszeiten bei einer Konsumschwäche wie in Deutschland nicht weiter. Neue Jobs entstehen dadurch erst einmal nicht. Deshalb müssen die Reformen flankiert werden, um den Konsum anzukurbeln. Und zwar am besten mit einer fantasievollen Fiskalpolitik.
ZEIT: Das heißt konkret?
O’Neill: Weil die Reichen von ihrem Einkommen relativ weniger für Konsum ausgeben als die Armen, muss die Fiskalpolitik bei den unteren Einkommensgruppen ansetzen. Dieser Aspekt wird von vielen deutschen Ökonomen und Politikern vernachlässigt.
ZEIT: Warum?
O’Neill: Ich war vor ein paar Wochen in Berlin. Da ging es um ein effizienteres Steuersystem, das das Wachstum fördert. Erst dachte ich, ich habe die Vorschläge nicht richtig verstanden. Doch bald wurde mir das absurde Verständnis von Makroökonomie klar. Wir haben tatsächlich ernsthaft diskutiert, ob man nicht die Unternehmensteuern senken und im Gegensatz die Umsatzsteuer anheben sollte. Da haben die Unternehmerverbände gute Lobby-Arbeit geleistet. Aber dass es überhaupt diskutiert wird, ist wirtschaftspolitisch nicht zu Ende gedacht. Dann können sich die deutschen Konsumenten noch weniger kaufen. Eine höhere Umsatzsteuer würde der Volkswirtschaft endgültig den Garaus machen. In Deutschland sind die Einzelhandelsumsätze im zweiten Quartal dieses Jahres inflationsbereinigt so gering gewesen wie seit zehn Jahren nicht mehr.
ZEIT: Wenn Finanzminister Eichel die Staatskasse öffnet, bekommt er doch gleich doppelt Probleme: mit der Opposition in Berlin, die ihn als Schuldenmacher brandmarkt. Und mit Brüssel, weil er dann gegen den Stabilitätspakt verstößt.
O’Neill: In dieser Kritik steckt ein entscheidender Denkfehler. Man kann nicht gleichzeitig die Staatshaushalte konsolidieren und dem Volk schmerzhafte Strukturreformen zumuten, selbst wenn diese sinnvoll sind.
ZEIT: Was schlagen Sie vor?
O’Neill: Die Bundesregierung sollte an alle Haushalte Schecks verteilen, die sofort eingelöst werden können. In Amerika hat die Fiskalpolitik so das Wachstum unterstützt, als es notwendig war. Der Effekt auf den Konsum und damit auf das Wachstum ist deutlich größer, als wenn man zum Beispiel die Unternehmensteuern senkt. Dafür müssten die deutschen Ökonomen nur ein bisschen mehr Einfallsreichtum entwickeln.
ZEIT: Machen Sie es sich da nicht ein wenig zu einfach? Was ist, wenn die Bürger das frische Geld nicht ausgeben, sondern sparen? Immerhin ist Deutschland bekannt für seine hohe Sparquote. Der Wachstumseffekt würde verpuffen.
O’Neill: Sie sprechen vom so genannten Angstsparen, ich kenne diese Argumentation. Das ist doch wieder nur eine dieser deutschen Ausreden, um sich nicht der schleppenden Binnennachfrage widmen zu müssen. Die Daten zeigen, dass die Sparquote in den vergangenen Jahren nicht signifikant gestiegen ist. Es gibt kein Angstsparen. Es gibt nur eine dramatische Schwäche bei der Einkommensentwicklung.
ZEIT: In der Vergangenheit wurde Deutschlands Wirtschaft nach einer Rezession immer zuerst durch die Exporte stimuliert, dann kamen die Unternehmensinvestitionen, und am Ende sprang der Konsum an. Wieso sich nicht wieder auf dieses Muster verlassen, anstatt Schecks zu verteilen, die die Staatsschulden erhöhen?
O’Neill: Wie lange wollen Sie noch warten? Deutschland ist Exportweltmeister, das lässt sich nicht mehr steigern. Wohin wollen Sie die ganzen Waren denn liefern? In die Antarktis? Ein Land kann auf Dauer nicht nur für den Export produzieren, das ist unklug, weil man die ausländische Nachfrage nach Gütern nicht kontrollieren kann. Außerdem: Deutschlands Unternehmen sind extrem wettbewerbsfähig, das beweisen gerade die hohen Exportzahlen, und trotzdem investieren sie wenig und schaffen kaum neue Jobs. Warum? Weil ihnen der heimische Markt weggebrochen ist. Also muss man ihn ankurbeln – ganz direkt.
ZEIT: Moment mal. Sie sind doch Brite, sie arbeiten bei einer amerikanischen Investmentbank – und sie argumentieren gerade wie ein Ökonom, den man in Deutschland als »Keynesianer« deklassieren würde. Wie passt das zusammen?
O’Neill: Ich bin weder strikter Anhänger der Nachfragetheorie noch der Angebotstheorie. Ich bin Pragmatiker.
ZEIT: Wer in Deutschland für mehr Nachfrageorientierung in der Wirtschaftspolitik plädiert, bekommt zur Antwort: Keynes ist tot.
O’Neill: Adam Smith ist auch tot. Und wenn die deutschen Ökonomen weiterhin so kategorisch denken, wird auch die deutsche Wirtschaft demnächst tot sein.
ZEIT: Was ist der wichtigste Unterschied zwischen deutschen und internationalen Ökonomen?
O’Neill: Viele deutsche Volkswirte erscheinen dogmengläubig und nehmen manchmal Regeln allzu wörtlich. Angelsächsisch geprägte Ökonomen und Wirtschaftspolitiker dagegen sind oft pragmatischer im Denken, was in unsicheren Zeiten ein Vorteil sein kann. Die Diskussion in Deutschland wird oft in den Kategorien Gut und Böse geführt.
ZEIT: Zum Beispiel?
O’Neill: Inflation ist immer schlecht, genauso wie mehr Staatsaktivität oder Staatsschulden. Deshalb erscheinen Regeln so verlockend. Wenn es dann mal eine Regel gibt, muss sie eingehalten werden, weil sonst das vermeintliche Chaos droht. Doch in der Volkswirtschaft, die ja keine exakte Wissenschaft ist, sondern eine Sozialwissenschaft, ist nie irgendetwas glasklar. Die in Deutschland geführte Diskussion spiegelt eine Eindeutigkeit vor, die es so nicht geben kann. Das eine Problem lässt sich eher mit Strukturreformen lösen, das andere eher mittels höherer Staatsausgaben. Ich amüsiere mich immer wieder über diese dogmatische Denke. Kurz vor der letzten Bundestagswahl saß ich mit zehn deutschen Journalisten beim Dinner und habe nicht verstehen können, dass alle mit Finanzminister Eichel einer Meinung waren, dass wegen der Oderflut und ihren Kosten die nächste Stufe der Steuerreform ausgesetzt werden müsse. Einzige Begründung: die Dreiprozentregel des Stabilitätspaktes. Ich dachte damals, dass eine solche Makropolitik äußerst unpopulär sein müsste.
ZEIT: Offensichtlich hält auch die Mehrheit der Deutschen höhere Staatsschulden für Teufelszeug.
O’Neill: Ich bin ja gewiss nicht grundsätzlich gegen eine Haushaltskonsolidierung. Aber man muss doch das gesamtwirtschaftliche Umfeld betrachten. Was würde denn geschehen, wenn die USA ihr Staatsdefizit von heute auf morgen zurückfahren würden? Die Welt würde in die Rezession stürzen. Das Wachstum in Euroland war bisher stark auf die amerikanische Nachfrage angewiesen, und besonders Deutschland ist konjunkturell noch immer von ausländischer Nachfrage abhängig.
ZEIT: Sie halten nichts vom Stabilitätspakt?
O’Neill: Die strikte Defizitgrenze von drei Prozent des BIP ist lächerlich. Für den zweitwichtigsten Wirtschaftsblock der Welt ist es verrückt, sich selbst solche Fesseln anzulegen. Euroland muss flexibel auf unvorhersehbare Ereignisse reagieren können.
ZEIT: Aber Sie haben doch gerade gesagt, dass Sie nicht grundsätzlich gegen die Reduzierung der Haushaltsdefizite sind.
O’Neill: Sicher braucht man in einer Währungsunion ein Konzept, um die Staatsschulden einzelner Länder im Zaum zu halten. Aber so was kann man nicht an numerischen Zielen festmachen. Wenn man überhaupt das Budgetdefizit und nicht die Staatsschuld heranzieht, dann bitte über mehrere Jahre, über einen Konjunkturzyklus hindurch. Aber in Euroland wird das jährliche Budgetdefizit als Messlatte verwendet. Das muss zu einer trendverstärkenden und damit schädlichen Fiskalpolitik führen.
ZEIT: Die meisten deutschen Volkswirte sagen, dass bei einem dauerhaften Bruch der Dreiprozentregel die Glaubwürdigkeit der Währungsunion auf dem Spiel stehe und der Euro weich würde.
O’Neill: Eine Euroschwäche wird sicher nicht das Problem sein. Wenn überhaupt wird es ein Problem, den Anstieg des Euro auf unter 1,50 Dollar zu begrenzen. Einen schwachen Euro erkenne ich auf absehbare Zeit nicht, Stabilitätspakt hin oder her.
ZEIT: Und die Glaubwürdigkeit?
O’Neill: Gegenüber wem? Irgendwelchen mythischen Gralshütern der vermeintlich reinen Lehre? Ich verstehe das nicht. Ich lese ja ab und an diese Kommentare meiner deutschen Kollegen. Doch wo ist der empirische Beweis, dass eine expansive Fiskalpolitik bei frei schwankenden Währungen schlecht ist? Es gibt ihn nicht. Schlecht wäre ein Stimulus, der den Schuldenstand einzelner Länder auf unhaltbare Niveaus treibt. Davon ist Euroland weit entfernt.
ZEIT: Schadet die deutsche Wachstumsschwäche dem Wirtschaftsraum Europa?
O’Neill: Wenn wir auf die Welt seit dem 11. September 2001 schauen, dann geht das schlechtere Abschneiden Eurolands im Vergleich zu Amerika vor allem auf die restriktivere Fiskalpolitik der Europäer zurück. Und da spielt Deutschland schon qua seiner ökonomischen Größe eine besondere Rolle. Wenn man sich die hohen sozialen und ökonomischen Kosten der Wiedervereinigung vor Augen führt und die Tatsache, dass der Westen jedes Jahr vier Prozent des Bruttosozialproduktes nach Osten transferiert, dann muss man das beim Stabilitätspakt berücksichtigen.
Das Gespräch führten Marc Brost und Robert von Heusinger
Anlage 3: Folien von Albrecht Müller