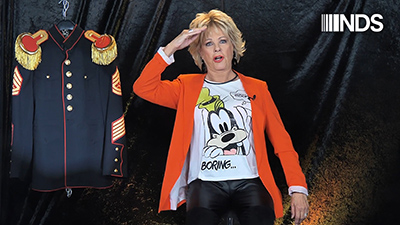Rhetorik der Sozialverträglichkeit – zum Studiengebühren-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat in letzter Instanz die Klage der Studierendenschaft der Universität Paderborn abgewiesen, mit der diese in einem Musterprozess die Rückzahlung eines Semesterbeitrages in Höhe von 500 € durchsetzen wollte. Die politische Allerweltsformel von der „sozialen Verträglichkeit“ musste als „juristische“ Begründung für das Urteil herhalten. Die obersten Verwaltungsrichter haben sich nicht etwa mit der der in Artikel 5 GG verankerten Wissenschaftsfreiheit, die ja die Studierfreiheit mit erfasst, oder mit dem Recht auf freie Berufswahl nach Artikel 12 GG oder dem Sozialstaatsprinzip nach Artikel 20 GG auseinandergesetzt, sondern sie haben sich kritiklos die Argumente des nordrhein-westfälischen „Innovationsministeriums“ zu eigen gemacht. Das Urteil ist ein politisches und kein juristisches.
Aber nicht einmal die politische Rhetorik von der „Sozialverträglichkeit“ wurde hinterfragt. Wolfgang Lieb
Die landesrechtlichen Grundlagen der Studienbeitragserhebung „verletzen nicht das aus Art. 12 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG und dem Sozialstaatsprinzip ableitbare Recht auf chancengleiche Teilhabe an den staatlichen Ausbildungsressourcen. Der nordrhein-westfälische Gesetzgeber war sich der Problematik bewusst, dass allgemeinen Studienabgaben grundsätzlich eine abschreckende bzw. verdrängende Wirkung im Hinblick auf Studienberechtigte aus einkommensschwachen Bevölkerungsschichten und bildungsfernen Elternhäusern zukommen kann. Zur Vermeidung dieses Effekts hat er insbesondere den Anspruch auf Gewährung eines Studienbeitragsdarlehens vorgesehen. Zwar können sich nicht nur wegen der Rückzahlung der Darlehenssumme, sondern vor allem auch wegen der für das Darlehen zu zahlenden Zinsen beachtliche Belastungen für die betroffenen Studierenden ergeben. Das Recht auf chancengleiche Teilhabe an den staatlichen Ausbildungsressourcen fordert jedoch nicht, dass Erschwernisse, die mit der Erhebung von Studienabgaben verbunden sind, durch soziale Begleitmaßnahmen vollständig kompensiert werden. Diese Maßnahmen müssen nur hinreichend sicher verhindern, dass die Abgabenerhebung zu unüberwindlichen sozialen Barrieren für die Aufnahme oder die Weiterführung eines Studiums bzw. zu einer sozialen Unverträglichkeit führt. Diesen Anforderungen werden die durch den nordrhein-westfälischen Landesgesetzgeber vorgesehenen Studienbeitragsdarlehen auch im Hinblick auf die Zinsregelung – noch – gerecht.“ So heißt es in der Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts zum Urteil vom 29. April 2009 BVerwG 6 C 16.08.
Die Entgelterhebung durch die Studiengebühr müsse nämlich nur „sozialverträglich ausgestaltet“ sein, heißt es in der Begründung.
Die Frage ist allerdings: Kann es überhaupt sozialverträgliche Studiengebühren geben?
„Sozialverträgliche“ Gebühren sind eine beschönigende Umschreibung einer sozial belastenden staatlichen Maßnahme. Notwendig wären aber eher „sozial förderliche“ Maßnahmen, um mehr Chancengleichheit bei der Aufnahme eines Studiums und damit ein höheres allgemeines Qualifikationsniveau zu erreichen.
„Sozialverträglichkeit“ wird eindimensional verengt auf die Frage, was finanziell noch zumutbar ist, um keinen Abschreckungseffekt bei der Entscheidung für die Aufnahme eines Studiums zu bewirken.
Der Begriff „sozialverträglich“ – in seiner ursprünglichen Bedeutung, wie er vor Jahren in die sozialwissenschaftliche Debatte eingeführt worden ist, nämlich in Form einer Sozialverträglichkeitsprüfung – würde eine viel breitere, differenziertere Diskussion und einen komplexeren Abwägungsprozess verlangen. Nämlich wie die Einführung einer „Sozialtechnik“ – und Studiengebühren sind eine Sozialtechnik – negativ oder positiv auf definierte, allgemein anerkannte Oberziele wirkt.
Der Begriff „soziale Verträglichkeit“ kam auf, als sich in den 70er Jahren im Ruhrgebiet infolge der Schließung von Zechen und Stahlwerken Massenentlassungen ereigneten. Damals wurde nach Lösungen gesucht, wie der Strukturwandel „sozial verträglich“ gestaltet werden könnte. Es ging vor allem darum, wie verhindert werden kann, dass die Kumpel im Pütt und an den Stahlöfen ins „Bergfreie“ fallen.
Der Begriff „Sozialverträglichkeit“ hat zwischenzeitlich auf vielen gesellschaftspolitischen Konfliktfeldern Eingang gefunden. Heute gehört dieser Begriff zur Alltagssprache der Politiker – meistens in politischen Zusammenhängen, bei denen es um belastende Maßnahmen oder um soziale und finanzielle Einschnitte für größere Bevölkerungsgruppen geht.
Der Rechtswissenschaftler und Soziologe Wolfgang van den Daele (Sozialverträglichkeit und Umweltverträglichkeit, Politische Vierteljahreschrift Nr. 34, S.219ff., 1993) sprach daher (schon 1993) warnend davon, dass es bei der Benutzung der Wortverbindung „soziale Verträglichkeit“ zunehmend eher um „Verträglichkeitsrhetorik“ als um eine aussagekräftige Begriffsbildung gehe.
Die Forderung nach „sozialer Verträglichkeit“ wurde auch regelmäßig im Zusammenhang mit der Debatte um die Einführung der Studiengebühren erhoben. Kaum einer der Befürworter von Studiengebühren vergisst darauf hinzuweisen, dass die Gebühr selbstverständlich „sozial verträglich“ sein müsse. Fragt man genauer nach, was darunter zu verstehen ist, so findet man eine Vielzahl von beliebigen Argumenten und Vorschlägen, die – wie auch immer – begründen sollen, dass die Einführung von Studiengebühren keine sozial selektiven Abschreckungswirkungen auf individuelle Entscheidungen für die Aufnahme eines Studiums haben dürfe.
Vergleicht man aber die Einführung von Gebühren mit den Angeboten, wie eine „soziale Verträglichkeit“ – etwa durch die Einführung eines Stipendiensystems – praktisch gewährleistet werden könnte, so wird offenkundig, dass es sich dabei meist um „Verträglichkeitsrhetorik“ handelt.
Ähnlich wie beim „Unwort des Jahres 1998“ – nämlich dem „sozialverträglichen Frühableben“ – handelt es sich beim Gebrauch der Wortverbindung „sozialverträgliche Studiengebühr“ meist um eine beschönigende, man könnte sogar sagen: manipulative Umschreibung einer politisch unangenehmen und konfliktträchtigen Entscheidung.
Grundsätzlich lässt sich nämlich feststellen, dass mit dem Euphemismus „soziale Verträglichkeit“ die faktisch vorhandene soziale Benachteiligung bei der Wahrnehmung der Chancen auf eine Hochschulausbildung keinesfalls überwunden werden soll oder kann. Es geht in aller Regel bestenfalls darum, dass die Benachteiligung nicht noch größer wird, oder um die Frage, was als noch „zumutbar“ angesehen werden kann, damit nicht ein noch größerer Abschreckungseffekt eintritt.
Die Studiengebühr ist eine Art „Kopfpauschale“, eine Abgabe, die alle gleich trifft, unabhängig von den jeweiligen Einkommens- oder Vermögensverhältnissen; ein sozialer Ausgleich wie bei der Steuer etwa über die Progression der Belastung nach der Einkommenshöhe findet im „Gebührenstaat“ nicht statt. Jeder bezahlt dasselbe für das Angebot einer Leistung – sofern er sich dieses leisten kann.
Soziale Gesichtspunkte bleiben somit gerade außen vor, schon allein deshalb ist die Einführung von gleich hohen „Studienbeiträgen“ für alle unsozial.
Der Nettomonatsverdienst eines Arbeiterehepaares mit Kindern lag 2006 im Westen bei 2.271,51 Euro und im Osten bei 1.888,77 Euro (Statistisches Bundesamt zitiert nach Spiegel, das sind die aktuellsten verfügbaren Daten). Selbst wenn man einen BaföG-Höchstsatz von 643 Euro für das studierende Kind unterstellt, sind 1.000 Euro zusätzliche Ausbildungskosten pro Jahr für die betreffende Familie ein hoher Anteil am Einkommen.
Wer für Chancengleichheit oder soziale Chancengerechtigkeit eintritt, dürfte nicht über „soziale Verträglichkeit“ fabulieren, sondern er müsste vielmehr über „sozial förderliche“ Maßnahmen nachdenken, mit denen der Anteil von jungen Menschen aus sozial schwächeren und bildungsferneren Bevölkerungsgruppen an den Hochschulen auf ein sozial verträglicheres Maß angehoben werden könnte.
Nach meiner Meinung ist die derzeitige Verteilung von Bildungschancen, bei der fast 90 von Hundert aller Studierenden aus Elternhäusern mit mittlerem und höherem Einkommen kommen, schon heute weder volkswirtschaftlich vertretbar noch sozial verträglich, sondern ein „sozial unerträglicher“ bildungspolitischer Skandal.
Eine bildungspolitische Maßnahme, die nicht dazu beiträgt, diesen skandalösen Zustand zu überwinden, sondern ihn bestenfalls nicht verschlimmert, kann deshalb m.E. von vorneherein nicht mit dem Begriff der „sozialen Verträglichkeit“ verknüpft werden. Denn dass die Studiengebühr ein größeres Maß an sozialer Gerechtigkeit bei der Hochschulbildung brächte, das wagt auch das Bundesverwaltungsgericht nicht zu behaupten: „Der nordrhein-westfälische Gesetzgeber war sich der Problematik bewusst, dass allgemeinen Studienabgaben grundsätzlich eine abschreckende bzw. verdrängende Wirkung im Hinblick auf Studienberechtigte aus einkommensschwachen Bevölkerungsschichten und bildungsfernen Elternhäusern zukommen kann.“
Solange die existierende soziale Benachteiligung nicht durch „soziale Förderung“ wenigstens gelindert wird, kann es überhaupt keine „sozialverträglichen“ Studiengebühren geben.
Wer behauptet, dass eine Darlehensschuld keine Bildungsbarriere darstellt, offenbart ein typisches „Oberschichtendenken“.
Wer meint, dass die sog. „nachgelagerte Gebühr“ – also die Rückzahlung eines Kredites nach dem Studium – die Geldbarriere wegnähme, sollte sich daran erinnern, dass in der Regierungszeit Kohl das Bafög auf Darlehen umgestellt wurde; das führte von 1982 –2000 zu einem Rückgang des Anteils der Studierenden aus „bildungsfernen Schichten“ von 23 auf 13%.
Gegen die „nachgelagerte Gebühr“ gelten prinzipiell dieselben Einwände wie gegen die „vorgelagerte“ Gebühr.
Der Unterschied besteht nur darin, dass die Benachteiligung der Studierenden aus niedrigen Einkommensschichten oder aus Familien mit Kindern als Start- und Einkommensnachteil in die Berufsphase fortgeschrieben wird. Wer reiche Eltern hat, startet ohne Hypothek und erspart sich sogar noch die Zinsen.
Angesichts der auch für Akademiker keineswegs mehr risikofreien Arbeitsmarkterwartungen tun sich natürlich die jungen Erwachsenen, deren Studium von den Eltern finanziert werden kann, bei einer Entscheidung für ein Studium erheblich leichter als solche, für die sich eine Risikoabwägung bei der Aufnahme einer Bildungshypothek erst gar nicht stellt.
Wer solche Argumente nennt, dem wird oft vorgehalten, dass man die soziale Fürsorglichkeit zu weit treibe und dass derjenige, der studieren möchte, eben auch ein gewisses Opfer dafür bringen müsse. So auch das Bundesverwaltungsgericht: „Das Recht auf chancengleiche Teilhabe an den staatlichen Ausbildungsressourcen fordert jedoch nicht, dass Erschwernisse, die mit der Erhebung von Studienabgaben verbunden sind, durch soziale Begleitmaßnahmen vollständig kompensiert werden.“
Auch dieser Satz offenbart ein typisches Oberschicht-Denken.
Es ist nachweislich so, dass aufgrund der geringeren verfügbaren Einkommen für statusniedrigere Familien die erwarteten Kosten schwerer wiegen als für statushöhere, meist besser verdienende. Sowohl die Eltern als auch die Kinder, vor allem, wenn sie in der ersten Generation an eine Hochschule gehen, schätzen die Erfolgsaussichten geringer ein, als das in Akademikerfamilien üblich ist, so dass eine kosten- und zeitintensive Bildungsinvestition riskanter erscheint.
Es ist also kein Wunder, dass bei statushöheren Familien „der Apfel nicht weit vom Stamm fällt“. Für solche Familien besteht nicht nur ein künftiges Aufstiegsrisiko, sondern es droht bei einer Entscheidung gegen ein Studium ein aktueller Statusverlust.
Die Sozialstatistik für die Bildungsbeteiligung spiegelt diese soziale Realität überdeutlich wider. Wer da behauptet, eine „nachgelagerte Gebühr“ sei „sozial verträglich“, tritt in Wahrheit für eine soziale Realität ein, in der Bildungschancen eklatant ungerecht und sogar so ungleich verteilt sind wie in kaum einem anderen vergleichbaren Land.
Bildungskredite benachteiligen darüber hinaus in besonderer Weise Frauen. Die Rückzahlungsverpflichtungen vor dem Hintergrund nach wie vor schlechterer Einkommenserwartungen von Frauen oder deren (biologisch und kulturell bestimmter) Unterbrechung der Erwerbstätigkeit in der „Kindererziehungsphase“ haben für weibliche Studierwillige einen noch höheren Abschreckungseffekt.
Die „nachgelagerte Gebühr“ ist also nicht nur eine nach hinten verschobene, aber dafür um so höhere soziale Barriere für ein Studium, sie ist darüber hinaus ein schwerer Rückschlag für die Aufholjagd junger Frauen bei der Bildungsbeteiligung.
Siehe dazu schon: Kann es überhaupt sozialverträgliche Studiengebühren geben?