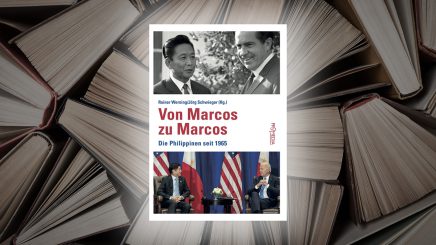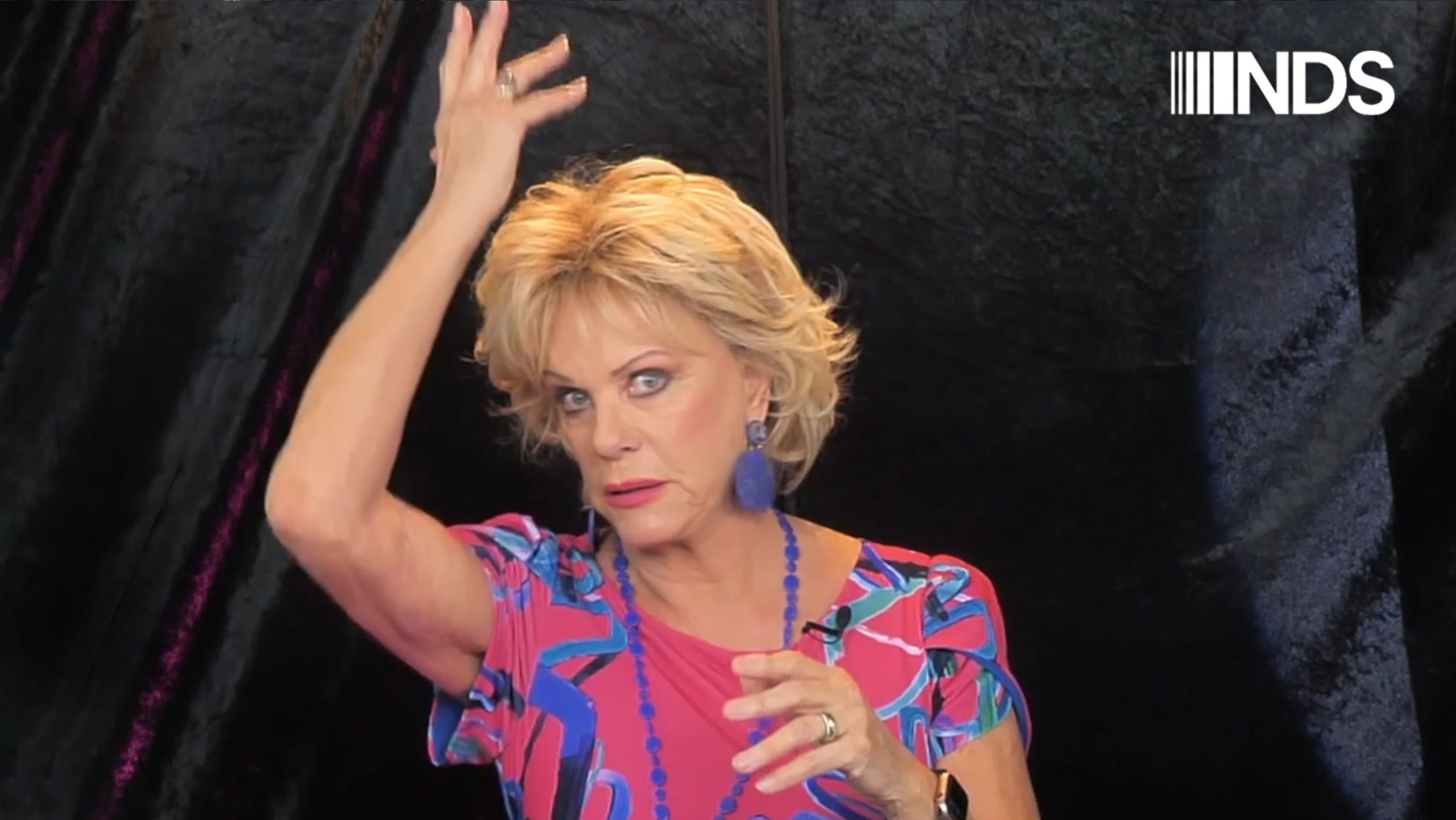Köln – „Korruption, Misswirtschaft, Demonstration“, schreien die politischen Nachrichten, „Semana Santa auf Marinduque; Südseeromantik auf Boracay“, locken die Reiseveranstalter Touristen auf die Philippinen. Wenn sich vor diesem ambivalenten Hintergrund dann ein Theologe und ein Sozialwissenschaftler als Herausgeber publizistisch am Thema Philippinen abarbeiten, braucht es 2019 bereits in der sechsten Auflage 496 Seiten für ein „Handbuch – Philippinen“, um den Schatz an Materialien, Dokumenten und Daten über das Land aufzuarbeiten und Ordnung in die Erzählung über den Archipel im Fernen Osten zu gewinnen. Eine Rezension von Albert Klütsch.
Wenn dann Rodrigo Duterte (2016 – 2022) als Mordbube, der sich in seiner Ordnungsliebe mit 30.000 Opfern schmückt, mit einer Anklage und Verhaftung 2025 vor dem Internationalen Strafgerichtshof endet, dann aber Ferdinand Marcos Jr. als Präsident und im Gefolge die Tochter Sara Duterte als Vizepräsidentin in der Tradition des Familienerbes als „Einheit“ die Lenkung des Staates übernahmen, geben die Ereignisse den Herausgebern Anlass, das Wissen um Geschichte und Gegenwart in der Zeit von 1965 bis 2025, Land und Leuten in Informationen, Analysen, Statistiken und persönlichen Berichten weiter zu verdichten – eine wortgewandte und datenstarke Enzyklopädie des Wissens mit fragilen Gewissheiten.
32 Autorinnen und Autoren leihen der spannungsreichen Zeit zwischen 1965 und 2025 – von Marcos Sr. bis Marcos Jr. – Namen und Profil, mit dem sie ihre Sicht auf aktuelle gesellschaftspolitische Sachfragen – mit Quellenangaben zu vertiefender Lektüre – beschreiben: zu Gesellschaft und Politik, Klima und Umwelt, Arbeitswelt und -migration, Landwirtschaft und Landreform, Globalisierung und Privatisierung. Interviews mit acht Zeitzeugen umrahmen in persönlichen Zeugnissen die Lebenswelten der Filipinos und Filipinas.
Zusammengestellt von ausgewiesenen Sachkennern – Jörg Schwieger, Jahrgang 1953, evangelischer Theologe und Germanist, von 1982 bis 1986 Geschäftsführer der Aktionsgruppe Philippinen, von 1987 bis 1991 Geschäftsführer des Philippinenbüro e.V. und Mitarbeiter im kirchlichen Entwicklungsdienst, seit 2020 Vorsitzender der Stiftung Asienhaus in Köln; Rainer Werning, Jahrgang 1949, ehemals Lehrbeauftragter an den Universitäten Bonn und Osnabrück, Politik- und Sozialwissenschaftler mit breiter publizistischer Tätigkeit im Schwerpunkt Südost- und Ostasien, zuletzt auf den NachDenkSeiten in Beiträgen zum Militärputsch vor 60 Jahren in Indonesien.
Wer den Archipel in Fernost als Sehnsuchts- und Vergnügungsort abgespeichert hat, wird bereits in der Widmung eines Besseren belehrt: Das Buch ist all jenen Menschen gewidmet, die ihr beharrliches Engagement für Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie im Kampf gegen staatliche Repression und Diktatur mit dem Leben bezahlten. Leben und Überleben zählt zu den Lebenskünsten der Bewohner, ob unter dem Eindruck der jährlich bis zu 20 Taifune, der Erdbeben und Vulkanausbrüche entlang des pazifischen Feuerrings oder dem Erlebnis eines „konstitutionellen Autoritarismus“, den Ferdinand Marcos 1972 mit der Anordnung des Kriegsrechts ausbaute, um seine unbeschränkte diktatorische Herrschaft mit dem Mord an seinem politischen Widersacher Benigno Aquino im August 1983 zu krönen, ehe ihn die USA als „guten Verbündeten“ ihrer pazifischen Imperialinteressen 1986 ins Asyl nach Hawaii holten und vor dem politischen Aufstand – „Rosenkranzrevolution“ – bewahrten, der in Manila tobte.
Mit der „people power“ an die Macht gespült, war Corazon Aquino (1986 – 1992) als unerfahrene Präsidentin dem Diktat ihres Generals und Verteidigungsministers Fidel Ramos unterworfen, der sie in der Abfolge der Familiendynastien alsdann selbst als Präsident (1992 – 1998) beerbte.
Die Machtansprüche der feudalistischen Familiendynastien variieren, während das Volk über die Jahre vertröstet und aus dem Leid staatlicher Repression nicht entlassen wird. Insoweit nehmen uns die Autorinnen und Autoren mit auf eine dicht gezeichnete Reise durch die verschiedenen Lebenswelten: Mindanao, die Insel des muslimischen Widerstands der „Moros“, die mit ihrer Guerillataktik gewaltvoll Autonomie und Selbstbestimmung verlangen, während gleichzeitig die indigenen Seenomaden ihre traditionellen Riten zu bewahren suchen. Eine bäuerliche Bewegung, die sich Armut, Ausbeutung und Ungerechtigkeit bei ihrer Landpacht ausgesetzt sieht.
Und die Eliten Manilas sind sich einig, alles, was auch nur einen geringen Mangel an nationaler Gesinnung erkennen lässt, als „Terrorismus“ zu brandmarken und zu „neutralisieren“ – anschaulich illustriert durch Belege von „Reportern ohne Grenzen“ über den Tod von 147 Journalistinnen und Journalisten sowie durch Berichte von Ärzten und Überlebenden eines Attentats.
Die Autoren belassen es nicht bei der Schilderung allgegenwärtiger staatlicher Repression, sondern verweisen auf die vielfältigen Ursachen der gesellschaftlichen Aggression: eine Gesellschaft in einem Bildungssystem traditioneller Lehrmethoden, die sich auf das passive Zuhören beschränken; eine Wirtschaft, die sich kapitalistischer Ausbeutung bedient, um im Interesse globaler Investoren die Illusion von Wachstum und Wohlstand zu nähren; eine Arbeitswelt, die Familien zerreißt, weil sie den Unterhalt nur gewährleistet, wenn die einen sich der Pflege der westlichen Welt andienen, die anderen als billige Arbeitskräfte in der weltweiten Seefahrt anheuern. Beiträge geben Raum auch für jene zur Unkenntlichkeit verkommenen Friedensverhandlungen mit den Guerillaorganisationen MILF (Moro Islamic Liberation Front) und MNLF (Moro National Liberation Front), die nach Gusto der Präsidentschaft für obsolet erklärt werden und erneut zu militärischen Auseinandersetzungen führen, die den US-Investoren die Gewissheit zu vermitteln trachten, ihren Investitionen eine sichere Zukunft zu gewährleisten.
In spanischer Tradition steht dabei das „Caudillo-Prinzip“, das die Versuche einer demokratischen Staatsgestaltung den Bedingungen von Dynastien unterwirft, wie es Franco in Spanien vorgelebt hat und Chávez, Maduro und Ortega in Südamerika nachahmen. Ein System, das sich in das Netz imperialer US-Interessen einer „eisernen Allianz“ (US-Kriegsminister Hegseth 2025) im „Balikatan“ (Schulterschluss) einbettet und über Militärabkommen die „Vorwärtsverteidigung“ gegen China im ewig erfolglosen Kampf der „Domino-Theorie“ der US-Administration sichert.
Unter diesen geopolitischen Vorgaben geben die Autoren den Philippinen nur geringe Chancen, sich im Weltgeschehen autonom zu postieren. Die spanische Kolonisation bis 1898 und die nachfolgende amerikanische Besatzung bis zur Unabhängigkeit 1946 haben die Bedingungen für jenes System geschaffen, in dem die Staatsmacht von Dynastie zu Dynastie über die Köpfe der Menschen hinweg nahezu unbeanstandet weitergereicht wird. Herausgeber und Autoren wahren in dem zeitgeschichtlichen Abriss wortstark das Verdienst, den Menschen in diesem aufgewühlten Land Stimme und Gewicht zu geben. Wer in dem Informationswirrwarr der Zeitenwende inhaltlich Halt sucht, wird in dem Buch glänzend bedient.
Rainer Werning / Jörg Schwieger (Hrsg.): Von Marcos zu Marcos – Die Philippinen seit 1965. Wien 2025, Promedia Druck- und Verlagsgesellschaft mbH, Taschenbuch, 264 Seiten, ISBN 978-3853715505, 24 Euro.