„Kopflose Politik und führungslose Märkte“ – Ein Beitrag von Flassbeck und Spiecker für die NachDenkSeiten
Ein lesenswerter Beitrag für die eigene Orientierung, der auch im Blick darauf, was wir heute noch vom Bundesfinanzminister und anderen zu hören bekommen werden wichtig ist. Die beiden Autoren halten nichts vom Schuldenschnitt und sie machen deutlich, dass die führenden Personen ohne Verantwortung handeln und reden. Oft ohne Sachkenntnis und dafür umso mehr belastet von Glaubenssätzen. Es ist zum Mäusemelken. Albrecht Müller.
Kopflose Politik und führungslose Märkte
von Heiner Flassbeck und Friederike Spiecker
NDS, Juli 2011
Wenn man etwas aus der Eurokrise lernen kann, dann ist es die Tatsache, dass unsere Politiker und ihre Berater mit der Finanzkrise 2008 und ihren Folgen hoffnungslos überfordert waren und sind. Dass sie jetzt wieder die Ratingagenturen an den Pranger stellen, obwohl sie selbst jeden Tag auf die Einschätzung der „Märkte“ schielen, ist der beste Beweis dafür. Und es zeigt, dass die Politik mitsamt der gewaltigen Mehrzahl der Medien die Funktionsweise von Finanzmärkten in keiner Weise verstanden hat.
Wenn ich credit default swaps (CDS), also Ausfallversicherungspapiere, etwa für griechische oder portugiesische Staatsanleihen hielte, würde ich mir an jedem Tag, an dem wieder ein deutscher Politiker oder ein sogenannter Experte eine neue Schuldenschnittsau durchs Dorf treibt, vor Freude auf die Schenkel klopfen. Mit jedem Tag weiterer Diskussionen um die „Pleite“ oder den haircut als unausweichlicher Konsequenz der Krise steigt der Wert meiner Papiere oder zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie problemlos zu einem hohen Preis weiterverkaufen kann. Gute Geschäfte winken auch dem, der rein spekulativ in den letzten zwei Jahren, also nach Ausbruch der Krise, griechische Staatsanleihen zu extrem niedrigen Kursen und damit mit Zinsversprechungen von 15 Prozent und mehr gekauft hat, wenn es ihm (oder ein paar Freunden) gelingt, noch mehr Panik in Euroland zu verbreiten, also Spanien und Italien ins Zentrum zu rücken. Die Wahrscheinlichkeit, dass die starken Länder am Ende die Kleinen retten müssen, steigt nämlich enorm, wenn ein paar große mit ins „Visier“ der Märkte geraten.
Stutzig sollte es unsere Ratingagenturkritiker jedoch machen, dass das alles auch ohne Ratingagenturen wunderbar funktioniert. Die Finanzmärkte tun nämlich im Grunde nichts anderes als die Agenturen: Auf ihnen werden Informationen gehandelt – und ganz häufig falsche oder irreführende Informationen. Es ist Marktteilnehmern, insbesondere den großen, etwa den Banken und Fonds, die mit besonderer Informationsmacht ausgestattet sind, weil sie ihre geldmächtigen Kunden „überzeugen“ und für ihre Marktaktivitäten instrumentalisieren können, vollkommen gleichgültig, ob eine Information richtig oder fasch ist. Es kommt ja nur darauf an, möglichst vielen mit möglichst viel Geld Ausgestatteten zu vermitteln, dass „der Markt“ in den nächsten Tagen und Wochen in eine bestimmte Richtung gehen wird. Denn der Markt tut dann genau das, weil die Herde der Anleger das erwartete. So funktionieren selbsterfüllende Prognosen. Ob man seine „Kunden“ in Rohstoffderivate lockt, auf den Kurs des brasilianischen Real wetten lässt oder mal wieder auf Goldkurs bringt, macht keinen Unterschied. Der Weg, der Anstieg des Kurses, ist das Ziel. Dass der Berater dann in der Regel vor seinem Kunden aus dem „Investment“ wieder aussteigt, weil er ja weiß, was von seinen „Informationen“ zu halten ist, gibt der Sache für die Investmentbanker und die sonstigen Croupiers einen besonderen Reiz.
Dass dabei über Monate und Jahre falsche Preise mit enormen negativen Konsequenzen für die übrigen realwirtschaftlichen Märkte erzeugt werden, interessiert in Deutschland niemanden, weil es an Ordnungspolitikern fehlt, die das verstehen und entsprechend beklagen könnten oder gar auf eine institutionelle Unterbindung des Herden-Auf-und-Abs auf den Finanzmärkten hinwirken würden. Fast jeder Politiker fürchtet, als sozialistischer Anti-Marktwirtschaftler abgestempelt zu werden, wenn er für klare institutionelle Grenzen der Finanzwirtschaft eintritt, weil er nicht dazu in der Lage ist, den Unterschied zwischen „normalen“ Märkten, auf denen das Beheben von Knappheiten belohnt wird, und solchen, auf denen das Gegenteil, nämlich das Schaffen von Knappheiten durch das Initiieren von Herdenverhalten belohnt wird, zu erklären. Kein Wunder, dass die Politik auf die Finanzmärkte oder auf die Ratingagenturen starrt wie das Kaninchen auf die Schlange, um von dort Hinweise zu bekommen, was aktuell falsch und was richtig ist. Und verständlich, dass die Politiker sauer reagieren, wenn ihnen immer wieder Erfolglosigkeit attestiert wird.
Wer glaubt, die Märkte überzeugen zu müssen statt sie zu führen, liegt eben von vornherein falsch. Da die Märkte versuchen, die Politik zu „lesen“, und die Politik zugleich versucht, die Signale der Märkte zu deuten, kann das Ergebnis nur Chaos sein. Die Politik muss ohne Wenn und Aber die Führungsrolle übernehmen, selbst wenn allein der Gedanke daran den Marktgläubigen in der Koalition die Tränen in die Augen treibt. Um Missverständnissen vorzubeugen: Das heißt gerade nicht, die Funktionsweise von Märkten zu ignorieren und z.B. blind Geld irgendwo hinzupumpen, auch wenn es sich um ein Fass ohne Boden handelt. Nein, Märkte zu führen setzt voraus, sie genau zu verstehen und ihnen dort, wo sie gesamtwirtschaftlichen Schaden anrichten, den Boden zu entziehen und zu untersuchen, warum Fässer wie Griechenland ihren Boden verloren haben. Das ist die einzige Rechtfertigung des Vorrangs der Politik vor der Wirtschaft: Nur wenn die Politik eine angemessene Funktionsweise der Gesamtwirtschaft als ihre Aufgabe anerkennt und wahrnimmt, kann sie mit Akzeptanz der Marktergebnisse bei der Bevölkerung rechnen. Politiker, die sich von der Geldmacht der Finanzmarktakteure vor sich hertreiben lassen, brauchen sich nicht zu wundern, dass sie die demokratische Legitimation ihrer Führungsposition auf’s Spiel setzen. Denn die Wähler spüren, dass hier auf der Ebene der Politik das demokratische Prinzip „one man one vote“ in das Marktprinzip „one euro one vote“ verkehrt wird.
In der Eurokrise muss die Politik klar sagen, was die Ursache der Misere ist und wie man sie zu überwinden gedenkt. Nur dann kann sie das Heft wieder in die Hand nehmen und von den Märkten Anpassung an ihre Entscheidungen erzwingen. Da aber liegt der eigentliche Hund begraben. Weil die deutsche Politik quer durch die meisten Parteien (von Herrn Weidmann bis zu Herrn Steinbrück) auf dem absurden Standpunkt beharrt, es gebe gar keine Eurokrise, sondern die Länder mit den hohen Staatsschulden bzw.
-defiziten seien wegen ihres Über-die-Verhältnisse-Lebens an allen Übeln allein Schuld, kann die europäische Politik den Befreiungsschlag nicht führen. Verengt man nämlich den Blick auf Staatsschulden und staatliche Misswirtschaft, lenkt man vom dem Thema ab, bei dem man sofort auf eigene Fehler stoßen würde. Wer Leistungsbilanzungleichgewichte, also die Verschuldung des ganzen Landes zum Thema macht, kommt nicht umhin zuzugeben, dass Außenhandelsdefizite der einen etwas mit Außenhandelsüberschüssen der anderen zu tun haben.
Zu viele Politiker (auch solche, die jetzt in der Opposition sind) einschließlich ihrer wissenschaftlichen Berater sind am Kern der Krise, der jahrelangen Politik des Gürtel-enger-Schnallens in Deutschland, unmittelbar beteiligt. Das zu begreifen geschweige denn offen zuzugeben, um einer tragfähigen Lösung nicht länger im Wege zu stehen, ist offenbar unmöglich. Daneben vertritt die deutsche Politik diese Position auch deswegen, weil sie auch in Zukunft nicht von den Nettoexporterfolgen der deutschen Industrie lassen will und das erfordert nun mal das Beibehalten der Wettbewerbsvorsprünge vor den Schuldenländern. Die jüngsten Außenhandelszahlen belegen, dass Deutschland den europäischen Konkurrenten weiter kräftig überlegen ist. [1]
Das führt zu dem grotesken Zustand, dass sich die herrschende politische Klasse in Deutschland seit mehr als zwei Jahren weigert anzuerkennen, dass das zentrale Ziel der Währungsunion eine Inflationsrate in der Größenordnung von zwei Prozent in jedem Mitgliedsland war und dass Deutschland massiv dagegen verstoßen hat. Der Hinweis, im Durchschnitt aller EWU-Länder sei das Inflationsziel aber doch erreicht worden, ist zwar richtig, zeigt aber lediglich, dass andere Länder ebenfalls dagegen verstoßen haben, nur eben anders herum, nach oben nämlich. Deutschland hat das Unterschreiten der Zielinflationsrate durch seine jahrelange Lohndumpingpolitik erreicht, die vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gerade wieder anhand von aktuellen Auswertungen des Sozioökonomischen Panels eindrucksvoll belegt wurde. [2] Dadurch ist Deutschland zu seiner Wettbewerbsstärke gelangt, die sich in der Wettbewerbsschwäche der Krisenländer widerspiegelt.
Dazu im beiliegenden Bild noch einmal der entscheidende Zusammenhang:
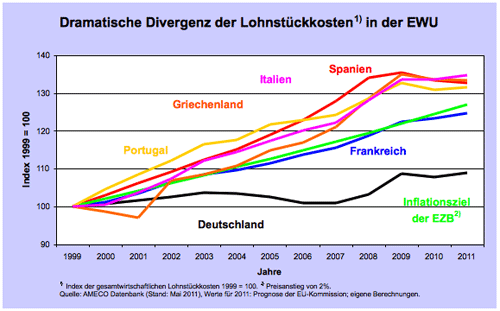
Deutschland unterschreitet mit seinen Lohnstückkosten, die die wichtigste Determinante der Inflationsrate und zugleich der Wettbewerbsfähigkeit sind, die Zielinflationsrate der EZB um mehr, als Griechenland und andere südeuropäische Länder sie überschreiten. Die dadurch über die Jahre entstandene Lücke ist so gewaltig, dass es Jahrzehnte einer anderen Politik braucht, um sie zu schließen. [3]
Das Traurige ist, dass sich die deutschen Politiker mit ihrer ignoranten Haltung, Deutschlands Beteiligung an der Misere nicht wahr haben zu wollen, in prominenter Gesellschaft befinden: Herr Trichet stellt in einem Interview in der FTD vom 18.7. explizit fest, Deutschland habe seit 1999 mit seiner Inflationsrate von durchschnittlich 1,5 Prozent alle Jahre einen „noch beeindruckenderen Wert“ zu verzeichnen gehabt als die EWU insgesamt, die fast genau bei 2% lag. Das kann nur als anerkennendes Lob für Deutschland aufgefasst werden. Hinter beiden Zahlen steht aber das enorme Auseinanderdriften nationaler Preisentwicklungen in den EWU-Ländern. Genau das ist jedoch in einer Währungsunion der Super-GAU und nichts, was der Chef der ihr vorstehenden Zentralbank loben oder gar als Stabilitätsbeweis der Währung anführen sollte. Der einzig mögliche Schluss, der sich aus der Äußerung des Chefs der EZB ziehen lässt, ist, dass er nicht weiß, wie eine Währungsunion überhaupt funktioniert, oder dass er es nicht wissen will.
Ein anderer namhafter Ökonom, Otmar Issing, bis 2006 Chefökonom der EZB, lobt in einem Interview der FAZ vom 11. Juli [4] genau wie Trichet, dass der Euro für weniger Inflation gesorgt habe als die D-Mark und brandmarkt gleichzeitig die Preis- und Lohnentwicklung in den europäischen Krisenländern. Das führt ihn zu dem Schluss: „Die Krise in diesen Ländern ist selbstverschuldet.“ [5] Kein Wort über Deutschlands lohnpolitisches Fehlverhalten in die andere Richtung. Und kein Wort zu einer sinnvollen Lösung, denn von dem Credo „Natürlich kann die EU nicht in die Lohnpolitik einzelner Länder eingreifen.“ [6] will der ehemalige Chefökonom auch angesichts der drohenden Zuspitzung der Krise noch immer nicht lassen.
Aber auch alle diejenigen, die jetzt auf einen Schuldenschnitt bei öffentlichen Anleihen als Lösung drängen, wissen nicht, wovon sie reden. Wenn sich die griechische Wettbewerbsfähigkeit nicht grundlegend verbessert und das Land auf diesem Wege oder durch direkte Konjunkturanregung nicht wieder auf einen Wachstumspfad mit Raten kommt, die über dem durchschnittlich zu zahlenden Zins liegen, bringt ein Schuldenschnitt beim öffentlichen Haushalt außer bestenfalls ein wenig gekaufter Zeit durch verringerten Umschuldungsbedarf nichts. Denn erstens entlastet er den Staat aktuell bei seinen Zinszahlungen nur, wenn der Zinssatz gleich bleibt. Steigt der Zins – was wahrscheinlich ist, da die Märkte den Zahlungsausfall mit steigenden Risikoaufschlägen auf die Zinssätze quittieren werden –, gibt es nicht einmal diesen Effekt. Zweitens trifft jede Kürzung von Zahlungen oder Zahlungsversprechen durch den Staat auch Inländer negativ, allen voran die griechischen Banken. Daher ist der Warnung der EZB vor einem Schuldenschnitt voll und ganz zuzustimmen: Das durch Zahlungsausfälle geschürte Misstrauen wird das griechische Kreditwesen lahmlegen und die privaten Investitionen wie den privaten Konsum weiter strangulieren. Obendrein dürfte die griechische Regierung nach einem Schuldenschnitt erst recht zum Sparen gedrängt werden, was die Abwärtsspirale beschleunigen wird. Da in der Eurozone mit dem Schuldenschnitt nicht, wie etwa im Falle Argentiniens 2002, auch die Währung massiv abgewertet werden kann, gibt es keinen positiven Impuls von außen, der die Situation verbessern könnte. Bei bestenfalls gleichem Zins und unveränderter bis sinkender Wirtschaftsdynamik wird Griechenland in wenigen Jahren wieder genau da sein, wo es vor dem Schuldenschnitt war. Was dann?
Alle diese Fragen müsste die Politik offen und klar diskutieren, statt jeden Tag eine neue Scheinlösung in die Medien zu werfen. Bei all diesen Fragen hilft auch der Blick auf die Märkte nicht. Eine Markteinschätzung ersetzt keine korrekte Diagnose. Ohne korrekte Diagnose kann es aber keine erfolgreiche Politik geben. Deutschland und die wichtigsten europäischen Institutionen gefährden mit ihrer Weigerung, das Offensichtliche zur Kenntnis zu nehmen, nicht nur die Lösung der akuten Krise, sondern inzwischen auch die Früchte des gesamten europäischen Einigungsprozesses. An der Erkenntnis, dass, „(w)er seine erwirtschaftete Produktivität nicht „verfrühstückt“, … alle übrigen Marktteilnehmer und schließlich auch sich selbst (bedroht)“, führt kein Weg vorbei. [7] Aber es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass Ideologie mehr zählt als Vernunft.
[«1] Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Juli 2011, S. 17 ff.
[«2] Vgl. http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2011/0719/seite1/0057/index.html
[«3] Vgl. http://rosalux-europa.info/events_en/heiner_flassbeck/ und die dort angegebenen Grafiken und Beiträge.
[«4] Vgl. http://www.faz.net/artikel/C30638/otmar-issing-der-euro-wird-mich-lange-ueberleben-30460634.html
[«5] Ebendort.
[«6] Ebendort.
[«7] H. Flassbeck / F. Spiecker: „Die Irrlehre vom Lohnverzicht“ in: Blätter für deutsche und internationale Politik, September 2005, S. 1071-1082.














