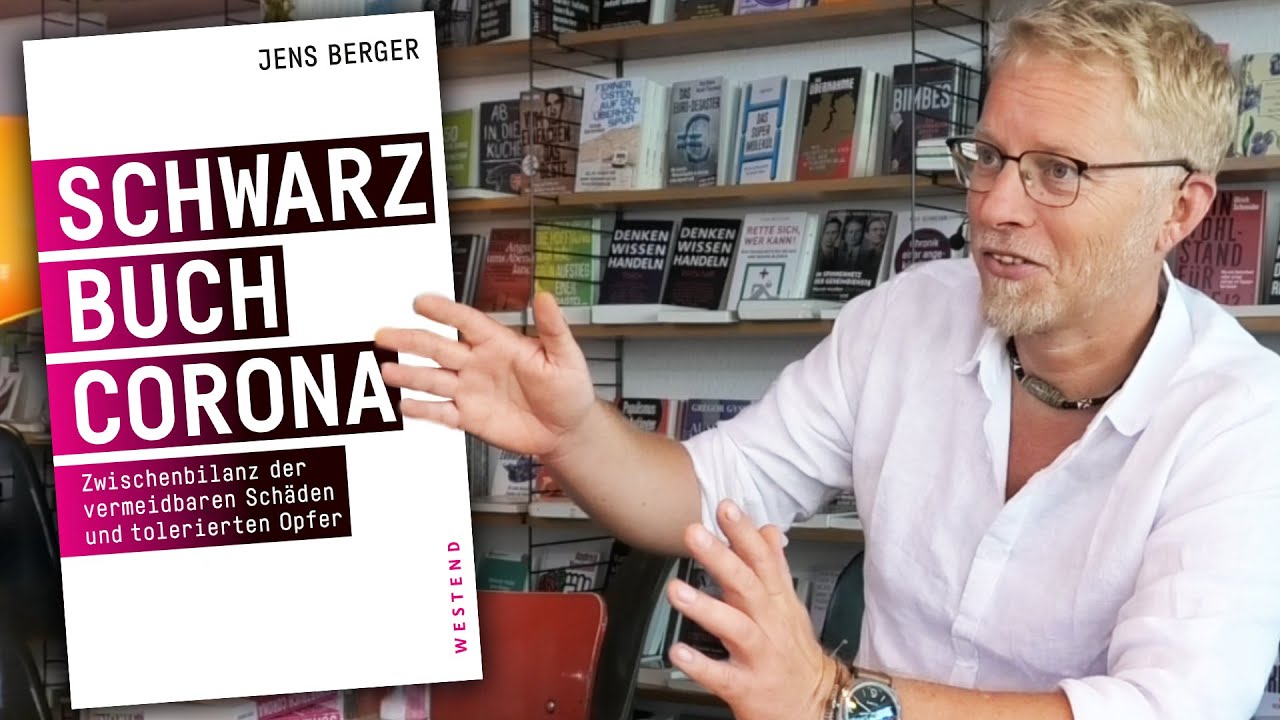Zum ersten Mal seit vier Jahren treffen sich die Präsidenten der USA und Russlands; es ist sogar schon achtzehn Jahre her, dass ein solches Treffen auf US-Boden stattfindet. Das allein ist bereits eine gute Nachricht, zumal es durchaus berechtigte Hoffnungen gibt, dass an diesem Freitag zwischen Donald Trump und Wladimir Putin ein Grundstein für den Friedensprozess im Ukrainekrieg gelegt werden kann. In den westeuropäischen Hauptstädten und den Leitartikeln deutscher Medien überwiegt jedoch eine Mischung aus Ablehnung und beleidigter Leberwurst. Man fühlt sich übergangen, weigert sich jedoch gleichzeitig immer noch standhaft, konstruktive Alternativen vorzulegen oder die geopolitischen Realitäten anzuerkennen. Von Jens Berger.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Dieser Artikel liegt auch als gestaltetes PDF vor. Wenn Sie ihn ausdrucken oder weitergeben wollen, nutzen Sie bitte diese Möglichkeit. Weitere Artikel in dieser Form finden Sie hier.
Als sich Napoleon Bonaparte und der russische Zar Alexander I. 1807 auf zwei Pontonbooten auf der Memel trafen und den Frieden von Tilsit verhandelten, musste der preußische König Friedrich Wilhelm III. das Treffen der beiden Herrscher als Zuschauer vom Ufer aus verfolgen. Nach mehreren militärischen Niederlagen war Preußen durch Frankreich auf das Maß einer Mittelmacht zurückgestutzt worden. Napoleon und Alexander steckten ihre Claims ab, zwei Tage später durfte der Preußenkönig dann einen von Napoleon vorgelegten „Diktatfrieden“ unterschreiben. Dieses Vorgehen entsprach den geopolitischen Realitäten im Sommer 1807 und war im Nachhinein wohl das Beste, was Preußen passieren konnte, gilt der Friede von Tilsit doch als Auslöser der kommenden Reformen, die Preußens Staatswesen grundlegend modernisieren sollten.
Wenn sich am Freitag Donald Trump und Wladimir Putin auf festem Boden in Alaska treffen, wird auch Friedrich Merz wie einst sein Namensvetter das Treffen sinnbildlich vom Ufer aus der Ferne betrachten. Und auch heute werden die geopolitischen Realitäten wahrscheinlich dafür sorgen, dass sowohl die europäischen NATO-Staaten als auch die Ukraine die zwischen den Großmächten ausgehandelte Übereinkunft nachrangig abnicken.
Sicher – Geschichte wiederholt sich nicht und Parallelen zwischen den Koalitionskriegen und dem heutige Ukrainekrieg sind bestenfalls anekdotisch, zeigen jedoch, dass es historisch eher die Regel als die Ausnahme ist, dass Großmächte wichtige geopolitische Weichenstellungen zunächst untereinander und nicht in großer Runde zusammen mit Mittelmächten oder gar den militärisch Unterlegenen ausbaldowern. Das war 1807 in Tilsit so. Das war 1815 beim Wiener Kongress so und auch 1919 bei der Friedenskonferenz im Schloss von Versailles war es nicht anders. Und es sollte auch keiner glauben, dass bei irgendeiner dieser Verhandlungen die Verfassung von Mittelmächten oder gar militärisch unterlegener Staaten die geopolitischen Realitäten der Großmächte in irgendeiner Form interessiert hätten. Die ukrainische Verfassung sieht keine Gebietsabtretungen vor? So what? Mir ist kein Fall bekannt, bei dem in einem Friedensprozess mit Gebietsabtretungen Rücksicht auf die Verfassung des militärisch Unterlegenen genommen wurde. Die normative Kraft des Faktischen hat kein Mitleid mit den Kleinen. Das kann man sehr wohl kritisieren. Ignorieren sollte man es aber nicht, will man sich nicht der Tagträumerei verdächtig machen.
Die Reaktionen der Staatschefs der europäischen NATO-Länder – samt ihrer vom Konformitätsdruck zerquetschten Leitartikler – machen sich im Vorfeld des Alaska-Gipfels der Tagträumerei einmal mehr hoch verdächtig. Hat man nicht stets behauptet, man fühle sich als Anwalt der Interessen des ukrainischen Volkes, über dessen Kopf hinweg kein Waffenstillstand, geschweige denn ein Friede verhandelt werden dürfe? Nun ja. Glaubt man den aktuellen Umfragen von Gallup, wünscht sich heute die überwältigende Mehrheit der Ukrainer, dass die Kriegshandlungen lieber heute als morgen ein Ende finden und dass es zu Friedensverhandlungen kommt. Die „Baerbock-Doktrin“, nach der die Ukraine so lange mit materieller und logistischer Unterstützung des Westens weiterkämpfen solle, bis man den Krieg gewonnen hat, vertritt heute nur noch eine Minderheit. Das war vor drei Jahren noch anders. Man muss es klar sagen: Wer heute „über die Köpfe der Ukrainer hinweg“ den Krieg fortführen will, handelt gegen die Interessen und gegen den Wunsch der übergroßen Mehrheit der Ukrainer … und nicht umgekehrt, wie es der politisch-mediale Sektor in Berlin so gerne insinuiert.
Warum hat man eigentlich in Berlin, Paris und London so eine große Angst davor, dass Russland und die USA den Frieden in der Ukraine beschließen könnten? Wirkliche Antworten findet man darauf zumindest anhand der öffentlichen Verlautbarungen nicht. So heißt es im gemeinsamen Statement der Europäer doch tatsächlich: „Wir halten weiterhin an dem Grundsatz fest, dass internationale Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden dürfen. […] Der derzeitige Frontverlauf sollte der Ausgangspunkt für Verhandlungen sein.“ Der Widerspruch sollte eigentlich sogar in deutschen Redaktionsstuben auffallen. Wer substanzielle Alternativvorschläge seitens der Europäer sucht, sucht ohnehin vergebens. Zwischen den Zeilen liest und hört man eher raus, dass die Europäer schlicht beleidigt sind, da die beiden Großmächte über ihren Kopf hinweg verhandeln, sie selbst bestenfalls konsultiert werden und am Ende wohl abnicken müssen, was Donald Trump und Wladimir Putin vereinbart haben.
Nun kann man die gekränkte Eitelkeit ja auch irgendwie verstehen, kollidieren hier doch das Selbstbildnis der Europäer – immerhin einst Kolonialmächte und die Herren der Welt – und die geopolitischen Realitäten des 21. Jahrhunderts, in denen die Europäer nun einmal tatsächlich nur noch eine Mittelmacht sind, frontal miteinander. Aber dann sollten die Europäer sich auch ehrlich machen und ihre Sonntagsreden von Wertepartnerschaft, einem sehr selektiv ausgelegten Völkerrecht und geheuchelter Solidarität mit der überfallenen Ukraine sein lassen. Außerhalb der eigenen Bubble wird dieses Gebabbel ohnehin bestenfalls belächelt.
Am Ende wird der Ukrainekrieg ohnehin weder von Trump und Putin, noch von Selenskyj oder gar dem Gruppetto rund um Merz, Macron, Starmer, von der Leyen und Co. beendet. Die „Sollbruchstelle“ des Krieges ist vielmehr der ukrainische Kriegswillen. Die Umfrageergebnisse von Gallup unterstreichen den Eindruck, den bereits die ukrainische Historikern Marta Havryshko vor einigen Wochen im Interview mit den NachDenkSeiten geäußert hat: Heute, im dritten Kriegsjahr, macht sich in der Ukraine Kriegsmüdigkeit breit und selbst mit materieller – und moralischer – Unterstützung der europäischen NATO-Staaten ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die Fronten kollabieren werden. Wäre der Krieg eine Poker-Partie, würde man wohl sagen, dass der „Bluff“ des Westens spätestens seit der Amtsübernahme Donald Trumps aufgeflogen ist und eigentlich jeder – außer vielleicht die deutschen „Talkshow-Experten“ – weiß, dass die immer noch kommunizierten Maximalforderungen von einem Frieden auf Augenhöhe ohne Gebietsabtretungen mit Sicherheitsgarantien durch die NATO eine gefährliche Tagträumerei sind, die nicht nur das Risiko einer Eskalation mit sich bringen, sondern auch tagtäglich von unzähligen Soldaten an der Front mit ihrer Gesundheit oder ihrem Leben bezahlt werden.
Wenn das Treffen in Alaska diesem Töten ein Ende macht, ist das gut. Wenn das Treffen darüber hinaus ein erster Schritt in Richtung einer neuen Sicherheitsarchitektur ist, die künftige Konflikte oder gar Kriege in Europa verhindern könnte, ist das um so besser. Doch für überschwänglichen Optimismus ist es zu früh. Auch Mittelmächte können gefährlich sein – vor allem dann, wenn ihr Selbstbild nicht mit den geopolitischen Realitäten übereinstimmt. Dies ist dann auch das eigentliche Haar in der Suppe, die in Alaska serviert wird. Ginge es nach den Russen, spielen Fragen wie Gebietsabtretungen eine eher nachrangige Rolle, wie es die New York Times erst vor wenigen Tagen in einem erfreulich sachlichen Artikel analysiert hatte.
Russland geht es vor allem um die Nachkriegsordnung – glaubwürdige Garantien des Westens, dass die Ukraine niemals direkt oder indirekt ein NATO-Mitglied wird und der Westen das Land auch nicht durch die Hintertür aufrüstet und zu einem militärischen Außenposten direkt an der russischen Grenze macht. Eigentlich sollten auch die europäischen Staaten mit einer solchen Friedensordnung sehr gut leben können. Zurzeit sieht man dies jedoch anders und daher sind die damit verbundenen Fragen in der Tat Punkte, die man mit den sich neuerdings gerne als halbstark gerierenden europäischen Staatschefs verhandeln müsste. Und da schließt sich der Kreis.
Für Preußen war die Scham, in Tilsit nur am Katzentisch zu sitzen und abzunicken, was die damals geopolitisch dominanten Franzosen und Russen unter sich verhandelt hatten, nicht nur der Auslöser von Reformen, die man im Nachhinein als progressiv bezeichnen kann. Auch die sich viele Jahrzehnte später als fatal erweisenden Minderwertigkeitskomplexe gepaart mit einer ungesunden Großmannssucht wurden in diesen Jahren durch die Demütigung geboren. Hoffen wir also, dass die heutigen Europäer ihren Platz in der Geschichte und auf dem geopolitischen Schachbrett harmonischer einnehmen werden. Denn nur so wäre eine dauerhafte Friedensordnung in Europa und der Welt überhaupt erst möglich.
Leserbriefe zu diesem Beitrag finden Sie hier.
Titelbild: Kollage NachDenkSeiten. Martial: ChatGPT und Медальон «Миниатюра на тему Тильзитского мира» Франция. 1810-е Бронза, эмаль, роспись На одной стороне изображение объятий Наполеона и Александра I, на другой – шатер посредине реки Неман, где происходили переговоры.