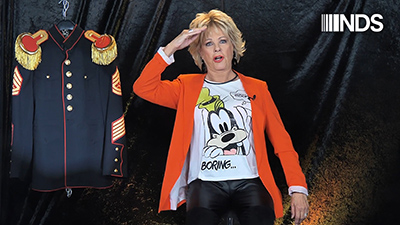„Das Volk ist wie das Gras, das immer wieder grünt und blüht, so oft es auch niedergetrampelt wird“, lautet ein koreanisches Sprichwort. Mehrfach und hautnah hat das Lutz Drescher (70) selbst erfahren, der knapp ein Jahrzehnt im Auftrag der evangelischen Kirche in Südkorea tätig war und dort in engem Kontakt mit der Menschenrechts- und Demokratiebewegung stand. Von 2001 bis 2016 war Drescher als Verbindungsreferent für Ostasien (Korea, China, Japan) und Indien der Evangelischen Mission in Solidarität e.V. (EMS – Stuttgart) zuständig für die Beziehungen zu dortigen Kirchen und Institutionen. Zahlreiche Reisen führten ihn in diese Länder sowie nach Nordkorea. Es folgten zwei Arbeitsjahre im Auftrag des Weltrates der Kirchen, in denen er als ehrenamtlicher Koordinator des „Ökumenischen Forums für Frieden, Wiedervereinigung und Entwicklungszusammenarbeit auf der Koreanischen Halbinsel“ tätig war. Mit Lutz Drescher, den die im Jahre 1884 gegründete Deutsche Ostasienmission (DOAM) 2020 zu ihrem Ehrenvorsitzenden ernannte, sprach unser Ost- und Südostasienexperte Rainer Werning.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
R. Werning: Herr Drescher, Sie sind Badener und wurden 1953 in Freiburg in Breisgau geboren. Welche Kindheitserlebnisse sind Ihnen am lebhaftesten in Erinnerung geblieben?
Lutz Drescher: Die ersten Lebensjahre waren ja noch vor der Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders. Wir waren insgesamt fünf Geschwister, und da herrschte kein Überfluss. Aber Feste wurden trotzdem feste gefeiert. Beides zu können, sparsam zu sein und großzügig, habe ich in meinem Elternhaus gelernt. Außerdem war ich der Älteste und hatte schon früh eine Verantwortung meinen Geschwistern gegenüber. Das hat meine Art, mich in unterschiedlichste Teams einzubringen, sicherlich geprägt. Ich habe immer versucht, achtsam zu sein und das Ganze im Blick zu behalten.
Wir sind bald nach Schönau im Schwarzwald umgezogen, wo mein Vater die Leitung des dortigen Forstamtes übernahm. Dort waren wir „die Fremden“. Wir sprachen anders, hatten einen anderen Glauben, ja, wir waren als Evangelische vermutlich Ketzer. Erst Jahrzehnte später vertraute mir einer meiner engsten Kindheitsfreunde an, wie sehr er darunter gelitten hatte, dass ich ausgerechnet ein Evangelischer war, der nach Aussage des damaligen katholischen Stadtpfarrers wohl in die Hölle komme.
Noch eine andere lustige Begebenheit ist frisch in meiner Erinnerung: Wir waren oft in Freiburg bei unserer Großmutter zu Besuch. Eines Tages zupfte mich mein jüngerer Bruder aufgeregt am Ärmel: „Guck‘ mal da, ein Neger“, sagte er ganz ungeniert sehr laut und deutete auch noch mit dem Finger auf die betreffende Person. Später, als ich in Korea lebte, habe ich das umgekehrt erlebt. Wenn ich durch die Gassen der Armenviertel auf den Hügeln der Metropole Seoul ging, deuteten oft Kinder völlig verblüfft mit ihren Fingern auf mich und sagten: „Guck‘ mal da, ein Amerikaner.“
Das Thema „Fremd sein und Fremden begegnen“ ist einer der roten Fäden, die sich durch mein Leben ziehen.
Was bestimmte in Ihrer Jugend maßgeblich den weiteren Lebens- und Berufsweg?
Die Nachwehen der 68er-Bewegung erreichten auch uns in der tiefsten Provinz. Nachdem es in Schönau nur ein Progymnasium bis zur Untersekunda (so hieß die zehnte Klasse damals) gab, habe ich die letzten drei Schuljahre – von 1969 bis 1972 – das Gymnasium in Schopfheim besucht. Damals fand der erste Schülerstreik in der Geschichte Baden-Württembergs statt, und ich hatte die Ehre, vom Rektor des Gymnasiums als einer der „Rädelsführer“ bezeichnet zu werden. Auch zur einsetzenden sogenannten „Dritte Welt-Bewegung“, die Gerechtigkeit weltweit einforderte, hatte ich Kontakt. Es kam in unserem Ort zu einem Skandal, als ich mich zusammen mit dem Gemeindepfarrer am Eingang des Schwimmbades mit Plakaten hungernder Biafra-Kinder aufstellte. Naserümpfen und Kopfschütteln allerorten … „tja, so sind sie eben, die Evangelischen“.
Auch in Taizé, einer ökumenischen Gemeinschaft in Burgund, war ich häufig. Dort lebten schon damals Menschen aus allen Kontinenten zusammen und verwirklichten so etwas wie die Vision einer „Menschheitsfamilie“. Ihr Motto damals: „Kampf (für eine gerechtere Weltordnung) und Kontemplation (ein Schöpfen aus inneren Quellen, deren Ursprung in Gott selbst liegt)“. Das einschneidendste Erlebnis war jedoch unmittelbar nach dem Abitur 1972 eine Reise mit dem VW-Bus über Land nach Indien und zurück.
Ich habe es genossen, unterwegs zu sein, und bin mir des Privilegs bewusst, dass Reisen stets zu meinem Beruf gehörte. Aber das Begegnen mit der und Eintauchen in die indische Wirklichkeit hat mich ziemlich durcheinandergewirbelt. Vor allem war es eine Frage, die ich mir immer wieder stellte: Warum bin ich als Deutscher auf die Welt gekommen, die mir jetzt offensteht und in der ich alle Möglichkeiten und zahlreiche Privilegien genieße? Wie sähe die Welt für mich aus, wäre ich als Inder auf die Welt gekommen? Was wären dann meine Hoffnungen und Erwartungen?
Indien hat mich nicht losgelassen. Ich war immer wieder dort, u.a. auch für einige Wochen in Kalkutta, wo ich bei den Brüdern der Nächstenliebe gewohnt und in Nirmal Hriday, dem von Mutter Theresa gegründeten „Sterbehaus“, mitgearbeitet habe. In Indien begann ich, über den Tellerrand zu blicken, und es war für mich ein großes Glück, dass ich in meinen letzten zehn Berufsjahren für Beziehungen zu den Kirchen in Indien zuständig war.
Eine letzte Station meiner Reise vor Beginn des Studiums möchte ich noch erwähnen. Ich habe nach meiner ersten Indienreise eine Ausbildung als Heilerziehungspflegehelfer im Epilepsiezentrum Kork gemacht. Dort hatte ich mit schwerbehinderten Kindern zu tun. Ich sage dies bewusst pointiert, weil ich von ihnen unendlich viel lernte.
Sie sagen, Indien hat Sie nicht losgelassen. Was konkret meinen Sie mit dieser offensichtlichen Zäsur in Ihrem Leben?
Zum einen war es der bereits angedeutete Perspektivwechsel. Wer einmal das eurozentrische Weltbild und den damit verbundenen engen Horizont hinter sich gelassen hat, der weiß einfach, dass wir weder der Mittelpunkt der Erde noch der Nabel der Welt sind. Wir sind nur ein kleiner Teil eines großen Ganzen. Das zu erkennen, ist eine große Befreiung und zugleich eine große Herausforderung. Es gibt aber auch noch einen anderen Perspektivwechsel. Die Welt, die Gesellschaft sieht ganz anders aus, wenn man sie „von unten“ in den Blick nimmt. Da werden die Widersprüche und Ungerechtigkeiten der Gesellschaft, ihre Kanten und Brüchigkeit nochmals viel deutlicher.
Für mich wurde auch die Theologie angesichts der furchtbaren Armut, die mir im Indien der 1970er-Jahre begegnete, gleichsam vom Kopf auf die Füße gestellt. Wo ist Gott? Diese Frage stellte sich mir da mit neuer Dringlichkeit. Einen wichtigen Hinweis gab mir der indische Dichter Rabindranath Tagore in seinem Gedicht „Lass dieses Singen von Chorälen“, in dem er auf die verweist, die im Schweiße ihres Angesichts auf den Feldern arbeiten oder Steine klopfen: „Dort ist er staubbedeckt zu deinen Füßen!“
„Gott, der an der Basis arbeitet“ lautete der Titel eines Buches, das mir viele Jahre später in Korea begegnet ist. In ihm sind Erfahrungen aus den koreanischen „Minjung“, sprich „Basis-Gemeinden“, in die ich dann später involviert war, aufgehoben. Mein koreanischer Name lautet Do Yo-Su – „Weg (Do = Tao) wie Wasser“. Dieses sucht stets die Tiefe. So ist es in meinem Verständnis auch mit Gott beziehungsweise Gottes Liebe. Willst du ihn/sie finden, musst du „unten“ suchen. Meine indischen Erfahrungen haben mir dann in Korea geholfen, einzutauchen in die sogenannte Minjung-Theologie, eine befreiende Theologie, die im Kontext des Widerstands gegen die südkoreanische Militärdiktatur entstanden und gereift ist.
Waren es die existentiellen Erfahrungen in Indien, die Sie schließlich bewogen haben, Theologie zu studieren?
In gewisser Weise schon, aber ich habe bewusst nicht Theologie studiert, sondern Religions- und Sozialpädagogik an einer Evangelischen Hochschule. Dies ist ein Studiengang, in dem Theorie und Praxis eng miteinander verflochten sind und sehr viel Wert daraufgelegt wird, sich als Mensch in seinen Beziehungen zu anderen sehr gut kennenzulernen. Es geht also um das Individuum u n d das Soziale. Humanwissenschaften u n d Theologie stehen gleichberechtigt nebeneinander und sind aufeinander bezogen. Es geht immer um Gott u n d Mensch, Gott u n d Welt. Den Satz, dass das Persönliche politisch ist, kann ich gut dahingehend erweitern, dass das Persönliche politisch und theologisch zugleich ist. Und umgekehrt will das Theologische persönlich und politisch werden.
Während meines Studiums blieben die schreienden Gegensätze, die mir in Indien begegnet sind, stets im Hinterkopf. Und unentwegt stellte sich mir die Frage, ob und wie Theologie im Blick darauf relevant ist und ein entsprechend „befreiendes Potenzial“ entfaltet. Die Zeit, in der ich studierte, war auch die Zeit, in der die sogenannten Befreiungstheologien entstanden sind beziehungsweise bei uns bekannt wurden. Mit ihnen habe ich mich immer wieder beschäftigt und ihre Ausprägungen im spezifisch koreanischen Kontext hautnah erlebt. Dabei kam mir zugute, dass ich mich zuvor intensiv mit dem Widerstand von Christen gegen den Faschismus befasste und mich in gewisser Weise mit der Geschichte der sogenannten „Bekennenden Kirche“ in Deutschland identifiziert habe.
Wie verschlug es Sie letztlich in eine neue Region – Ostasien, genauer nach Südkorea?
In meinen ersten Berufsjahren als Gemeindediakon ab 1981 war in unserer Gemeinde auch Pfarrer Kim Won-Bae, ein Mitarbeiter aus Korea, tätig. Durch ihn entstanden enge Beziehungen zu Christen in der südkoreanischen Stadt Gwangju. Dort hatte die Militärdiktatur im Jahr zuvor, im Mai 1980, ein Massaker verübt. In Korea selbst versuchte man, die Geschehnisse dort mit allen Mitteln unter den Teppich zu kehren. Nachrichten darüber fielen der Zensur zum Opfer oder waren grob entstellt. Wir jedoch konnten uns die schockierenden Bilder ansehen, die ein ARD-Korrespondent, Jürgen Hinzpeter, dort heimlich gedreht hatte. Eine Krankenschwester aus Gwangju, Ahn Sung-Rye, die spätere Gründerin des May Mother House, schrieb uns ergreifende Berichte, und die Menschen in Gwangju waren für unsere Solidarität dankbar. In Gwangju spielten Christen eine herausragende Rolle im Widerstand. Frau Ahn schrieb uns, dass der 1945 von den Nazis ermordete Dietrich Bonhoeffer „in Korea lebendig sei“. In Erinnerung an ihn hätten sie ihre Kirchengemeinde in „Bekennende Gemeinde“ umbenannt. Das alles hat uns aufgewühlt und sehr bewegt, vor allem dazu, uns immer wieder für die Freilassung der dort Inhaftierten einzusetzen.
Als ich 1986 gefragt wurde, ob ich bereit sei, über das Evangelische Missionswerk in Südwestdeutschland (EMS – heute: Evangelische Mission in Solidarität e.V. – RW) mit Sitz in Stuttgart nach Korea zu gehen, habe ich umgehend Ja gesagt. Viele der Mitglieder und der Pfarrer der Kirche, in der ich mitarbeiten sollte, waren im Widerstand gegen die Militärdiktatur und im Einsatz für Demokratie und Menschenrechte aktiv. Und viele von ihnen waren deshalb zu kürzeren oder längeren Gefängnisstrafen verurteilt worden. Mich hat der Gedanke, in Korea eine „Bekennende Kirche von heute“ erleben zu dürfen, fasziniert. Obwohl mir dann, als es so weit war, die Ausreise doch nicht ganz so leichtfiel: Inzwischen hatte ich nämlich gelernt, dass Korea nicht weit südlich von Sibirien liegt.
Südkorea befand sich zu der Zeit noch unter der Knute einer Militärdiktatur, wenngleich sich Seoul erfolgreich als Ausrichter der 24. Olympischen Sommerspiele 1988 beworben hatte. Doch gerade im Vorfeld dieses sportlichen Großereignisses kam es wiederholt zu massenhaften Protesten und einer „großen Demokratiebewegung“. Wie erlebten sie diese politisch ebenso bewegte wie bewegende Phase in Südkoreas jüngerer Geschichte?
Am 23. Februar 1987 kam ich in Südkorea an, und schon wenige Tage später, am 3. März, hatte ich meine erste Begegnung mit dem teuflisch ätzenden koreanischen Tränengas. Kurz zuvor hatte ein mutiger Arzt öffentlich gemacht, dass der in Polizeigewahrsam befindliche Student Park Jong-Cheol nicht etwa eines natürlichen Todes gestorben, sondern zu Tode gefoltert worden war. Ein Aufschrei der Empörung ging durch das Land, und es begannen Demonstrationen, die stetig anschwollen, größer wurden und schließlich in eine Massenbewegung mündeten. Im Zentrum dieser Demonstrationen stand ausgerechnet die renommierte Yonsei Universität, an der ich im März 1987 mein zweijähriges Koreanisch-Studium begonnen hatte. Dieses hat mich buchstäblich viele Tränen gekostet, nicht nur, weil die koreanische Sprache so schwierig ist, sondern auch wegen des Geruchs von Tränengas, das täglich in unterschiedlichen Dosierungen in der Nähe des Unicampus verschossen wurde.
Dabei wurde auch der Student Lee Han-Yol von einer Tränengasgranate am Kopf getroffen und lag wochenlang im Koma, bis er schließlich starb. Dies führte dazu, dass die Demonstrationen noch an Stärke zunahmen. Während es anfangs vor allem Studierende waren, die auf die Straßen gingen, schlossen sich ihnen nun immer mehr Leute aus der aufstrebenden Mittelschicht an. Es kam zu der „großen Juni-Demokratiebewegung“, die dazu führte, dass das Regime nachgab und einer Direktwahl des Präsidenten zustimmte. Noch sehr genau sind mir die Bilder vor Augen, wie am 9. Juli 1987 insgesamt 1,6 Millionen Menschen in einem nicht enden wollenden Demonstrationszug an der Beerdigung von Lee Han-Yol teilnahmen und dies zugleich als (Teil-)Sieg über die Diktatur feierten. Später las ich dann in der konfuzianischen Tradition, die Korea sehr geprägt hat, einen Satz, der sinngemäß so lautet: „Das Volk ist wie das Gras, so oft es auch niedergetrampelt wird, es steht dennoch immer wieder auf!“
Dass es zu diesem Volksaufstand kommen konnte und dieser nicht blutig vom Militär niedergeschlagen wurde, hatte auch damit zu tun, dass 1988 die Olympischen Spiele in Seoul stattfanden und das Regime dort ganz besonders unter internationaler Beobachtung stand. In Deutschland hatten die Kirchen zusammen mit anderen Organisationen, Vereinen und Initiativen aus der Zivilgesellschaft eine Korea-Olympiakampagne ins Leben gerufen, durch die der Demokratisierungsprozess der koreanischen Gesellschaft auch von außen wirksam mitunterstützt wurde. Diese Kampagne wurde von meinem werten Gesprächspartner koordiniert, und das von ihm mitverfasste Buch „Korea – kein Land für friedliche Spiele“ gehörte damals auch zu meiner Pflichtlektüre.
Die ersten beiden Jahre in Korea bedeuteten eine Phase des (Kennen-)Lernens, nicht nur der Sprache, sondern auch von Orten und Akteuren der Demokratiebewegung in den wie auch außerhalb der Kirchen. Ich war nah dran an der Zerstörung Sangkyedongs, eines Armenviertels am Rande Seouls, das zugleich Symbol der zunehmenden Marginalisierung der Armen war. Ich hatte meine ersten Begegnungen mit dem späteren Präsidenten und Friedensnobelpreisträger Kim Dae-Jung, der damals noch unter Hausarrest stand. Und ich habe ganz nahe die große Enttäuschung miterlebt, als sich die Opposition nicht auf einen gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten einigen konnte und damit bei den Wahlen im Dezember 1987 mit Roh Tae-Woo erneut einem General den Weg zur Macht ebnete. Dass 1998 doch noch mit Kim Dae-Jung ein einst zum Tode verurteilter Oppositionspolitiker zum Präsidenten gewählt wurde, gehört zu den großen Hoffnungsgeschichten des 20. Jahrhunderts.

Empfang bei Kim Dae-Jung, Südkoreas Präsident von 1998 bis 2003 sowie Friedensnobelpreisträger des Jahres 2000
Was genau war Ihr Betätigungsfeld in Korea?
Nach meinem Sprachstudium konnte ich tiefer in die südkoreanische Graswurzelbewegung eintauchen. Ich begann meinen Dienst in einer kleinen Kirchengemeinde im damals wohl größten Armenviertel – in Hakyedong im Norden von Seoul. Bekannt war dieser Ort unter dem Namen „Schweinedorf“, weil dort bis Mitte der 1980er-Jahre noch Vieh gezüchtet wurde. Als Viehzucht im Stadtgebiet dann gesetzlich verboten wurde, zogen bald die ersten Menschen in umgebaute Ställe ein. Schließlich waren es zirka 4.000 Personen, die dort lebten. Unter ihnen war auch ein junger Pfarrer, Oh Young-Shik, mit seiner Frau und seinen beiden kleinen Kindern. Er verstand seine Anwesenheit in diesem Slum als ein Zeichen, dass dieser auch im übertragenen Sinne „kein gottverlassener Ort“ war. Die Gemeinde, die dort entstand, feierte ihre Gottesdienste in einer aus Backsteinen selbst erbauten Kirche. Eigentlich war es eine Baracke, die nicht nur als Gottesdienstraum diente: Wochentags fand dort die Hausaufgabenhilfe für die Kinder und Jugendlichen statt. An Samstagen kamen Ärzte und Medizinstudenten zu einer kostenlosen Behandlung. Auch Demonstrationen wurden dort geplant, wenn das Viertel wieder einmal vom Abriss bedroht war.
Neben meiner Mitarbeit in dieser Gemeinde war ich zunehmend damit beschäftigt, Gruppen von Besuchern, die sich mit den unterschiedlichsten Aspekten koreanischen Lebens befassten, zu begleiten und für sie zu dolmetschen. Dabei habe ich auch das Schreiben für mich entdeckt. Die Zeit mit den Besuchsgruppen war immer zu kurz, und es gab immer so viel mehr zu erzählen. Also begann ich aufzuschreiben, was ich erlebt und erzählt hatte, und konnte es, nachdem es gedruckt war, auch in schriftlicher Form Besuchern mitgeben.
Ich habe gern Besuchergruppen begleitet, war aber stets froh, wenn ich in das „Schweinedorf“ zurückkehrte. Hier war ich zu Hause, war geerdet und habe gespürt, was den Menschen wirklich unter den Nägeln brennt. Wir haben gemeinsam gelacht und geweint. Die Menschen dort lebten in einer ständigen Unsicherheit: „Werden wir unseren Arbeitsplatz behalten und auch unseren Lohn bekommen? Was machen wir, wenn jemand aus der Familie krank wird? Wohin, wenn das Viertel wirklich abgerissen wird?“ Immer wieder haben wir Räume eröffnet, in denen die Menschen ihre Sorgen aussprechen und gleichsam ihr Herz ausschütten konnten – im Gespräch und auch im Gebet. Und gleichzeitig haben wir gemeinsam viel Freude erlebt. Wie sehr haben wir das leckere koreanische Essen genossen, gerne auch mit einem Soju, einem koreanischen Schnaps, obwohl ja eigentlich Christen der Genuss von Alkohol verboten war.
Diese kleine Minjung-Gemeinde gehörte zu einer Bewegung, die in der Zeit nach dem Massaker in Gwangju entstanden war. Es waren junge Pfarrerinnen und Pfarrer, von denen viele im Gefängnis waren, die damit begannen, solche Gemeinden in Arbeiter- und Armenvierteln oder auch in Bauerndörfern aufzubauen. Studierende, die ihrer Uni verwiesen wurden, Journalisten, die der Zensur unterlagen, Lehrer, die ihren Job verloren hatten, Gewerkschaftler, die inhaftiert waren, schlossen sich ihnen an. Es waren Gemeinden, in denen sich Marginalisierte, sozial Geächtete und politisch Unterdrückte, das sogenannte „Minjung“ versammelte. In diesen Gemeinden wurde die Erinnerung daran aufrechterhalten, dass Männer und Frauen aus christlichen Gemeinden zur Zeit der brutalen japanischen Kolonialherrschaft (1910-45) in der Unabhängigkeitsbewegung eine zentrale Rolle spielten. Ihre Mission war nicht vordergründig die Rettung von Seelen, sondern die Umwälzung gesellschaftlicher Verhältnisse, damit Menschen menschlich leben konnten.
Sie bereisten ebenfalls die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK – Nordkorea). Wie gelangten Sie dorthin, was war ausschlaggebend für solche Besuche?
Während der annähernd neun Jahre (1987-95), die ich in Südkorea verbrachte, habe ich bewusst auf einen Besuch in der Volksrepublik verzichtet. Ein solcher Besuch hätte meine Arbeit erschwert. Aber ich bin schon 1989 in Berlin das erste Mal einer Delegation des „Nordkoreanischen Christenbundes“ begegnet. „Nordkorea und Christen?“, wird sich nun mancher fragen. Ja, es gibt in der DVRK einen ganz offiziellen Christenbund. Er hat etwa 13.000 Mitglieder, die sich in zwei Kirchen in der Hauptstadt Pjöngjang und in 500 Hauskirchen treffen. Dabei spielt die Tatsache, dass die Missions- und Kirchengeschichte in Korea eine ganz besondere ist, eine große Rolle. In Korea gab es keine unheilige Allianz von Kreuz und Schwert. Christen und Kommunisten haben sich gleichermaßen auf ihre je eigene Art gegen die japanische Kolonialmacht gestellt. Es ist darüber hinaus bekannt, dass Kim Il-Sung eine christliche Schule besuchte, wo er u.a. von seinem Onkel unterrichtet wurde. Seine Mutter mit dem biblische Bezüge aufweisenden Namen Kang Ban-Seok (Ban-Seok = der Fels) war ehrenamtliche Mitarbeiterin in einer Kirchengemeinde, der Chilkol Kirche. An dem Ort, an dem diese Kirche ursprünglich stand, ließ Kim Il-Sung – nach einer ersten, der 1988 errichteten Pongsu Kirche – im Jahr 1992 eine zweite, eben die Chilkol Kirche, erbauen. Sie liegt nicht irgendwo versteckt, sondern inmitten eines Neubauviertels.
Ich hatte zuvor mehrfach Delegationen des Nordkoreanischen Christenbundes begleitet. Als ich dann 2001 das Amt des Ostasien-Verbindungsreferenten der Evangelischen Mission in Solidarität (EMS) – wie sie heute heißt – übernahm, erhielten wir in Stuttgart zum ersten Mal eine Einladung, Nordkorea zu besuchen. Das haben wir dann im Mai gemeinsam mit Vertretern der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) auch getan. Während meiner Amtszeit von 2001 bis 2016 war ich vier Mal in der DVRK.
Welchen gemeinsamen Erfahrungshorizont teilen Nord- und Südkoreaner? Und was sind die auffälligsten Differenzen zwischen den Menschen nördlich und südlich des sie noch immer trennenden 38. Breitengrads?
Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Ich bin bei drei meiner vier Reisen in die DVRK bewusst gemeinsam mit in Deutschland lebenden Südkoreanern gereist. Für mich war es spannend mitzuerleben, wie sie die Dinge sehen und erleben. Was oft übersehen wird, wenn wir an die beiden Teilstaaten denken, ist die gemeinsame kulturelle Prägung. Die Urreligion Koreas ist der Schamanismus, ein religiöses Phänomen, in dem Emotionen und Ekstase eine große Rolle spielen. Solche Emotionalität in Form von tränenüberströmten Gesichtern lässt sich z. B. beobachten, wenn im Norden ein Vertreter der Kim-Familie auftritt und in Südkorea bei Konzerten von Boy Bands aus der K-Pop-Szene oder auch in christlichen Kirchen.
Die andere große Tradition, deren Einfluss bis heute im Norden und im Süden wahrnehmbar ist, ist der Konfuzianismus. Wohl nirgends sonst war der Konfuzianismus so ausgeprägt und wirkmächtig wie in der Yi-Dynastie des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Vieles, was uns in Nordkorea zuerst als fremd erscheint, wird vor diesem Hintergrund verständlicher. In Nordkorea begegnet einem nicht nur auf dem sogenannten Ewigkeitsturm immer wieder die Inschrift: „Der Große Führer, Genosse Kim Il-Sung, wird ewig mit uns leben.“ Was sich zumindest für die Ohren mancher Christen wie Blasphemie anhört, ist angesichts schamanistisch-konfuzianistischer Ahnenverehrung eine Selbstverständlichkeit. In Korea sind die Ahnen lebendiger als bei uns. Früher wurden sie oberhalb der Felder begraben, und ihre Nachfahren bestellten ihre Felder „vor den Augen der Ahnen“.
Trotz dieser gemeinsamen kulturellen Wurzeln haben sich die beiden Landesteile im Verlauf der vergangenen 75 Jahre stark auseinanderentwickelt. Zwar wird auf beiden Seiten immer noch betont, dass „in den Adern dasselbe Blut fließe“, aber davon spüren die über 30.000 Nordkoreaflüchtlinge im Süden wenig. Sie werden eher ausgegrenzt! Was immer die Zukunft bringt, es gibt kein Zurück zu gemeinsamen Wurzeln, sondern allenfalls ein Zusammenwachsen und eher wohl ein „Zusammenraufen“ von verschiedenen.
Wenn wir die heutige Situation in den beiden Landesteilen betrachten, sind die riesigen Unterschiede unübersehbar. Vor allem wirtschaftlich ist die Situation im Norden sehr schwierig. Es gibt ganz unterschiedliche Zahlen, geschätzt wird jedoch, dass das Pro-Kopf-Einkommen im Norden nur ein Vierzigstel dessen im Süden beträgt. Die Lebenserwartung ist um 15 Jahre geringer, und zwölfjährige Kinder sind durchschnittlich zwölf Zentimeter kleiner. Die Gründe für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Norden sind sicher vielfältig. Die Isolation des Landes spielt dabei ebenso eine Rolle wie die Auslandssanktionen, denen es nun schon seit Jahrzehnten ausgesetzt ist.
Korea ist seit 75 Jahren geteilt. Was macht es so schwer, dass beide Seiten wieder zusammenkommen? Wie beurteilen Sie die bisherige Politik des „Westens“ vis-à-vis den (Wieder-)Vereinigungsbestrebungen auf der Koreanischen Halbinsel?
Wenn wir das schwierige Thema Wiedervereinigung ansprechen, ist es wichtig, darauf zu schauen, wie sich die Geschichte der Teilung ausgewirkt hat. Der Koreakrieg (1950-53) war schrecklich und hat seine traumatischen Spuren in beiden Teilen des Landes hinterlassen, aber auf je unterschiedliche Weise. In Südkorea ist die Gesellschaft bis heute tief gespalten. Immer noch werden Teile der Gesellschaft, darunter auch die konservativen Kirchen, von einem militanten Antikommunismus beherrscht, der in der Vergangenheit ebenso schreckliche Menschenrechtsverletzungen zur Folge gehabt hat.
Ein anderer Teil der Gesellschaft hat dagegen erkannt, dass der Koreakrieg der erste heiße Konflikt in der Phase des Kalten Krieges war und Korea ebendiesem zum Opfer fiel. Kurzum: In gewisser Weise verläuft die Teilung Koreas mitten durch die südkoreanische Gesellschaft und die Millionen Koreaner, die im Ausland leben. Und manchmal scheint es, als ob diese Spaltung Hauptgrund dafür sei, dass man nicht zusammenkommt.
Anders ist es in Nordkorea: Nordkorea wurde im Koreakrieg völlig dem Erdboden gleichgemacht und hatte auch ungleich mehr Opfer zu beklagen. Unvergessen sind dort die amerikanischen Bombengeschwader mit ihrer tödlichen Fracht. Bis heute ist die Angst vor dem, was „die Amerikaner“ in Korea angerichtet haben und wieder anrichten könnten, bei Gesprächen mit Nordkoreanern allseits spürbar. Sicher wird sie auch propagandistisch geschürt und so der innere Zusammenhalt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gestärkt. Aber stets geistert der Gedanke eines „Erstschlags“ nicht nur durch die Medienlandschaft, sondern auch durch die Köpfe US-amerikanischer Politiker und Militärs.
Die Angst, dem hilflos ausgeliefert sein zu können, ist der tiefste Grund für das nordkoreanische Atomprogramm. Ihm wird nicht durch Sanktionen beizukommen sein, sondern nur durch Sicherheitsgarantien, einen Nichtangriffspakt und besser noch durch einen Friedensvertrag. Genau das fordern die Kirchen in Nord- und Südkorea gleichermaßen gemeinsam und seit Langem!
Es kam ja in den vergangenen Jahren teils zu dramatischen Entwicklungen, die weltweit mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wurden. Südkoreas Präsident Moon Jae-In (2017-22) war angetreten mit der erklärten Absicht, ein Friedensregime auf der koreanischen Halbinsel zu errichten. Kim Jong-Un, der 2011 ins Amt kam, hat von Anfang an eine doppelte Strategie militärischer Stärke und wirtschaftlicher Entwicklung verfolgt. Es kam zu mehreren Gipfeltreffen auch mit Präsident Trump. Das alles hat zu nichts geführt, weil weder die jeweiligen Vorstellungen noch die wechselseitigen Erwartungen zueinander gepasst haben. Vor allem aber scheiterten sie, weil trotz einiger Vorleistungen von Seiten der DVRK darauf nicht mit erhoffter Lockerung der Sanktionen seitens Washington reagiert wurde.
In den Erklärungen der verschiedenen Gipfeltreffen im Jahre 2018 ist stets davon die Rede, dass alle feindseligen Handlungen eingestellt werden. Für den Norden wie auch für die Zivilgesellschaft und die progressiven Kirchen Südkoreas verstößt die Abhaltung von Militärmanövern eindeutig gegen solche Erklärungen. In einer Pressemitteilung des Nationalen Kirchenrates heißt es dazu:
„Mit heiligem Zorn fordern wir nachdrücklich die sofortige Einstellung aller militärischen Aktionen und feindseligen Maßnahmen, die zu Konfrontationen und Konflikten auf der Koreanischen Halbinsel führen.“
Wie schätzen Sie die Haltung der Regierungen in Washington ein, und wie hat sich in den letzten Jahren das Verhältnis zwischen Nord- und Südkorea entwickelt?
Der frühere US-Präsident Obama hat sich im Blick auf Nordkorea nicht sehr stak engagagiert. Man bezeichnete seine Haltung als „strategische Geduld“, was auch immer das heißen mochte. Sein Ansatz beruhte einfach darauf, Nordkorea zu isolieren und es Sanktionen auszusetzen. Ex-Präsident Trump hat versucht, sich als Dealmaker zu präsentieren und ist damit kläglich gescheitert.
Schon zu Beginn der Amtszeit von Präsident Biden wurde deutlich, dass seine Administration andere Schwerpunkte setzen wird. Bei der ersten Reise seines Außenministers zusammen mit dem Verteidigungsminister nach Ostasien wurde viel vom „indo-pazifischen Raum“ gesprochen und weniger von Ostasien an sich. Dahinter steht geostrategisch betrachtet der Versuch, durch die als „Quad“ bekannte militärische Zusammenarbeit von Indien, Japan und Australien der zunehmenden Stärke und dem Einfluss Chinas etwas entgegenzusetzen. Für Biden steht eher die Konkurrenz zu China im Mittelpunkt der Politik. Meine schon zu Beginn seiner Amtszeit geäußerte Befürchtung, dass angesichts des Konflikts um die Vormacht im pazifischen Raum die Koreafrage in den Hintergrund tritt, hat sich bestätigt. Dies gilt auch für die Voraussage, dass sich die DVRK melden wird – und zwar lautstark –, wenn sie das Gefühl hat, übersehen oder überhört zu werden.
Eindrücklich demonstriert wurde dies, als am 16. Juni 2020 Nordkorea das innerkoreanische Verbindungsbüro in der Grenzstadt Kaesong in die Luft gesprengt hat. Seither haben sich die Beziehungen zu Nordkorea zunehmend verschlechtert. Passend zum Amtsantritt des neuen konservativen Präsidenten Südkoreas, Yoon Yuk-Seol, am 10. Mai 2022 führte Nordkorea einen Raketentest durch, wobei Yoon selbst zuvor während seines Wahlkampfs zu einer Verschärfung des Konflikts beigetragen hatte, indem er einen Erstschlag auf Nordkorea nicht ausschloss. Eine weitere Verschärfung des Konflikts erfolgte jüngst im November dieses Jahres, als von beiden Seiten ein 2018 unterzeichnetes Abkommen zum Abbau militärischer Spannungen ausgesetzt wurde und beide Seiten begannen, wieder mehr Waffen und Streitkräfte an der Grenze zu stationieren.
Ein interessantes Phänomen sei hier noch erwähnt: Nordkorea befand sich seit Januar 2020 in einem extrem strengen Lockdown, der erst im August 2023 langsam gelockert wurde. Eigentlich hatte niemand dem verarmten Land zugetraut, diese harsche Zeit zu überstehen. „Aber siehe, sie leben!“, so stellen viele nun fest und kommen nicht darum herum, den Menschen in Nordkorea deshalb auch Anerkennung zu zollen.
Sie sind Ehrenvorsitzender der Deutschen Ostasienmission (DOAM). Was verbirgt sich dahinter, und wie positioniert sich diese heute?
Vieles von dem, wofür wir stehen und was uns auszeichnet, ist bereits skizziert worden. Es geht uns um „Gott und die Welt“, es geht uns um „Gott und den Menschen“ und in beidem darum, dass die Welt menschlicher wird. Es geht darum, „Erlösung“ und „Befreiung“ nicht nur zusammen zu denken, sondern zusammenzubringen.
Die DOAM, die eng mit der Evangelischen Mission in Solidarität (EMS) in Stuttgart und dem Berliner Missionswerk (BMW) verbunden ist, versteht sich als ein Forum für die Begegnung und die theologische sowie gesellschaftspolitische Auseinandersetzung von Menschen aus Ostasien und dem deutschsprachigen Raum. In einer zunehmend globalisierten Welt und multikulturellen Umgebung sind Begegnung, Austausch und das Lernen voneinander über Grenzen hinweg unhintergehbar und für alle Beteiligten gleichermaßen bereichernd.
In krassem Unterschied zu fast allen anderen Missionsgesellschaften zeichnete sich die DOAM schon bei ihrer Gründung 1884 durch große Offenheit anderen Religionen gegenüber aus. Sie fördert bis heute das Studium der nichtchristlichen Religionen und sucht bewusst das Gespräch mit anderen Kulturen und Religionsgemeinschaften. Ein großes Anliegen ist uns der Einsatz für Demokratie, Menschenrechte, Gerechtigkeit und Frieden und die Solidarität mit Benachteiligten sowohl in Ostasien wie in Deutschland.
Unsere Homepage www.DOAM.org, auf die wir sehr stolz sind, ist eine Fundgrube, wenn es um Projekte der Zivilgesellschaft und der Kirchen geht, eine andere, eine menschlichere Welt zu schaffen. Hier findet sich überdies, um nur ein Beispiel zu nennen, vorzügliches Material zum Widerstand gegen die US-Militärbasen in Südkorea und auf Okinawa.
Beteiligt bin ich außerdem bei der Herausgabe des DOAM-Newsletters. In ihm kommen immer auch Menschen aus Ostasien zu Wort. Alle Ausgaben finden sich unter doam.org/archiv/zeitschriften-jahrbuch/doam-info-briefe . Eigentlich bin ich ein Sammler von Hoffnungsgeschichten. Widerstand, Aufstand, Auferstehung – gibt es da nicht einen Zusammenhang? Wenn wir Christen Ostern feiern, dann feiern wir ein Leben und eine Lebendigkeit, die sich nicht unterkriegen lässt, die stärker ist als der Tod. Vielleicht leuchtet ja solche Lebendigkeit auch auf in dem koreanischen Sprichwort vom Volk, das wie das Gras ist und immer wieder grünt und blüht, so oft es auch niedergetrampelt wird.
Und jetzt in der Weihnachtszeit geht es um „die da unten“, die Hirten damals, das waren die Marginalisierten und Unterprivilegierten. Es geht um einen Gott, der den „hohen Thron“ verlässt und sich auf ihre Seite stellt – kurzum: es geht um Solidarität! Und es geht um die unstillbare Sehnsucht nach Frieden, einen anderen Frieden als die Pax Romana damals und die Pax Americana oder den Chinesischen Frieden heute. Es geht um einen Frieden auf Erden – auch auf der Koreanischen Halbinsel.