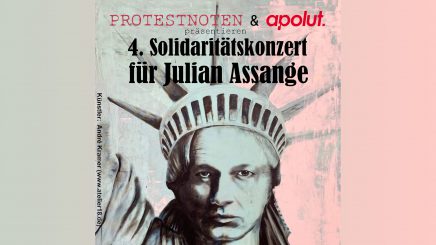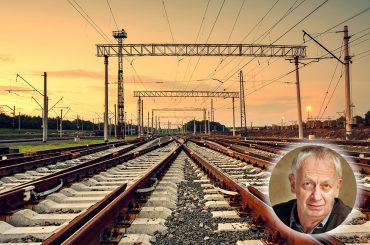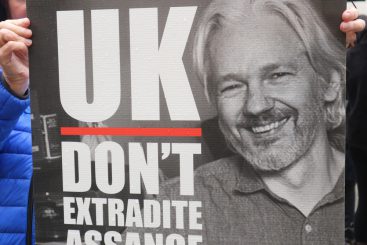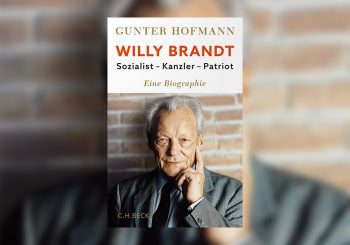Grün ist das neue Rechts

Man sieht es allerorten, und es verdichtet sich. Die politische Rechte ist grün. Braun ist längst vergessen; Christlich-konservativ plagte die 1950er-Jahre, und National war gestern. Die heutige Rechte ist grün. Sie vereint dafür alle notwendigen Ingredienzen: Kriegsbegeisterung, Verbotskultur, geopolitischen und kulturellen Missionierungseifer, Affinität zum autoritären Staat und jede Menge erschaffene Feindbilder. Der Faschismus-Begriff ist für sie unpassend, steckte in diesem doch das Versprechen auf einen gemeinsamen Volkskörper mit entsprechender Abschottung nach außen, gepaart mit einer Betonung rassischer Überlegenheit. Das Gegenteil ist bei der neuen Rechten der Fall. Sie sagt es selbst, wofür sie steht: Weltoffenheit und die Betonung der Überlegenheit ihrer Werte bilden ein toxisches Gemisch, mit dem innere Repression und äußere Expansion gerechtfertigt werden. Von Hannes Hofbauer.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.