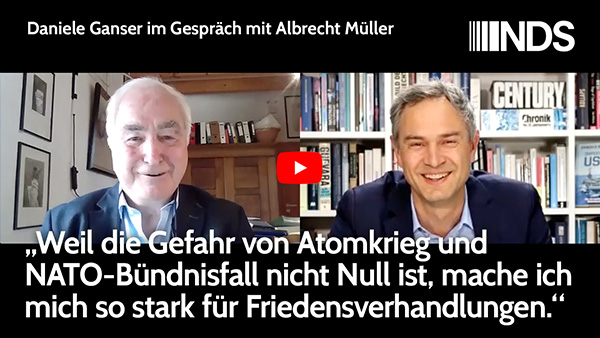Am Sonntag hat der „Presseclub“ zum Thema Wehrpflicht „debattiert“. Die Sendung dokumentiert wie unter einem Brennglas: Einseitigkeit und Qualitätsdefizite prägen in weiten Teilen den milliardenschweren öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Eine Kurzanalyse anhand von Tweets, die die Presseclub-Redaktion auf der Plattform X veröffentlicht hat. Von Marcus Klöckner.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Der „Presseclub“ hat geladen. Das Thema Wehrpflicht soll „debattiert“ werden. Vier Gäste sind im Studio.
Zunächst zum Selbstverständnis des „Presseclubs“. Auf der ARD-Webseite heißt es:
Der Presseclub ist eine aktuelle Diskussionssendung, in der das jeweils wichtigste politische Thema der Woche aufgearbeitet wird. Journalistinnen und Journalisten mit unterschiedlichen Standpunkten analysieren aus unterschiedlichen Blickwinkeln politische Ereignisse und Entwicklungen. Dabei wird der Hintergrund von Schlagzeilen aufgehellt, und es entsteht im Dialog ein Wettstreit um die Interpretation von politischen Vorgängen. Für das Publikum ergibt sich damit ein Angebot von Meinungen, die sich in der Diskussion überprüfen lassen müssen und auf diese Weise ihre Glaubwürdigkeit und Plausibilität unter Beweis stellen müssen.
In den Ausführungen spiegelt sich der Kernauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wider, das heißt: für Land und Gesellschaft zentrale Themen aufgreifen, aufarbeiten, unterschiedliche Perspektiven sichtbar machen, Dialog und Diskussion herstellen, aber auch kritisch analysieren.
Das Problem: Es gibt einen Unterschied zwischen Selbstdarstellung und der Realität.
Zur Realität und damit zur Sendung vom 19. Oktober 2025:
Neuer Koalitionsstreit: Mit Wehrpflicht-Lotto gegen Putin?, lautet der Titel der Sendung.
Zu den Gästen gehören Hauke Friederichs (Die Zeit), Lisa-Martina Klein (Security.Table), Paul-Anton Krüger (Der Spiegel) und Julia Weigelt (Freie Journalistin, Moderatorin).
In Anbetracht der Gästeauswahl drängt sich die Frage auf: Was soll diese Gästezusammensetzung widerspiegeln? Die in der Selbstdarstellung proklamierten „unterschiedlichen Standpunkte“ und „unterschiedlichen Entwicklungen“?
Eine Auseinandersetzung mit Tweets der Presseclub-Redaktion verdeutlicht das Grundproblem.
Noch ein Tweet:
Weiter „zwitschert“ die Redaktion:
Außerdem heißt es:
Des Weiteren:
In einem anderen Tweet ist zu lesen:
Und:
Diese Beispiele sollen genügen. Und, damit keine Missverständnisse entstehen: Die Tweets sind nicht verzerrend ausgesucht. Die Tweets wurden in dieser Reihenfolge von unten nach oben von der Redaktion veröffentlicht. Tweets, die inhaltlich anders angelagert sind, gibt es keine. Auch die restlichen Tweets spiegeln den hier zum Vorschein kommenden Tenor wider.
Zu einer umfassenden Analyse der Sendung wäre es sicherlich notwendig, die gesamte „Diskussion“ näher zu betrachten. Das würde den Rahmen dieser Kurzanalyse sprengen. Aber die Tweets dürften redaktionell ausgesucht sein und damit exemplarisch zentrale Grundpositionen der Teilnehmer und der „Diskussion“ widerspiegeln.
Was auffällt: Keiner der Gäste hinterfragt die grundlegende politische Erzählung, wonach es eine Notwendigkeit für den Ausbau der Bundeswehr geben soll. Die Grundprämissen, wonach Russland eine Bedrohung darstellt und deshalb ein „Aufwuchs“ stattfinden muss, sind gesetzt. Die gebotene Diskussion bewegt sich um das „Wie?“, aber nicht um „ob überhaupt?“. Und somit ist auch kein Raum, die massive politische Propaganda, die derzeit die Öffentlichkeit umgibt, zu dekonstruieren. Genau das wäre aber die Aufgabe des milliardenschweren öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Schließlich wurde der ÖRR vor allem aufgrund der Erfahrungen aus der Nazi-Zeit – mit einer gleichgeschalteten Presse – konzipiert und mit genügend Mitteln ausgestattet, um Propaganda im eigenen Land entgegenzutreten – so zumindest die naive Betrachtung.
Alle hier in den Tweets angeführten Aussagen werden der propagandistisch-manipulativ aufgeladenen Komplexität der Verhältnisse im Hinblick auf die Einführung der Wehrpflicht nicht gerecht. Im Gegenteil: In weiten Teilen muten sie wie ein journalistischer Offenbarungseid an. Wenn es etwa heißt, dass die Entscheidung Deutschlands für die Wehrpflicht eine „massive Signalwirkung auf Russland“ hätte, ist das weder journalistisch noch intellektuell tragfähig. Ob Deutschland seine Armee nun etwas vergrößert oder nicht, ob Deutschland die Wehrpflicht einführt oder nicht, ist – bei Lichte betrachtet – für die Atommacht (!) Russland ohne Bedeutung.
Nicht besser die Aussage, wer per Los zur Bundeswehr gezogen werde, fühle sich „als Verlierer“.
Die Politik hat die Losung „Kriegstüchtigkeit“ ausgegeben. Für junge Menschen folgt am langen Ende möglicherweise ein Kriegseinsatz – mit allem, was dazugehört: Tod, Verstümmelung, Leid, Schmerz, Traumatisierung. In der Diskussion um die Wehrpflicht hat es nicht darum zu gehen, ob sich junge Menschen als „Verlierer“ oder „Gewinner“ „fühlen“. Schließlich: Wenn sich etwa ein 20-Jähriger als „Gewinner“ fühlen sollte, ihm aber irgendwann auf dem Schlachtfeld der Kopf weggeschossen würde, dann wäre es für ihn zu spät, zu begreifen, dass das mit einem „Gewinn“, was den Militärdienst angeht, so eine Sache ist.
Die Debatte muss sich zwingend darum drehen, dass Journalisten militaristische Propaganda, die die Bestrebung nach einer Wehrpflicht umgibt, offen kenntlich machen.
Journalisten müssen jungen Menschen die Tragweite des politischen Großunternehmens Kriegstüchtigkeit im Verbund mit der neuen Wehrpflicht vor Augen führen. Die Fokussierung auf eine vage Gefühlsebene, auf der sich die Wahrnehmungen um ein „Gewinnen“ und „Verlieren“ drehen, erfasst nicht einmal im Ansatz das eigentliche Grundproblem.
Auch wenn es heißt, es gälte aufzuhören, das „tote Pferd“ der Wehrpflicht „zu reiten“, um anzufangen, „wirkliche Maßnahmen“ zu treffen, damit sich mehr Berufs- und Zeitsoldaten gewinnen ließen, geht an jenen Diskussionspunkten vorbei, über die dringend in einer solchen Sendung wie dem „Presseclub“ zu diskutieren gewesen wäre. Denn: Warum soll „die Truppe“ überhaupt anwachsen? Warum soll Deutschland überhaupt mehr Berufs- und Zeitsoldaten benötigen?
Die Antwort aus der Politik ist bekannt: Wegen Putin! Stichwort: „Zeitenwende!“ Und genau an dieser Stelle müsste eine Diskussion, die diesen Namen auch wirklich verdient, ansetzen. Hier könnte von kritischen Mitdiskutanten die Axt an bestehende Propagandanarrative angesetzt werden. Das passiert aber nicht, weil die Redaktion niemanden eingeladen hat, der dazu fähig oder gewillt wäre.
Zum Schluss noch ein stichpunktartiger Blick in die Sendung.
Bei Minute 2:50 sagt Hauke Friederichs von der Zeit das Folgende: „(…) denn, dass wir im Fokus russischer Dienste stehen, dass merkt man ja mit den zahlreichen Drohnenüberflügen (…)“.
Beweise für diese Ausführungen werden nicht geliefert. „Man“ „merkt“ das eben – es ist eben so. Kritisches Nachfassen vonseiten der Moderation, Kritik von den Mitdiskutanten: erfolgt nicht.
Eine ganze Reihe von Problemen wird deutlich.
Erstens: Die zitierten Aussagen sind von dürftiger Qualität. Redaktionelle Aufgabe wäre es gewesen, für eine Gästeauswahl zu sorgen, die journalistische, inhaltliche, analytische und intellektuelle Qualität widerspiegelt.
Zweitens: Wenn eine Redaktion offensichtlich schon Gäste einlädt, die sich so positionieren und äußern wie die Eingeladenen, müsste es zwingend Gegengewichte geben. Das ist, wie gesagt, nicht der Fall.
Drittens: Das Fehlen jener Stimmen, die die politische Propaganda in Deutschland auseinandernehmen, wiegt schwer. Um es nochmal zu sagen: Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks muss es sein, auch die politische Propaganda und Manipulation der Regierung aufzuzeigen. Gerade bei einem Thema wie der Wehrpflicht, das unweigerlich mit der Frage von „Krieg und Frieden“ verbunden ist, darf nicht den politischen Erzählungen, befreit von Fundamentalkritik, gefolgt werden. Ist das der Fall, macht sich ein Medium selbst zum verlängerten Arm der Propaganda. In Deutschland gibt es zahlreiche kritische Journalisten, Autoren und Medienschaffende, die sich vor allem in alternativen Medien gegen die Wehrpflicht und die deutsche Russlandpolitik stellen. Diesen Stimmen müsste die Redaktion zwingend Raum geben. Denn: Wie Umfragen zeigen, spiegeln diese Stimmen einen beachtlich großen Teil der Bevölkerung wider. Ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der eine solche Sendung abliefert wie diesen „Presseclub“, verfehlt seinen Auftrag.
Viertens: Nicht nur, dass die Zusammensetzung der Runde von inhaltlicher Eindimensionalität geprägt ist: Auch die Moderation stellt kein Gegengewicht dar. Die Veröffentlichung der Tweets ohne redaktionelle „Einordnung“ lässt letztlich die Leser mit der Meinung der jeweiligen Journalisten allein. Das wäre vertretbar – wenn auch entsprechende Gegenmeinungen von anderen Journalisten veröffentlicht würden. Indem das aber nicht erfolgt und die Redaktion selbst auch nicht kritisch perspektiviert, stehen die Aussagen für sich – und zwar mit einem enormen Gewicht, symbolisch maximal aufgeladen durch die Reputation und Stellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Fünftens: Die Auswahl der Gäste samt der entsprechenden Rahmung bzw. Moderation der Sendung zeigt, dass die Redaktion ihrer Aufgabe und dem Thema nicht gewachsen ist. Somit findet sich erneut ein ÖRR-Beitrag, in dem die notwendige Grundsatzkritik fehlt. Würde es sich um einen Beitrag dieser Art handeln, ließe sich darüber hinwegsehen. Aber: Auf diese Weise angelagerte Beiträge finden sich zuhauf und reihen sich nahtlos aneinander – nicht nur im ÖRR, sondern in vielen großen Medien. Das führt zu einer schweren Schieflage in der journalistischen Darstellung der Realität.
Titelbild: Screenshot ARD