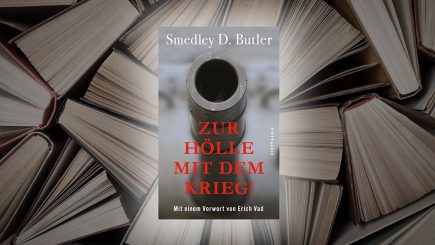Das berühmte und immer noch weithin unbekannte Pamphlet des US-Generals Smedley Butler erscheint endlich in einer qualifizierten deutschen Übersetzung des Verlags Fiftyfifty. „War is a Racket“ erschien 1935; eine deutsche Übersetzung des kurzen Texts war inklusive des englischen Originals in einer Art Raubdruck von 2019 verfügbar. Eine Rezension von Christian Deppe.
Der deutsche Titel – im Original sind es die letzten Worte des Texts – ist der Bannfluch des hochdekorierten Generals, der am Ende seiner Laufbahn zu der Erkenntnis kam, dass er Tausende Soldaten für das US-Kapital in den Tod geschickt hat. 1881 geboren, ging Butler mit 17 Jahren zur Armee und gewann seine Ränge und Auszeichnungen in den US-Kriegen in der Karibik, in Mittelamerika und in Asien. 1930 nahm er seinen Abschied, als ihm bei der Berufung auf das Oberkommando des Marine Corps ein anderer General vorgezogen wurde.
Biographisches streift Butler nur in einer kurzen Bemerkung: „Für viele Jahre hatte ich als Soldat den Verdacht, dass der Krieg Unfug ist; erst als ich mich ins Zivilleben zurückzog, wurde mir das voll bewusst.“ (S. 14 unten). Von den Motiven und Wandlungen Butlers wüsste man gerne mehr.
Kann man über ein Buch gegen den Krieg, ein auf den Frieden gerichtetes Buch, neutral sprechen? Nein, nicht in dieser Zeit, nicht in diesem Land und ohnehin nicht, geht es doch um Leben und Tod, um den Zustand und den Wohlstand der Gesellschaft und direkt um die Frage: Was tun? Was tun gegen die Treiber und Betreiber von Rüstung und Krieg?
Die Bedeutung des englischen „racket“ changiert zwischen Schwindel, Betrug, Gaunerei, kriminelle Bande, Schläger und Geschäftemacherei. In dieser Mehrdeutigkeit ist das Wort nicht bündig ins Deutsche übersetzbar; „Unfug“ ist die harmloseste Fassung. Die praktischen Vorschläge Butlers zur Zerschlagung des „racket“ im vierten Kapitel spiegeln die Bedeutungen und münden in den Aufruf zur Beendigung aller Kriege: „Zur Hölle mit dem Krieg.“ Der Titel ist gut gewählt, nicht nur wegen der Schwierigkeiten von „racket“.
Ein General wird zum Pazifisten? Wie kommt das? Krieg ist nichts als eine Gaunerei, ein einträgliches Geschäft, so die Erkenntnis Butlers. Es sind die Völker, die kämpfen und sterben; es sterben nicht die, die den Krieg anzetteln und den Profit einstreichen. Das durch Kriege gewonnene Land wird von den wenigen ausgebeutet, die schon aus dem Krieg Profit zogen. Bis 1898, so Butler, besaßen die USA kein Territorium außerhalb des US-Festlands. Dann begannen die Kriege, und die Schulden der USA wuchsen um ein Vielfaches. Das ist aktuell: Die USA vollziehen an sich selbst, was seinerzeit gegenüber der Sowjetunion Erfolg hatte: Sie rüsten sich in den Ruin.
Liegt die Profitrate der Konsum- und der Investitionsgüterindustrie bei um die zehn Prozent, so explodiert sie in der Rüstungsindustrie: „Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt“, so Butler, 20, 100, 300 und 1.800 Prozent sind möglich. Butler führt die Bilanzen einiger Konzerne (Du Pont, Anaconda) und die Praktiken einiger Branchen an (die an die jüngsten Skandale der Beschaffung von Masken und Impfstoffen erinnern). Die Banken aber schöpfen den Rahm ab. Wie sie das machen, blieb trotz Untersuchung durch den Senat geheim. Dessen Empfehlungen sollen die Kriegsprofite verringern – nicht aber die Verluste von Menschenleben. Rüstungsgüter saugen der Gesellschaft die für ihren Erhalt und ihre Entwicklung notwendigen Mittel ab. Anders als Investitions- und Konsumgüter sind sie präemptiver Schrott, dead end, und bringen den Tod.
Den Profit der Industrie und der Banken bezahlen wir alle, durch Steuern und Anleihen, die von den Banken manipuliert werden. Die Soldaten zahlen mit ihrem Leben. Butler fordert dazu auf, die Soldatenfriedhöfe in den Ländern zu besuchen, in denen die USA Krieg geführt haben, und in die Hospitäler zu gehen, in denen die Verstümmelten und Traumatisierten, „50.000 zerstörte Menschen“, „lebende Tote“, aus der Öffentlichkeit herausgehalten werden, in Kasernen eingesperrt. Das ruft die Fotos der Verstümmelten des Ersten Weltkriegs in Ernst Friedrichs „Krieg dem Kriege“ in Erinnerung. Die zerstörten Menschen gehörten zu den „Besten“, wurden auf Krieg programmiert, abgerichtet und dann aus der Kriegsmaschinerie ausgespuckt: „Physisch sind sie in guter Verfassung, mental sind sie gestorben.“ Später bekam das einen Namen und eine Abkürzung: „PTBS“ – Posttraumatische Belastungsstörung. Die Soldaten bezahlen damit „ihren Teil der Kriegsgewinne“.
Bis zum Spanisch-Amerikanischen Krieg 1898 kämpften Soldaten für Geld, dann wurden Medaillen und Propaganda als Lockmittel eingesetzt: Krieg ist doch ein Abenteuer, der liebe Gott und das Vaterland wollen ihn.
Butlers Erkenntnisse zielen auf praktisches Handeln: Abrüstungskonferenzen und Friedensverhandlungen beseitigen nicht das Kriegsmotiv, den Profit. Es gibt nur eine Abrüstung, und das ist die Verschrottung allen Kriegsgeräts und das Verbot der Erforschung immer grausamerer Waffen, damals wie heute tödlicher Chemikalien und Gase. Das geht nur so: Die Profiteure des Krieges sollen nicht mehr als das Einkommen erhalten, „das dem Soldaten im Schützengraben gezahlt wird“. Kapital und Arbeiterschaft sollen darüber nachdenken, und „man wird sehen, es wird keinen Krieg geben“. Um die Gaunerei der Kriegswirtschaft zu beenden, braucht es eine beschränkte Volksbefragung, die Abstimmung über einen Kriegseintritt allein durch die Betroffenen, die „zum Kämpfen und Sterben gerufen würden“, also nicht der alten Männer (und, inzwischen, Frauen). Eine weitere Maßnahme sei, so Butler, die strikte Beschränkung des Militärs und seiner Waffen auf die Verteidigung des eigenen Territoriums.
„Zur Hölle mit dem Krieg“ ist die Aufforderung, sich dem kriegslüsternen Kapital und seinen Helfershelfern in Politik und Medien entgegenzustellen. Drei Schritte, so Butler, sind erforderlich, um den Kriegsschwindel, die Geschäftemacherei am Tod, zu beenden. Butlers Vorschläge, wie lassen sie sich unter den Bedingungen der Gegenwart realisieren? Wie kann der Profit aus der Rüstung genommen werden? Wie kann die Jugend ermächtigt werden, über Krieg oder Frieden zu entscheiden? Wie wird das Militär auf die Heimatverteidigung und auf geringe Reichweiten der Flugzeuge und Schiffe beschränkt („home defense purposes“)?
Der Kriegseintritt der USA in den Ersten Weltkrieg wurde von den europäischen Alliierten erpresst, so Butler: Die Alliierten seien dabei, den Krieg zu verlieren, so argumentierten die Alliierten, und damit wären die Kredite der USA an England, Frankreich und Italien verloren; also müssen die USA an der Seite der Alliierten in den Krieg eintreten, damit ihre Kredite und die Alliierten gerettet werden. Das klingt zeitgenössisch.
„Mit dem Frieden mehr Geld verdienen als mit dem Krieg“ – mit dieser ebenso überraschenden wie illusorischen Perspektive mündet der Text in den nicht überraschenden, abrupten Ausruf der letzten Zeile: „Also … ich sage: Zur Hölle mit dem Krieg!“ Butler meint offenbar, durch Umwidmung von Forschung und Wissenschaft für friedliche Zwecke Wohlstand für alle erreichen und das Kapital zur Mäßigung durch Gemeinwohlorientierung bewegen zu können. Er vermittelt den Eindruck, als habe er sich mit dem anhaltenden Problem der „unnatürlichen Profitrate“ (Wolfram Elsner) nicht weiter befassen wollen.
Erich Vad, ehemals militärpolitischer Berater von Kanzlerin Merkel, hat ein Vorwort beigesteuert. Dem Erfahrungsgehalt, der Prägnanz und dem Zorn Butlers wird Vad nicht gerecht, wenn er sich für „militärische Stärke“ (S. 11) stark macht.
Über Krieg oder Frieden sollen allein die vom Militärdienst Betroffenen abstimmen. Damit die Jugend dazu befähigt wird, gehört das Buch in deren Hand, also in die Bibliotheken der Schulen und in den Unterricht, also in den Lesekanon der Fächer Geschichte und Politik. Patenschaften für Buchspenden an die Schulen und andere Institutionen, auch solche der Bundeswehr, können das befördern.