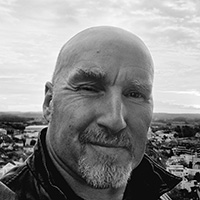„Soll man das Wort ‚kriegstüchtig‘ verwenden?“, fragt die taz in einem aktuellen Beitrag. Wer den Medienmainstream kennt, weiß: „Journalistische“ Fragen sind zum Legitimationsinstrument der vorherrschenden Politik verkommen. Die „pfiffige“ Antwort, die das „linke“ Blatt gibt, lautet: ja. Dummerweise ist das die falsche Antwort. Ein Kommentar von Marcus Klöckner.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
„Soll man das Wort kriegstüchtig verwenden?“, fragt Peter Unfried in der taz – die längst auch FAZ heißen könnte – befreit von Ironie oder einem herrschaftskritischen Unterton. „Kriegstüchtig“, so meint Unfried, „sagt unverbrämt, worum es geht und was Sache ist, nämlich mit zeitgemäß ausgebildeten Soldaten und Waffen einen militärischen Angriff tatsächlich abwehren zu können, also einen Krieg führen zu können.“
Ach so?! Gut, dass ein Redakteur das mal so klar sagt – denkt man sich vielleicht in der Redaktion. Doch an dieser Antwort ist weder etwas gut noch klar. Wobei: Diejenigen, die das politische Großunternehmen „Kriegstüchtigkeit“ forcieren wollen, dürften den Zeilen mit Applaus begegnen. Aber Applaus von Roderich „Der Krieg muss nach Moskau getragen werden“ Kiesewetter – will man das als Journalist? Ansonsten gilt: Aufgabe von Journalisten ist es, Propaganda zu dekonstruieren. Das gilt auch für die Propaganda des militärisch-industriellen Komplexes. Die Untermauerung von Propaganda hingegen – insbesondere Kriegspropaganda – gehört ausdrücklich nicht zum Aufgabengebiet von Journalisten.
Der taz-Kolumnist dürfte diesen Erkenntnissen sicherlich zustimmen. Der taz-Artikel versteht sich aber selbstredend natürlich nicht als Zement zur Untermauerung von Propaganda. Vielmehr ist der Anspruch zu vernehmen, aufzuklären und die Realität nüchtern zu erfassen. Die verwendeten Signalwörter „Putin“, „Angriffskrieg“, „Zeitenbruch“ taugen als Koordinaten für den Grundkurs des Beitrags. Dass Unfried den Grünen-Bundestagsabgeordneten Toni Hofreiter, der mit zu den Hardlinern der deutschen Russlandpolitik gehört, lobend als „sich militärisch weiterbildend“ wahrnimmt, passt da gut ins Bild.
Mit „Soll man das Wort ‚kriegstüchtig‘ verwenden?“ veröffentlicht die taz einen tragisch-komischen Kolumnenbeitrag. Der Niedergang des kritischen Journalismus ist greifbar.
Wann hat die CIA angefangen, in der Ukraine zu agieren? Und: Warum? Was ist nochmal auf dem Maidan passiert? Wie sieht die Tiefenpolitik der USA aus? Welche geostrategischen Interessen hat die NATO in der Ukraine? Warum sollte Russland die NATO angreifen? Vor allem auch: Wie sollte so ein Krieg rein praktisch im Hinblick auf einen für Russland positiven Ausgang ablaufen? Reden wir zudem von dem Russland, das seit über drei Jahren in der Ukraine kämpft?
An jeder einzelnen dieser Fragen – wenn sie konsequent kritisch beantwortet werden – zerschellen die Prämissen des taz-Elaborats. Doch diese Fragen dringen erst gar nicht in die Sinnsphäre des Artikels ein. Die Propaganda des Westens ist geschluckt – ohne es zu merken. Aus dem Glauben an die „russische Gefahr“ ist längst in Stahlbeton gegossene Überzeugung geworden.
Die Antwort auf die Frage, ob der Begriff „kriegstüchtig“ verwendet werden soll, kann nur lauten: Nein! Dass kein Geringerer als Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels „Kriegstüchtigkeit“ beschwor, sollte eigentlich ein bis heute unüberhörbares Warnsignal sein. Unfried erwähnt den Gebrauch des Begriffs im Nazi-Reich nicht. Stattdessen redet er davon, dass Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erstmals „offensiv“ den Begriff benutzt habe „und damit einen Kulturwandel der Deutschen semantisch voranbringen will“.
„Kulturwandel“? „Semantisch voranbringen?“ Der Artikel ist hier nicht einmal mehr komisch, sondern nur noch tragisch.
Titelbild: Kastoluza / Shutterstock