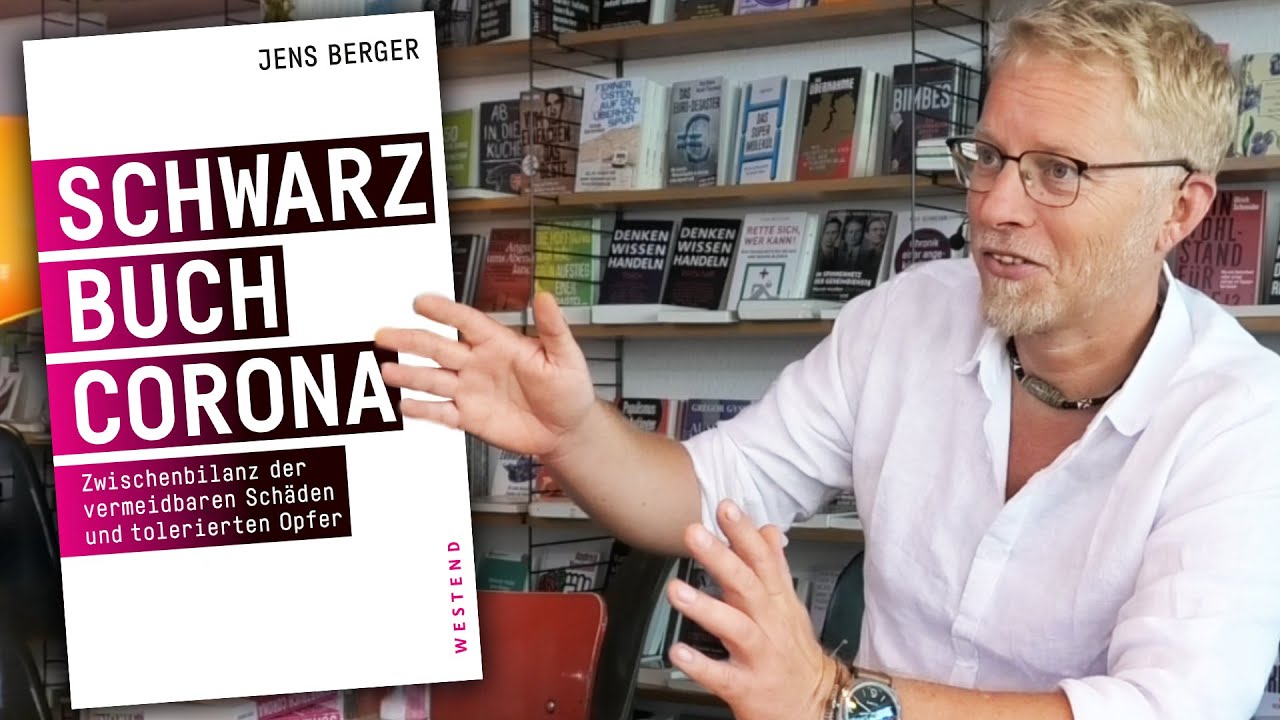Frauke Brosius-Gersdorf, ein Name, der zurzeit für viel Wirbel im politischen Berlin sorgt. Nun hat die Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht das Handtuch geworfen: Sie stehe für die Wahl als Richterin nicht mehr zur Verfügung. Von Alexander Neu.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Was war geschehen? Die Rechtswissenschaftlerin der Universität Potsdam wurde von der SPD-Fraktion als künftige Richterin am Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen.
Allerdings kam es nicht zu ihrer Wahl im Deutschen Bundestag, obschon zwischen den Spitzen der regierungstragenden Bundestagsfraktionen CDU/CSU und SPD Brosius-Gersdorf im Paket mit zwei anderen Kandidaten als zu wählende künftige Bundesverfassungsrichter festgelegt worden waren und der Wahlausschuss des Deutschen Bundestages das entsprechende Personaltableau dem Plenum des Bundestages empfahl.
Offiziell wurde sie wegen angeblicher Plagiate in ihrer Dissertationsschrift kritisiert. Tatsächlich jedoch wurde ihre Eignung angesichts gewisser rechtlicher Positionen von ihr in Frage gestellt, womit der Fall politisiert wurde. Die fehlende Unterstützung aus Teilen der Union und damit die Nichtwahl der Kandidatin führt zu einer dreifachen Krise:
Erstens kracht es im Gebälk der Koalition, weil die Union nicht wie zuvor mit der SPD vereinbart liefert.
Zweitens wird der Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn dafür kritisiert, er habe seine Fraktion nicht im Griff.
Und drittens, was etwas untergeht, droht eine Beschädigung der Reputation des Bundesverfassungsgerichts angesichts dieser fragwürdigen Politisierung einer Personalie, einmal von der Beschädigung der Kandidatin selbst abgesehen.
In dieser Diskussion um die Kandidatin tun sich auch Abgründe des Verfassungsverständnisses so mancher Zeitgenossen auf. In Medien und Politik wird der Unionsfraktionsvorsitzende für seine unzureichende Durchsetzungskraft in seiner Fraktion kritisiert. Kurzum, er sei nicht in der Lage, seine Fraktion bzw. die Abweichler zu disziplinieren. Offensichtlich haben genau diese Kritiker aus Politik und Medien sich nicht einmal die Mühe gemacht, das mit Verfassungsrang ausgestattete Wesen des freien Mandates zu verstehen. Das Wesen des freien Mandates ist in Artikel 38 Abs. (1) wie folgt beschrieben: „(…) Sie [die Abgeordneten] sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.“ Mit anderen Worten: Jeder Abgeordnete jeder Fraktion kann so abstimmen, wie es ihm sein Gewissen gebietet.
Dass das in der parlamentarischen Praxis in der Regel anders läuft, ist richtig und für das Funktionieren von Fraktionen wohl auch unumgänglich. Es offenbart sich ein Spannungsverhältnis zwischen dem verfassungsrechtlich garantierten freien Mandat und der praktischen Notwendigkeit, in Fraktionen möglichst geschlossen abzustimmen. Nur in Ausnahmesituationen, wie beispielsweise der Frage der Sterbehilfe, wird die Abstimmung „freigegeben“, wie es dann so großzügig heißt – also das verfassungsrechtliche abgesicherte freie Mandat wird in der politischen Praxis zur Ausnahme. Manchmal scheren auch Abgeordnete aus der als „Fraktionsdisziplin“ oder „Fraktionszwang“ bezeichneten realen Beschneidung des freien Mandates aus und hinterlegen beim Präsidium des Deutschen Bundestages eine „persönliche Erklärung“ für ihr abweichendes Verhalten. Nur sollten die Abweichler nicht allzu häufig vom Fraktionskurs abweichen, wenn sie bei der kommenden Listenaufstellung für die nächste Wahlperiode nicht abgestraft werden wollen. Die Abweichler der Unionsfraktion hinsichtlich der Personalie Brosius-Gersdorf bewegen sich also voll und ganz im Rahmen des Grundgesetzes – was mit Bezug auf ihre Kritiker aus Politik und Medien, die ein Durchgreifen Jens Spahns fordern, nicht unbedingt so attestiert werden kann, da sie das freie Mandat erstaunlicherweise nicht kennen oder es sogar in Frage stellen.
Horizontale und vertikale Gewaltenteilung
Aber mehr als die demonstrative Ignoranz hinsichtlich des Wesens der repräsentativ-parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik Deutschland muss erstaunen, dass der eigentliche Elefant im Raume nicht gesehen, nicht thematisiert oder gar problematisiert werden will:
Und der den Raum ausfüllende und somit unübersehbare Elefant schaut so aus:
Wie kann es sein, dass die Legislative (Bundestag und Bundesrat), formal abgesichert durch Artikel 94 Abs. (1) GG, und faktisch auch die Exekutive (Bundesregierung) das richterliche Personal des höchsten deutschen Gerichtes, des Bundesverfassungsgerichts, also der Judikativen, bestimmt – und das in einem politischen System, das die Errungenschaften der Gewaltenteilung so hoch hängt? Zumal mit Artikel 97 Abs. (1) GG die richterliche Unabhängigkeit Verfassungsrang erhält.
Lehren aus der Weimarer Republik
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland trat am 23. Mai 1949 in Kraft – ziemlich genau vier Jahre nach Beendigung der faschistischen Gewaltherrschaft in Deutschland. Die Schrecken des Nazi-Regimes bestimmten angesichts der kurzen Zeitspanne von vier Jahren nachvollziehbarerweise das Denken und Handeln der Verfassungsväter und -mütter in der Institution Parlamentarischer Rat.
Ermöglicht bzw. begünstigt haben die NS-Machtergreifung im Wesentlichen zwei Faktoren: erstens die lange Zeit von erzkonservativen Teilen der Gesellschaft nicht akzeptierte Demokratie und zweitens die unzureichenden verfassungsrechtlichen Absicherungen der Weimarer Verfassung gegen die Feinde der repräsentativ-parlamentarischen Demokratie. Diese spezifische gesellschaftliche Konstitution sowie die verfassungsrechtlichen Defizite erlaubten es den Nazis, die Weimarer Republik pseudolegal („Ermächtigungsgesetz“) zu Gunsten der NS-Diktatur abzuwickeln.
Und diese Erfahrungen haben die Ausarbeitung des Grundgesetzes durch den Parlamentarischen Rat wie ein roter Faden begleitet. Hierzu gehört auch, das Bundesverfassungsgericht der politischen Einflussnahme zu entziehen. Wie sollte dies strukturell gewährleistet werden können? Der Parlamentarische Rat entschied sich dazu, die personelle Zusammensetzung des Bundesverfassungsgerichts je zur Hälfte vom Bundestag und dem Bundesrat mit jeweils einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen wählen zu lassen. Mit diesem Ansatz wurde dem Prinzip der vertikalen Gewaltenteilung zwischen Bund und Ländern (Bundesrat) Rechnung getragen. Analog zur horizontalen Gewaltenteilung (Trennung von Exekutive, Judikative und Legislative) soll dies die Machtkonzentration einzelner Organe verhindern. Auch soll damit eine demokratische Legitimation für die Judikative abgesichert werden, da die Volksvertreter die Richter dieses höchsten judikativen Organs wählen. Hier stehen aber nun die horizontale Gewaltenteilung (Trennung der drei Gewalten) und die vertikale Gewaltenteilung (Bundestag und Bundesrat, beide legislative Kammern), die eine demokratische Legitimation der Richterwahl absichern soll, in einem Spannungsverhältnis. Der Parlamentarische Rat entschied sich dazu, das Spannungsverhältnis nicht zu Gunsten einer anderen strukturellen Lösung aufzuheben, sondern es zu akzeptieren.
Der Fall Brosius-Gersdorf
Durch den Skandal um die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf wird deutlich, dass die Wahl der Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht vielleicht doch parteipolitischer ist, als die Verfassungsväter und -mütter dies im Sinn gehabt hatten. Wenn sich also Bundestagsfraktionen, zumal regierungstragende Fraktionen, auf Kandidaten einigen, die Opposition jedoch leer ausgeht, kann dies einen etwas merkwürdigen Eindruck hinterlassen. Zwar greift die Politik nicht in die Urteilsfindung der Richter ein. Wenn aber Richter nach ihrer Rechtsüberzeugung und somit mehr oder minder auch politischen Gesinnung – und das stellt ja der Fall Brosius-Gersdorf anschaulich dar – gewählt oder abgelehnt werden, so ist die Befürchtung nicht gänzlich von der Hand zu weisen, dass die Fraktionen sich von „ihrem“ Kandidaten und dann gewählten Richter dann doch etwas erhoffen könnten. Interessant hierzu auch die Stellungnahme des Staatsrechtlers Rupert Scholz.
Wie auch immer: Der Skandal um die Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf schadet nicht nur dem Ansehen ihrer Person, sondern könnte auch dem Ansehen des höchsten deutschen Gerichts schaden. In ihrer Erklärung zu ihrem Rückzug äußert Brosius-Gersdorf unter anderem:
6. Lässt sich die Politik auch künftig von Kampagnen treiben, droht eine nachhaltige Beschädigung des Verfahrens der Bundesverfassungsrichterwahl. Die fachliche Kompetenz als zentrales Entscheidungskriterium darf nicht von öffentlichen Diskussionen über vermeintliche politische Richtungen oder angebliche persönliche Eigenschaften überlagert werden, zumal wenn diese ohne Tatsachenbezug erfolgen. In Zukunft sollte das Verfahren der Richterwahl mit mehr Verantwortungsbewusstsein praktiziert werden.
(Quelle: ZDF heute)
Diese Feststellung klingt für mich als ehemaligen Politiker, der acht Jahre im Deutschen Bundestag saß, etwas seltsam:
Politikern zu erklären, dass sie unpolitische (Personal-)Entscheidungen treffen sollen, ist etwa so, als ob man einem Formel-1-Fahrer auf der Piste erklärt, er möge nicht so schnell fahren.
Reform des Auswahlverfahrens?
Angesichts dieses Skandals sollte die Diskussion eröffnet werden, ob 76 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes eine Neubewertung des Auswahlverfahrens von Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht nicht doch überlegenswert ist, bei dem die Legislative und faktisch die Exekutive eben nicht das Personal der Judikativen – hier das Bundesverfassungsgericht – nach ihren Vorstellungen wählt. Es würde einerseits den Anspruch der horizontalen Gewaltenteilung stärken und andererseits auch die Kandidaten vor politisch motivierten Angriffen schützen.
Hinzu kommt: Der wachsende Wählerzuspruch für die AfD eröffnet ein Szenario, in dem die AfD perspektivisch über eine Sperrminorität verfügen, damit zur Wahl gestellte Kandidaten der anderen Fraktionen blockieren und diese Blockade als Verhandlungsgrundlage zur Wahl „eigener“ Kandidaten nutzen könnte. Eine dauerhafte Nichtneubesetzung des Bundesverfassungsgerichts käme einer Staatskrise gleich.
Welche alternativen Verfahren denkbar sind, müssten Experten eruieren. Eine Möglichkeit wäre, die 16 Bundesverfassungsrichter aus allen 16 Bundesländern zu bestimmen. Konkret: Jedes Bundesland entsendet einen Verfassungsrichter, wodurch auch der Ansatz der vertikalen Gewaltenteilung gewahrt werden würde.
Die Auswahl dürfte ebenfalls nicht durch politische Organe wie ein Landesparlament stattfinden. Stattdessen könnten amtierende Richter der jeweiligen Verfassungsgerichtsbarkeit, also Richter mit entsprechender Verfassungsrechtserfahrung, entsandt und ernannt werden. Weitere Verfahren sind denkbar, in denen Rechtswissenschaftler mit nachgewiesenem wissenschaftlichen Schwerpunkt „Verfassungsrecht“ bei der Auswahl auf Landesebene berücksichtigt werden könnten.
Titelbild: U. J. Alexander / Shutterstock