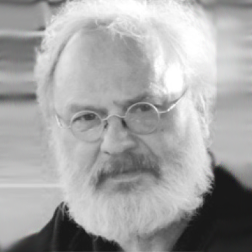Heute vor 80 Jahren, am 15. August 1945, herrschten vor allem in Korea unbeschreiblicher Jubel und überschwängliche Euphorie. Das japanische Kaiserreich hatte öffentlich seine Kapitulation bekannt gegeben, womit gleichzeitig die von Koreanern als tiefe Schmach empfundene Besatzung Tokios ein Ende fand. Von 1910 bis Mitte August 1945 war Korea japanische Kolonie und das in Ost- und Südostasien am meisten geschundene Objekt kolonialer Unterdrückung. Doch nur kurz währte die überbordende Freude: Die Siegermächte USA und Sowjetunion hatten eigene Pläne im Sinn, wie die Nachkriegsordnung auf der koreanischen Halbinsel aussehen sollte. Ein Rückblick unseres Ostasienexperten Rainer Werning.
Vermissen Sie das Ambiente des Kalten Krieges, gar vermintes Gelände, Stacheldrahtverhaue? Oder darf‘s grundsolides Mauerwerk sein? Dann gönnen Sie sich in Zeiten des Urlaubs, lang ersehnter Ferien und saurer Gurken einen Trip nach Korea. Vorzugsweise an den 38. Breitengrad, der die Halbinsel unschön säuberlich in zwei Hälften teilt – diesseits eine reale kapitalistische, jenseits eine (real-)sozialistische, beide in recht gut erhaltenem Zustand. Die südliche Hälfte der koreanischen Halbinsel, die Republik Korea (ROK), feiert just am heutigen Tage auch den 77. Jahrestag ihrer Gründung. Anlass also genug, die vergangenen Dekaden einmal kritisch Revue passieren zu lassen. Die koreanische Halbinsel ist überdies ein Hort, wo sich in krassen Systemunterschieden prämoderne, moderne und postmoderne Elemente verschränken, die, wenn von außen – in diesem Fall seitens der USA – immer wieder unter Druck gesetzt, eine dauerhafte Nord-Süd-Verständigung erschwer(t)en.
Kellerkind des 20. Jahrhunderts
Korea hatte binnen eines Jahrhunderts das unsägliche Pech, zunächst als koloniales Objekt übel zugerichtet und dann auch noch als postkoloniales Opfer buchstäblich (auf-)geteilt zu werden. Von 1910 bis 1945 währte die japanische Kolonialherrschaft, die sich durch ein brutales militaristisches Regime auszeichnete. Die Koreaner wurden gezwungen, ihre Namen zu japanisieren, und das öffentliche Sprechen von Koreanisch ward unter Strafe gestellt. Bei den XI. Olympischen Sommerspielen in Berlin hieß der überlegene Sieger des Marathonlaufs am 9. August 1936 Soh Kee Chung, ein Koreaner, der allerdings unter japanischer Flagge starten musste und als Goldmedaillengewinner „Kitei Son“ in die offiziellen Sportannalen einging. Massenhaft wurden Koreaner ins Reich des Tenno verschleppt, wo sie unter anderem unter kläglichen Bedingungen in der Rüstungs- und Werftindustrie sowie in Kohlegruben ihres kolonialen Zuchtmeisters schuften mussten. Ein Großteil der Opfer der Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki waren Koreaner. Doch es dauerte Jahre, bis ihrer überhaupt gedacht und ihnen zu Ehren ein (relativ verschämtes) Denkmal errichtet wurde.
Analogien, historische zumal, sind stets mit Vorsicht zu bilden. Doch man vergegenwärtige sich folgende Konstellation: Während Nazideutschland als Aggressor und Drahtzieher des Zweiten Weltkrieges nach dessen Ende und infolge der Konsequenzen dieses Vernichtungskrieges geteilt wurde, widerfuhr dieses Schicksal nicht etwa Japan, das sich als „Licht und Lenker Ostasiens“ aufgespielt hatte, sondern ausgerechnet Korea als japanischer Exkolonie. Mehr noch: Japan wurde nicht nur nicht als Aggressor mit einer Teilung „bestraft“; das Hirn und Herz des Militarismus, das Kaiserhaus, blieb unangetastet, und eine „Entnazifizierung“ à la Deutschland wurde dort allenfalls als low-intensity-learning buchstabiert – sprich: Nur wenige Offiziere der kaiserlichen Armee wurden als Kriegsverbrecher verurteilt und hingerichtet.
Entwürfe am Reißbrett und imperiale Kalküle
Die euphorische Aufbruchsstimmung in Korea war nach dem Ende des Krieges verständlich. Sie hatte nur einen Haken; die Koreaner machten ihre Rechnung ohne die Wirte. Denn noch vor Kriegsende hatten sich die beiden Siegermächte in der Region, die USA und die Sowjetunion, darauf verständigt, die koreanische Halbinsel nach dem Sieg über Japan zunächst – einen konkreten Fahrplan gab es nicht – treuhänderisch zu verwalten. Statt in Freiheit einen Neubeginn auf der gesamten Halbinsel in eigener Regie zu gestalten, diente der 38. Breitengrad als Trennlinie der Nachkriegsordnung. Das Gebiet nördlich davon wurde zur Einflusssphäre der Roten Armee deklariert, während im Süden US-Truppen unter dem Kommando von General Douglas MacArthur anlandeten und dem Land anstelle von Freiheit eine verhängnisvolle „Befriedung“ einbrockten. Die – wiewohl kurzlebige – Volksrepublik Korea lösten sie auf, die landesweit als Keimzellen eines demokratischen Neubeginns entstandenen Volkskomitees wurden im Süden verfolgt und zerschlagen. Und zu allem Überfluss wurde mit Rhee Syngman ein Erzkonservativer eigens aus dem US-amerikanischen Exil nach Südkorea ausgeflogen und dort mit US-Weihen zum ersten Präsidenten eines Landes gekürt, das sich am 15. August 1948 offiziell den Namen Republik Korea gab. Garniert wurde dieser „Regimewechsel“ damit, dass Rhee sich außer auf US-Bajonette auch noch auf den aus der japanischen Kolonialära nahtlos herübergeretteten und intakt gebliebenen Polizei- und Geheimdienstapparat stützen konnte.
Als sei das aus koreanischer Perspektive nicht schon tragisch genug, musste vor allem die Art und Weise verblüffen, wie es überhaupt zur Bestimmung des 38. Breitengrads als Demarkationslinie zwischen Nord und Süd kam. Gezogen wurde sie von den beiden amerikanischen Obersten Dean Rusk und Charles „Tic“ H. Bonesteel III., die seinerzeit im Team von George C. Marshall, dem Generalstabschef des Heeres, dienten. Ihnen oblag die Aufgabe, mit Blick auf Korea, das von den Alliierten „auf unbestimmte Zeit treuhänderisch“ verwaltet werden sollte, schnellstmöglich eine Trennlinie für die amerikanischen und sowjetischen Besatzungszonen zu ziehen. Sie verwendeten dabei eine Karte von National Geographic und wählten den 38. Breitengrad, weil er die koreanische Halbinsel ungefähr in zwei Hälften teilte. Die Eile war geboten, weil man in Washington befürchtete, die Rote Armee könnte die gesamte Halbinsel besetzen. US-Truppen befanden sich zu der Zeit nämlich noch knapp 1.000 Kilometer entfernt auf Okinawa und betraten erst Anfang September 1945 koreanischen Boden.
Der spätere US-Außenminister Dean Rusk erinnerte sich in seinen 1990 erschienenen Memoiren „As I Saw It” an diese Erfahrung:
„Während einer Sitzung am 14. August 1945, dem Tag der japanischen Kapitulation, zogen sich [Bonesteel] und ich spät in der Nacht in einen Nebenraum zurück und studierten intensiv eine Karte der koreanischen Halbinsel. Unter immensem Zeitdruck standen wir vor einer gewaltigen Aufgabe: Wir mussten eine Zone für die amerikanische Besatzung auswählen. Weder Tic (der langjährige Spitzname von Bonesteel seit den Tagen seiner Ausbildung in der US-Militärakademie West Point – Anm. RW) noch ich waren Korea-Experten, aber es schien uns, dass Seoul, die Hauptstadt, im amerikanischen Sektor liegen sollte. Wir wussten auch, dass die US-Armee eine ausgedehnte Besatzungszone ablehnte. Anhand einer Karte von National Geographic suchten wir nördlich von Seoul nach einer geeigneten Trennlinie, konnten jedoch keine natürliche geografische Grenze finden. Stattdessen sahen wir den 38. Breitengrad und beschlossen, diesen vorzuschlagen … [Unsere Kommandeure] akzeptierten ihn ohne große Diskussionen, und überraschenderweise taten dies auch die Sowjets.“ (Übersetzung: RW)
Es sei hier lediglich noch angemerkt, dass kein Koreaner in diesen Entscheidungsprozess einbezogen ward!
Heiße Phase des Kalten Krieges
Nördlich des 38. Breitengrads nutzte derweil die Sowjetunion ihren Einfluss, um die Volkskomitees agieren zu lassen, die antijapanische Partisanengruppe um Kim Il-Sung politisch aufzuwerten und ihr zur Macht zu verhelfen. Zugute kam Kim Il-Sung dabei eine bereits 1946 eingeleitete Agrarreform, was ihm in der Bevölkerung große Sympathien eintrug. Gut drei Wochen nach der Staatsgründung im Süden wurde am 9. September 1948 die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) ausgerufen. Während wenig später die letzten Kontingente der Roten Armee das Land verließen, stützte sich Rhee im Süden immer mehr auf die USA, die dort seitdem ununterbrochen mit Truppen präsent sind, deren Stärke heute 28.500 GIs beträgt.
Durch eine von außen tatkräftig geschürte politische Entfremdung auf der koreanischen Halbinsel und die Gründung der Volksrepublik China im Oktober 1949 geriet der 38. Breitengrad unfreiwillig zur Demarkationslinie einer eskalierenden West-Ost-Blockkonfrontation – mit verheerenden Konsequenzen: Ausgerechnet Korea lieferte von Juni 1950 bis Juli 1953 das Schlachtfeld des größten Gemetzels nach dem Zweiten Weltkrieg, ein Bruderkrieg, der durch den Einsatz der USA, UN-Truppen und sogenannter chinesischer Freiwilligenverbände internationalisiert wurde. Die Welt geriet erneut an den Abgrund, als General MacArthur damit drohte, durch „Pulverisierung“ – sprich: atomare Verwüstung – grenznaher chinesischer Städte den Krieg abzukürzen. Zur Kriegshinterlassenschaft zählt nicht nur eine Generation schwer traumatisierter Menschen in Nord und Süd, sondern auch ein am 27. Juli 1953 unterzeichnetes Waffenstillstandsabkommen, das bis heute nicht in einen Friedensvertrag überführt wurde! Südkoreas Präsident Rhee hatte dieses Abkommen nicht einmal unterzeichnet, weil er den Krieg fortsetzen wollte. Derweil hockten im fernen Deutschland, zumindest in dessen Westteil, Eltern an Kinderbettchen und summten ihre Herzallerliebsten mit dem makabren Reim in den Schlaf:
„Ei, ei, ei Korea, der Krieg rückt immer näher. Und rückt der Krieg nicht näher, so bleibt er in Korea.“
Unterschiedliche Entwicklungswege
Lange bevor Wirtschafts- und Politikwissenschaftler ab zirka Mitte der Siebzigerjahre wegen seiner makroökonomischen Erfolge das „Modell Südkorea“ überschwänglich priesen, übte die Volksrepublik mit ihrem staatlich verordneten Kurs des Dschutsche (Vertrauen in die eigene Kraft) als Konzept autozentrierter Entwicklung beträchtliche Faszination in vielen seit 1960 unabhängig gewordenen Ländern des Trikonts aus. Und während sich der Norden aus den sino-sowjetischen Debatten um die ideologische Vorherrschaft in der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung heraushielt, dafür als „zentristisch“ gescholten wurde, im Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe lediglich einen Beobachterstatus innehatte und sich vis-à-vis Moskau und Beijing in Äquidistanz übte, verordneten Südkoreas Militärmachthaber, gestützt auf US-Bajonette und massive Wirtschafts-, Finanz- und Militärhilfe aus Washington, dem Land einen brachialen Kapitalismus. Der holte im Zeitraffer jene Entwicklung nach, für die Länder in Europa einige Jahrhunderte brauchten.
Frontstaat Südkorea
Wurde Südkorea bereits vor Jahren nach Japan als zweites asiatisches Land in den erlauchten Klub der in Paris ansässigen Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aufgenommen, wurde Nordkorea seit Mitte der Neunzigerjahre von verheerenden Dürre- und Flutkatastrophen heimgesucht und seine Bevölkerung durch Hungersnöte gebeutelt. Präsentiert sich die südliche Hauptstadt Seoul als kosmopolitische Metropole und lärmender Moloch mit glitzernden Glas- und Betonfassaden, fühlt man sich in der nördlichen Hauptstadt Pjöngjang an die VR China zu Zeiten der Großen Proletarischen Kulturrevolution erinnert – inklusive häufiger Massenauftritte und mit martialisch-pathetischer Marschmusik begleiteten Arbeitseinsätzen von Soldaten und Zivilisten.
Wähnt sich die Zivilregierung in Seoul als aufgeklärt, demokratisch und offen für die Herausforderungen der Globalisierung, so zieht dennoch die geheimniskrämerische koreanische CIA, die sich beschönigend Nationale Behörde für Sicherheitsplanung (ANSP) nennt, hinter den Kulissen die Strippen. Pikanterweise stützt sich die ANSP auf das archaische Nationale Sicherheitsgesetz, das, wenngleich zigmal modifiziert, seit der Staatsgründung im Jahre 1948 zum juristischen Regelwerk der Republik gehört und mit dem die Behörden sowohl „Propaganda für Nordkorea und den Kommunismus“ ahnden als auch Besuche in die Volksrepublik streng reglementieren und Zuwiderhandlungen teils drakonisch bestrafen. Nordkorea bekennt sich indes offiziell nach wie vor zum „Sozialismus eigener Prägung“.
Sichtbares Relikt des entlang des 38. Breitengrades noch immer virulenten Kalten Krieges ist die „Koreanische Mauer“, ein militärisch hermetisch abgeriegeltes Terrain, das in etwa vier Kilometern Breite und 240 Kilometern Länge den Norden und Süden Koreas voneinander abschottet. Dieses Areal nennt sich „demilitarisierte Zone“ – kurz: DMZ, ein Begriff, der vernagelten Hirnen von Kommissköpfen entstammt –, das Washington seit Ende Januar 2002 als notwendigen „Schutzwall“ gegen die „Achse des Bösen“ erachtet, zu der neben Irak und Iran eben auch die Volksrepublik zählt. Diese Begriffe werden bis heute verwendet, wiewohl dieser Vorwurf mal mehr und mal weniger schrill erklingt. Anstatt einen innerkoreanischen Annäherungsprozess zu befördern, unternimmt Washington bis dato alles, um im Rahmen des neuerlich gestärkten militärischen Dreierbündnisses USA-Japan-Südkorea die DVRK zu provozieren und ihre politische Führung zu destabilisieren. Je geringer eine externe Einmischung ist, umso größer wären die Chancen, dass sich auf der Halbinsel wenn schon absehbar keine (Wieder-)Vereinigung, so doch zumindest ein geregelter, friedlicher Modus Vivendi einstellte.
Anachronistisch, doch in Washington als zeitgemäß erachtet
70 Jahre nach dem Ende des Koreakrieges herrscht auf der Halbinsel ein fragiler Frieden mit dem längsten Waffenstillstand aller Zeiten! Während sowjetische Soldaten bereits Ende der 1940er-Jahre die Region verließen, sind bis zum heutigen Tage noch immer US-amerikanische Soldaten in Südkorea stationiert – zurzeit 28.500 Mann. Camp Humphreys, offiziell bekannt als United States Army Garrison Humphreys (USAG-H), ist die größte US-Militärbasis im Ausland und befindet sich in Pyeongtaek, circa 65 Kilometer südlich der Metropole Seoul entfernt. Sie dient als Hauptquartier für die 8. US-Armee, die 2. Infanteriedivision, und ist das Zentrum aller US-Streitkräfte im Land.
Camp Humphreys operiert mit weltweit einzigartiger Kommandostruktur, die es einem US-amerikanischen Vier-Sterne-General im Ernstfall erlaubte, auch Befehlshaber über südkoreanische Verbände zu sein. Das am 7. November 1978 eingerichtete ROK/U.S. Combined Forces Command (CFC) ist das Hauptquartier für eine etwaige Kriegführung gegen die DVRK. Um diese Aufgabe zu erfüllen, hat das CFC die operative Kontrolle über mehr als 600.000 aktive Militärangehörige aller Streitkräfte beider Länder. In Kriegszeiten könnte die Verstärkung etwa 3,5 Millionen ROK-Reservisten sowie zusätzliche US-Streitkräfte umfassen, die von außerhalb der ROK eingesetzt würden.
Das CFC steht unter dem Kommando eines Vier-Sterne-US-Generals – seit dem 20. Dezember 2024 ist das General Xavier T. Brunson, in Personalunion Befehlshaber der Vereinten Nationen, des CFC sowie der United States Forces Korea (UNC/CFC/USFK) – mit einem Vier-Sterne-General der koreanischen Armee als stellvertretendem Kommandeur. In der gesamten Kommandostruktur gilt die binationale Besetzung: Ist der Leiter einer Stabsabteilung ein Koreaner, so ist sein Stellvertreter ein Amerikaner und umgekehrt.
Die wichtigste Feldübung war lange Zeit die Team-Spirit-Serie, die 1976 begann und mitunter fast 200.000 koreanische und US-amerikanische Soldaten umfasste. Getrennte Gefechtsstandübungen der ROK und der USA wurden 1976 als Ulchi Focus Lens (UFL) zusammengefasst. Seit Dezember 2006 änderte sich der Name, sodass die gemeinsamen Manöver nunmehr unter dem Namen Ulchi Freedom Guardian (UFG) firmieren. Dabei handelt es sich um eine jährliche gemeinsame und kombinierte, simulationsgestützte Gefechtsstandübung mit Hilfe modernster Wargaming-Computersimulationen und unterstützender Infrastrukturen.
All das wird beschönigend im Namen von „Bündnistreue“, der „Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit in der Region“ sowie als „Abschreckung nordkoreanischer Abenteuer“ regelmäßig in Szene gesetzt. Kein Wunder, dass sich die politische Führung in Pjöngjang nicht tatenlos zurücklehnte, sondern im systemimmanenten Sinne einer eigenen Überlebensstrategie die Option favorisierte, zur neunten atomaren Macht aufzusteigen. Dort ist die – milde formuliert – erratische Politik eines Donald Trump unvergessen, der noch im Herbst 2017 während seiner ersten Amtszeit der DVRK mit „Vernichtung“ drohte, um gut ein halbes Jahr später in trautem Beisein mit Nordkoreas Staatschef Kim Jong-Un den 38. Breitengrad symbolisch zu überqueren.
Weiterführende Lektüre & Links
- Dean Rusk as Told to Richard Rusk (1990): As I Saw it. New York City: W. W. Norton
- Michael Fry (2013): nationalgeographic.com/science/article/130805-korean-war-dmz-armistice-38-parallel-geography
- usfk.mil/About/CFC/
- Commander UNC/CFC/USFK > United States Forces Korea: usfk.mil/About/Leadership/Article-View/Article/1685489/commander-unccfcusfk/
- Statement of General Xavier T. Brunson – Commander, United Nations Command, Commander, United States-Republic of Korea Combined Forces Command, Commander, United States Forces Korea – before the 119th Congress, House Armed Service Committee, 9 April 2025: armedservices.house.gov/uploadedfiles/fy26_usfk_posture_statement_final_-_hasc_9_apr_25.pdf
- defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/4152129/top-general-says-north-korea-continuing-weapons-development-becoming-more-isola/
- Du-Yul Song/Rainer Werning (2012): Korea: Von der Kolonie zum geteilten Land. Wien: Promedia Verlag
Titelbild: Mehaniq/shutterstock.com