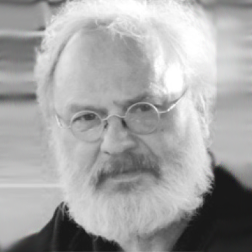„Nur in den Philippinen“ ist eine seit Langem gebräuchliche Redewendung, die auf unterschiedliche Weise gelesen werden kann – als Ausdruck des Stolzes auf Aktivitäten, Einstellungen und die reichen Schönheiten des Inselreichs, die Filipinos als einzigartig philippinisch empfinden, aber auch als Ausdruck von Frustration, Wut und Verzweiflung über Zustände und Situationen, die als zutiefst korrupt, schreiend ungerecht oder einfach nicht gut (genug) gelten. Irrtümlicherweise galt diese Redewendung als regierungsoffizieller, vom Tourismusministerium initiierter Slogan. Als solcher aber dienten in der Vergangenheit „WoW Philippines“, „It‘s More Fun in the Philippines“ und seit Sommer 2023 „Love the Philippines“. Wobei den Schöpfern dieser Slogans jeweils die Einzigartigkeit des Landes und seiner Menschen vorschwebte. Gesellschaftspolitisch zeichnet sich der Inselstaat tatsächlich durch markante Alleinstellungsmerkmale aus. Eine kleine Spurensuche von Rainer Werning.
Der südostasiatische Archipel, benannt nach einem Monarchen aus der Dynastie der Habsburger, König Philipp II. (1527 – 1598), war über drei Jahrhunderte lang Teil des weltumspannenden spanischen Imperiums und galt als dessen Kronjuwel in Fernost.
Als ihre einstige und einzige Kolonie in Asien (1898 – 1946) traten die USA nach siegreichen Kriegen gegen Spanien dessen Erbe an und verwandelten die Inselgruppe in ein „Sprungbrett” zur Beherrschung der „schier unermesslichen Märkte Chinas“. Ein imperialer Beutezug, den Washington beschönigend als Prozess „wohlwollender Assimilierung“ („benevolent assimilation“) bezeichnete. William McKinley, der damalige US-Präsident, sprach in diesem Zusammenhang von der notwendigen mission civilisatrice – „die Philippiner emporzuheben, zu zivilisieren und zu christianisieren“; schlicht vergessend, dass unter der Zuchtrute Spaniens das Land in die einzige römisch-katholische Hochburg in Südost- und Ostasien verwandelt worden war. Erst im Jahre 2002 avancierte die vormalige portugiesische Provinz Osttimor als just unabhängig gewordene Demokratische Republik Timor-Leste zum zweiten Land in der Region mit dominanter römisch-katholischer Bevölkerung.
Zeichnet sich der philippinische Katholizismus durch Ritenvielfalt und starr-konservative Weltanschauung aus, wo selbst Debatten über Abtreibung und Scheidung strikt tabuisiert blieben, entwickelten sich auf untersten Gemeindeebenen Strömungen, die als Initialzündung für das Aufkommen einer „Theologie des Kampfes“ wirkten. Es handelte sich hierbei um die radikalisierte Variante der in Lateinamerika entstandenen „Theologie der Befreiung“. In einem von Großgrundbesitz und Feudalstrukturen geprägten Hinterland waren es nicht selten die Söhne und Töchter der Begüterten, die ihr wohlbehütetes Zuhause aus Protest gegen allgegenwärtige Unterdrückung und Ausbeutung verließen und sich stattdessen für ein sozialpolitisches Engagement im politischen Untergrund entschieden. Darunter waren auch Söhne und Töchter, die ein bereits begonnenes Theologiestudium abbrachen oder ihrem zuvor gewählten Dasein als Priester oder Nonnen abrupt entsagten.
Seit 1902 existiert mit der Iglesia Filipina Independiente (IFI) eine Kirche, die sich in ihrer Theologie und Liturgie an eigenen Traditionen orientiert. Sie entstand in einer Umbruchphase, als man in dem überwiegend katholischen Land die kulturelle Unabhängigkeit von Spanien anstrebte und sich auch und gerade wegen kirchlicher Missstände von der spanisch dominierten römisch-katholischen Amtskirche zu distanzieren begann. Die IFI lehnt die Autorität des Papstes ebenso ab wie den Zölibat und ist im Kern ein Produkt antikolonialen Widerstandes, dessen exponierte Gestalten gleichzeitig führende Persönlichkeiten in der jungen, sich langsam landesweit formierenden Gewerkschaftsbewegung waren.
Als „kleine braune Brüder“ („little brown brothers“) hatte William Howard Taft, der erste US-Generalgouverneur der Philippinen (1901 – 1904), die Filipinos bezeichnet. Und das sind sie – keineswegs in rein paternalistischem oder rassistischem Sinne – geblieben. Zwischen den politischen Eliten dies- wie jenseits des Pazifiks entwickelte sich eine enge Sinnes- und Geistesverwandtschaft mit bizarrem Antikommunismus als verbindende Klammer. Das war so Mitte der 1950er-Jahre, als ausgerechnet in der philippinischen Metropole Manila mit der SEATO das östliche Pendant zur NATO aus der Taufe gehoben wurde. Das blieb so seit dem Machtantritt von Ferdinand Marcos Senior Mitte der 1960er-Jahre, als gegen alle/s Linke/n diverse Maßnahmen der „Counterinsurgency” („Aufstandsbekämpfung”) entfesselt wurden. Und bis zum heutigen Tage werden Kritiker und Gegner der Zentralregierung als „Kommunisten“, „Terroristen“ und „Subversive“ denunziert, politisch kaltgestellt oder außergerichtlich exekutiert.
Nirgendwo sonst ist die Existenz mächtiger familiärer Clans und politischer Dynastien so ausgeprägt und verankert, wie das in den Philippinen der Fall ist. Allein seit Mitte der 1960er-Jahre haben vier bedeutsame Familienclans – die Macapagals, Marcoses, Aquinos und Dutertes – jeweils zwei ihrer Mitglieder ins höchste Staatsamt beziehungsweise auf den Posten einer Vizepräsidentin zu hieven vermocht. Kein Wunder also, dass auf den Inseln das weltweit am engsten geflochtene Netz oligarchischer Strukturen im Kontext einer zählebigen „Elitendemokratie“ und Patronagepolitik zu konstatieren ist. Einmal mehr wurde dies eindrücklich durch die Ergebnisse der im Mai dieses Jahres durchgeführten Halbzeitwahlen unterstrichen.
Der Süden der Philippinen ist Schauplatz des längsten bewaffneten Konflikts in Südostasien. Die von den Spaniern abschätzig „Moros“ genannten Muslime widersetzten sich erfolgreich gegen kastilische Bevormundung. Und es bedurfte annähernd zweier Jahrzehnte, bis die neuen US-amerikanischen Kolonialherren aufgrund ihrer haushohen technologischen Überlegenheit in puncto Waffensysteme die „Moros“ in die Knie zwangen. Ein militärisches Wiederaufleben des sich mittlerweile selbst stolz so bezeichnenden Moro-Widerstandes seit Ende der 1960er-Jahre führte dazu, dass von Anfang bis Mitte der 1970er-Jahre ein offener Bürgerkrieg auf Mindanao und in der Sulusee tobte – mit etwa 150.000 Toten. Wenngleich dort seit wenigen Jahren Kampfhandlungen deeskalierten, ist längst nicht ausgemacht, ob ein dauerhafter Frieden in der Region Bestand hat.
Nirgends in der Region macht noch eine sozialrevolutionäre Widerstandsbewegung in Gestalt der Nationaldemokratischen Front der Philippinen (NDFP) samt einer kommunistischen Partei (CPP) und eigener Guerillaarmee (NPA) von sich reden. Seit der Jahreswende 1968/69, als sich die CPP und NPA formierten, herrscht in zahlreichen Landesteilen und in unterschiedlicher Intensität ein Auszehrungskrieg, den weder die NPA noch die Streitkräfte der Philippinen (AFP) militärisch zu gewinnen vermochten. Begleitet wurden die Kampfhandlungen immer wieder von Friedensverhandlungen in den Niederlanden, wo die NDFP ihr internationales Büro unterhält und ein Teil ihrer Führung im Exil oder unter der Ägide des norwegischen Außenministeriums in Oslo lebt – bis dato indes mit ungewissem Ausgang.
Die NDFP hatte in ihrer politischen Hochphase von 1980 bis zum Sturz von Marcos Senior im Frühjahr 1986 maßgeblichen Anteil an der Politisierung und Radikalisierung des öffentlichen Lebens. Sie war es auch, die den größten Blutzoll im Kampf gegen die Diktatur entrichtete. In der Zeit vom Sommer 1983 bis zum Frühjahr 1986 galt die NPA gemäß US-amerikanischen Geheimdienstberichten als „die weltweit am schnellsten wachsende Guerillabewegung“.
Das Blatt wendete sich dramatisch, als die CPP in den entscheidenden Momenten des Machtwechsels von Marcos zu Aquino für einen Boykott vorgezogener Wahlen votierte und Teile der Partei das finsterste Kapitel ihrer eigenen Geschichte aufschlugen. Nach dem Machtwechsel in Manila kam es wiederholt zu militärischen Rückschlägen von NPA-Einheiten im Kampf gegen AFP-Verbände. Verantwortliche politische Kader auf Mindanao und der Hauptinsel Luzon witterten „Verrat in den eigenen Reihen“ und inszenierten ein Kesseltreiben gegen Genossen, die sie auf einmal für „Spione“ der gegnerischen Seite hielten. Auf Mindanao nannte sich der als „parteiinterne Säuberung“ konzipierte Kurs kurz „Kampagne Knoblauch“. In deren Verlauf kamen über eintausend CPP-Mitglieder und Sympathisanten ums Leben, nachdem sie zuvor gefoltert, zu Denunziantentum gezwungen und/oder von ihnen fabrizierte „Geständnisse“ erpresst worden waren.
Wer hätte früher jemals zu glauben gewagt, dass genau 36 lange Jahre nach der Flucht der Marcoses und ihrer Entourage ins Hawaiier Exil der Sohn des vormaligen Diktators im Sommer 2022 als 17. Präsident der Republik der Philippinen erneut in den Malacañang-Palast zu Manila einzieht! Ein solch geschmeidiges politisches Comeback sucht seines- und ihresgleichen, wie denn auch der Machtwechsel in jenen politisch bewegten wie bewegenden Tagen im Monat Februar 1986 einzigartig war – halt „only in the Philippines“!
Der Marcos-Sturz – mal als „friedliche Wunderrevolution“, mal als „People-Power-Revolution“ oder gar als „Rosenkranz-Revolution“ weltweit überschwänglich gepriesen – war alles, nur eben keine Revolution. Es war dies die Kulisse des weltweit ersten bis in Details telegen ausgeleuchteten Machtwechsels in einem Land der sogenannten Dritten Welt, die sich vorzüglich dazu geeignet hatte, die Welt der Finsternis (Marcos) im Widerstreit mit der Welt des Lichts (seine Nachfolgerin „Cory“ Aquino) zu zeichnen. Hintergrund der Machtrochaden in Manila im Frühjahr 1986 war die Besorgnis der „Schutzmacht“ USA, die Philippinen könnten durch einen „unkontrollierten“ Machtwechsel auch den Fortbestand der dort größten außerhalb des nordamerikanischen Kontinents gelegenen Militärbasen, Subic Naval Base und Clark Air Field, gefährden.
Ausgerechnet nach der exotischen, wahrscheinlich aus Indien stammenden Sternfrucht – u.a. auch Carambola genannt und in den Philippinen als „balimbing“ bekannt – ist ein Typus von Politiker beschrieben, der sein Fähnchen in den Wind hängt und als Wendehals stets die Nähe zu den Trögen und Pfründen der jeweils Herrschenden sucht. Wer immer aus Wahlen als Sieger hervorgeht, kann versichert sein, dass ihm mit wehenden Fahnen all jene folgen, die gestern noch als deren Widersacher oder Gegner in Erscheinung getreten waren – „balimbing“ halt. In den Philippinen wird es wohl keinen politischen Analysten geben, der imstande wäre, die genaue Zahl von politischen Parteien zu nennen. Die erste Rückfrage würde wohl lauten: „Was meinen Sie – vor, während oder nach Wahlen?“ Parteien entsprechen auf dem Archipel bis heute klientelistischen Netzwerken mit dominanten Persönlichkeiten an der Spitze als programmatisch ausgerichteten politischen Organisationen oder Gruppierungen.
Prototyp eines „balimbing“ ist der Mitte Februar dieses Jahres 101 Jahre alt gewordene Juan Ponce Enrile – wie Marcos Sr. ein Mann aus dem Norden des Landes. Langjährig hatte er diesem als Minister – zuletzt als Chef des Verteidigungsressorts – gedient und war Marcos‘ Korsettstange während der offiziellen Kriegsrechtsära im Lande von September 1972 bis Januar 1981. Buchstäblich fünf Minuten vor Zwölf wandte sich Enrile von seinem Mentor und langjährigen Gönner ab und ging auf Marcos zu Distanz, als sich im Rahmen der im Februar 1986 weltweit viel beachteten „People-Power-Revolution“ das jähe Ende des Diktators abzeichnete. Der Mann gerierte sich danach als Heilsbringer und Volksheld, protegierte Putschversuche gegen die Marcos-Nachfolgerin Aquino und stieg vom Kongressabgeordneten zum Senatspräsidenten auf, um seit dem Machtantritt von Marcos Jr. ebendiesem als nunmehr juristischer Chefberater zu dienen!
Schließlich entbrannte in Manila seit Sommer 2024 ein veritabler Rosenkrieg Filipino Style! Das während des Präsidentschaftswahlkampfs 2022 in trauter Eintracht geformte und aus diesem als strahlendes Siegertandem hervorgegangene Marcos-Duterte-Team wurde sich spinnefeind und ist heute prioritär darauf bedacht, gegeneinander zu regieren. Diese tiefen Animositäten zwischen Präsident Marcos Jr. und seiner Vizepräsidentin Sarah Duterte, Tochter des seit Frühjahr dieses Jahres wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zu Den Haag inhaftierten Ex-Präsidenten Rodrigo R. Duterte (2016 – 2022), haben die Gesellschaft gespalten. Dutertes brutaler „Antidrogenkrieg“ soll bis zu 30.000 Todesopfer gefordert haben. Er ist das erste asiatische Ex-Staatsoberhaupt, das sich vor dem IStGH für seine Taten zu verantworten hat.
Als sei all das nicht schon schlimm genug, wird das Land seit August von Korruptionsskandalen gargantuesken Ausmaßes erschüttert. Es geht um die Veruntreuung öffentlicher Gelder in zweistelliger Milliardenhöhe seitens Kongressabgeordneter sowie Senatoren, die eigentlich für einen effektiven (Hochwasser-)Katastrophenschutz vorgesehen waren – und das in einem Land, das erst im just vorgelegten WeltRisikoIndex 2025 erneut als das weltweit katastrophenanfälligste eingestuft ist.
Über den Autor: Rainer Werning ist unter anderem gemeinsam mit Jörg Schwieger Herausgeber der beiden Bände: „Handbuch Philippinen – Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur“, das in sechster, aktualisierter und erweiterter Auflage 2019 im Berliner regiospectra Verlag erschienen ist, sowie des anlässlich der diesjährigen Frankfurter Buchmesse (15. – 19. Oktober) mit den Philippinen als Ehrengast vorgelegten Buches „Von Marcos zu Marcos: Die Philippinen seit 1965“, Wien: Promedia Verlag.