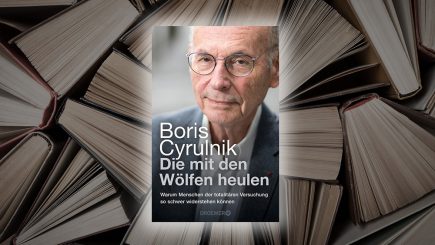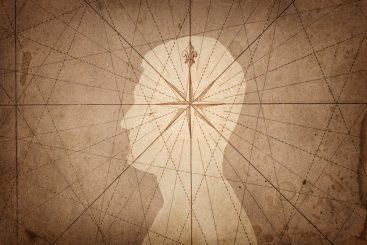Trumpverstehen für Anfänger

Einen Tag nach seiner „denkwürdigen“ Rede in Davos versuchen sich einige Experten in den Medien mal wieder mit der Exegese der Worte des mächtigsten Mannes Welt. Das ist sinnlos. Wer in Donald Trump einen klassischen Staatsmann sieht, dessen Worte man nach einem klassischen Maßstab interpretieren und bewerten kann, wird scheitern. Und wer eifrig nach einem Bruch in der Weltpolitik der USA sucht, wird ebenfalls scheitern. Was jedoch in der Tat grundsätzlich neu ist, ist die Art und Weise der Kommunikation. Eigentlich müsste man Trump sogar dankbar sein, zeigt er doch schnörkelloser und direkter als sein Vorgänger, wie sich die USA auf der Weltbühne sehen. Wir müssen jedoch lernen, ihn auch richtig zu verstehen – sonst kommen wir unter die Räder. Ein Kommentar von Jens Berger.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.