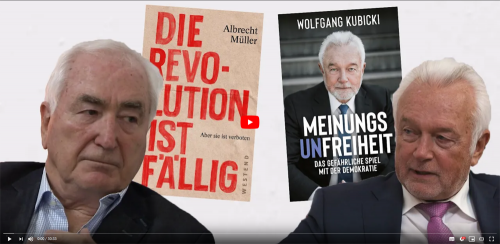Warum klassische Therapieansätze im Westjordanland versagen – und was palästinensische Fachkräfte dagegensetzen: Ein Gespräch mit der palästinensischen Sozialarbeiterin und psychologischen Beraterin Nisreen Bisharat, die in Nablus lebt und dort gemeinsam mit ihrem Mann das „Fanar Centre for Mental Health“ leitet. Sie sagt: „Wir behandeln nicht – wir begleiten.“ Von Detlef Koch.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Wie dieses Interview entstand – eine Notiz zur Zusammenarbeit mit Nisreen Bisharat
Dieses Interview ist das Ergebnis eines mehrwöchigen, schriftlich geführten Austauschs mit der palästinensischen Sozialarbeiterin und psychologischen Beraterin Nisreen Bisharat, die in Nablus lebt und dort gemeinsam mit ihrem Mann das Fanar Centre for Mental Health leitet. Was als journalistisches Gespräch über ihre Arbeit begann, wurde bald zu einer Zeugenschaft über eine Wirklichkeit, die sich jeder Routine entzieht.
Denn das Interview verlief nicht linear – sondern in Fragmenten. Immer wieder wurde es unterbrochen: durch nächtliche Razzien, durch Stromausfälle, durch Sirenen und Raketen. Manchmal blieben Nachrichten tagelang unbeantwortet. Ich wusste oft nicht, ob Nisreen etwas zugestoßen war, ob sie sich in Sicherheit befand oder einfach nur überfordert war von der Lage vor Ort – einer Realität, in der der Tod nie weit entfernt ist. Als ich ihr schrieb, ob alles in Ordnung sei, antwortete sie in einer stillen Nacht:
„Ich bin wach wegen der Raketen über dem Haus. Die Kinder haben Angst. Ich schreibe dir, weil sie jedes Mal Angst bekommen – und ich ihnen nicht mehr sagen kann, außer das, dass ich bei ihnen bin.“
So wurde das Interview selbst zu einer Art Begleitung. Kein klassisches Format, kein Frage-Antwort-Schema, sondern ein fortlaufender Austausch, getragen von gegenseitigem Respekt. Manchmal schrieb Nisreen mitten in der Nacht, manchmal erst nach Tagen. Immer aber waren ihre Worte klar, strukturiert und getragen von einer beeindruckenden Haltung: Standhaftigkeit, gepaart mit Sanftmut und Güte.
Besonders berührt hat mich die Episode rund um ihre Masterarbeit. Ursprünglich hätte Nisreen ihre Abschlussarbeit in Ramallah präsentieren sollen – aber wegen militärischer Straßensperren war die Universität unerreichbar. Also hielt sie die Verteidigung online ab. Trotz der widrigen Umstände wurde ihre Arbeit angenommen, sogar zur Publikation vorgeschlagen. Und dann geschah etwas, das sie selbst als Wunder bezeichnete: Ihre Kolleg:innen aus Gaza – selbst unter Beschuss und Entbehrung – schickten ihr einen Blumenstrauß nach Nablus. Nisreen schrieb mir dazu:
„Sie haben aus Gaza in einem Geschäft in Nablus angerufen und mir Rosen geschickt. Die Worte, die sie mir vor den Rosen schickten, haben mich berührt. Sie brauchten dringend ein Stück Brot und dachten trotzdem daran, mich glücklich zu machen … Ich schwöre, ich habe mir die Augen aus dem Kopf geweint. Dieser Moment hat mir gezeigt, dass es Menschen gibt, deren Herzen selbst unter den Trümmern leuchten!
Was gibt mir an solchen Tagen die meiste Kraft? Ich glaube, dass uns nichts brechen kann … Wir freuen uns und machen weiter, wir trauern und machen weiter. Ich sehe die Augen meiner Kinder und wünsche ihnen von ganzem Herzen ein besseres Leben. Und die Umarmung der Familie? Das ist wahre Geborgenheit … Es stärkt meinen Geist und gibt mir die Energie, weiterzumachen.“
Es ist diese Geste, die mehr sagt als jede Analyse. In einer Region, die unter Besatzung, Blockade und täglicher Gewalt leidet, ist menschliche Nähe keine Selbstverständlichkeit – sondern eine Form des Widerstands. Das Interview mit Nisreen ist daher kein bloßes Gespräch über psychologische Praxis. Es ist eine Erzählung über Würde inmitten des Ausnahmezustands. Und ein Zeugnis für die Kraft eines einfachen Satzes, den sie mir am Ende schrieb:
„Wir behandeln nicht – wir begleiten. Das ist nicht nur ein Konzept. Das ist unsere Art, Mensch zu bleiben.“
Die westliche Psychologie stößt an ihre Grenzen, wenn sie auf Realitäten trifft, die sie selbst nicht vorgesehen hat. Nicht nur in Gaza, auch im von Siedlerterror, Checkpoints und Militärgewalt geprägten Westjordanland zeigt sich: Hier geht es nicht um posttraumatische Belastungsstörungen, wie man sie aus klassischen Lehrbüchern kennt. Hier endet das Trauma nie. Was bedeutet psychologische Hilfe in einem Kontext, in dem Gewalt und Kontrollverlust nicht die Ausnahme, sondern die Norm sind?
Die palästinensische Sozialarbeiterin und psychologische Beraterin Nisreen Bisharat hat darauf eine klare Antwort: „Begleitung statt Behandlung“. Damit beschreibt sie eine psychosoziale Haltung, die sich nicht auf Diagnosen oder Standardinterventionen verlässt, sondern auf Präsenz, Beziehung, Würde. Der folgende Beitrag rekonstruiert diese Praxis anhand eines mehrwöchigen Gesprächsprotokolls – und macht deutlich, warum eine kritische Öffentlichkeit auch bei uns genauer hinsehen sollte.
Kontextvergessenheit als therapeutisches Grundproblem
Westliche Therapieschulen arbeiten oft mit dem impliziten Modell einer „Zeit danach“. Erst wenn das Trauma vorbei ist, kann die Verarbeitung beginnen – so die Annahme. Doch was, wenn die Gewalt nicht endet? Wenn die Bedrohung fortbesteht, das Trauma nicht abgeschlossen ist, sondern sich wieder und wieder in den Alltag einschreibt? Im Westjordanland, so Nisreen Bisharat, leben Menschen nicht „nach“ einem Trauma, sondern mit ihm. Der Ausnahmezustand ist zur Struktur geworden. Das hat nicht nur psychologische, sondern auch ethische Implikationen.
Die gängigen Methoden – Exposition, kognitive Umstrukturierung, symptomorientierte Interventionen – greifen hier oft ins Leere. Was wie eine depressive Störung wirkt, kann in Wahrheit eine angemessene Reaktion auf den Verlust grundlegender Sicherheit sein. Was wie pathologisch erhöhte Wachsamkeit (Hypervigilanz) oder Angststörung aussieht, ist mitunter ein rationaler Überlebensmodus. „Viele der Reaktionen unserer Klienten sind gesunde Antworten auf eine kranke Umgebung“, sagt Bisharat. Der Fehler liegt nicht beim Individuum, sondern in den Verhältnissen.
Strukturelle Gewalt macht krank – jeden Tag aufs Neue
Wer mit Menschen im Westjordanland arbeitet, kann sich der Gewalt nicht entziehen. Über 500 Palästinenser:innen wurden 2023 dort getötet, darunter zahlreiche Kinder. Demütigende Hausdurchsuchungen, brutale Verhaftungen, Abriegelungen, tötliche Siedlerangriffe: All das hinterlässt Spuren. Auch Nisreen Bisharat lebt mit ihrer Familie in Nablus – und beschreibt, wie Checkpoints, Stromausfälle, Schüsse und Ausgangssperren den Alltag prägen. Selbst die Verteidigung ihrer Masterarbeit musste sie online abhalten, weil die Straßen gesperrt waren.
In einer solchen Realität geht es nicht um „Traumaverarbeitung“, sondern um psychologische Erste Hilfe unter Bedingungen permanenter Unsicherheit und Bedrohung. Kinder malen Raketen. Mütter sprechen von Ohnmacht. Familien zerreißen unter Druck. „Ich arbeite mit einer Frau, die drei ihrer Söhne durch gezielte Tötungen verloren hat – in verschiedenen Jahren, an verschiedenen Orten. Was soll klassische Psychologie ihr sagen? Dass sie ihre Gedanken umstrukturieren soll?“
Therapie als ethisches Dilemma – oder politische Mitverantwortung?
Der entscheidende Unterschied, den Bisharat in ihrer Arbeit macht, ist konzeptioneller Natur: Sie spricht nicht von „Behandlung“, sondern von „Begleitung“. Dahinter steht ein professionelles Selbstverständnis, das psychologische Hilfe nicht als Anwendung von Techniken versteht, sondern als solidarisches Gegenüber. „Begleitung bedeutet: Ich bleibe da, auch wenn ich nichts ändern kann. Ich entwerte den Schmerz nicht, indem ich ihn diagnostiziere. Ich pathologisiere nicht, was Ausdruck eines gesellschaftlichen Bruchs ist.“
Diese Haltung ist nicht beliebig. Sie folgt einem humanistischen Ethos, das in Zeiten kollektiver Not politisch wird. „Wir behandeln nicht Symptome – wir anerkennen Kontexte.“ Bisharat und ihr Mann Bassam – ebenfalls Berater – leiten gemeinsam das Fanar Centre for Mental Health. Ihre Klient:innen kommen mit Schlafstörungen, Panikattacken, Reizbarkeit, Schuldgefühlen. Viele fühlen sich isoliert, schuldig, sprachlos. Und doch zeigen sich immer wieder Spuren von Resilienz: „Wenn eine Mutter sagt: Ich konnte heute zum ersten Mal meinen Sohn wieder umarmen, ohne Angst – dann ist das ein therapeutischer Moment.“
Menschlichkeit als Widerstand – gegen die Verrohung der Verhältnisse
Bisharat beschreibt ihre Arbeit nicht als Flucht vor der Wirklichkeit, sondern als Form von Gegenwehr. „Wir schaffen kleine Schutzräume inmitten der Unsicherheit. Unsere Arbeit ist kein Ersatz für politische Lösungen, aber ein Schutz vor dem inneren Zerfall.“ In diesen Schutzräumen wird nicht nur über Gefühle gesprochen, sondern über Würde, Mitgefühl, Verbindung. In Gruppensitzungen von Frauen geht es um Elternschaft, um Weiblichkeit, um sexualisierte Gewalt. In Kindergruppen wird gemalt, gespielt, geatmet. Viele Eltern machen mit. „Sie wollen kein Mitleid – sie wollen gesehen werden.“
Diese Praxis hat eine politische Dimension. Denn sie durchbricht die Logik der Entmenschlichung. „Wenn ich einem Menschen zuhöre, ohne ihn zu bewerten, schaffe ich ein Gegenbild zur Gewalt“, sagt Bisharat. „Das ist nicht naiv. Das ist nötig.“
Was Europa nicht sehen will – und warum es wichtig wäre
Die Geschichte von Nisreen Bisharat ist keine „Opfergeschichte“. Sie ist das Protokoll eines professionellen Widerstands. Einer, der mit Mitgefühl arbeitet, nicht mit Parolen. In Europa aber fällt es vielen Medien schwer, solche Stimmen zu hören. Die Debatte um Israel und Palästina wird entlang geopolitischer Lagergrenzen geführt. Wer das Leid der Palästinenser benennt, gerät schnell unter Verdacht.
Doch genau deshalb ist es wichtig, Erfahrungen wie die von Bisharat sichtbar zu machen. Ihre Arbeit ist ein Appell an die psychologische Zunft ebenso wie an die politische. Der Satz „Wir begleiten statt zu behandeln“ ist mehr als ein methodischer Hinweis. Er ist eine Mahnung: an eine Welt, die Schmerz gern individualisiert, aber ungern hinsieht, wenn dieser Schmerz strukturell ist.
Ausblick: Was diese Arbeit bedeutet
Das Modell von Nisreen Bisharat steht exemplarisch für eine psychosoziale Praxis, die sich dem entzieht, was man im Globalen Norden allzu oft für „normal“ hält. Es geht um ein Verständnis von Gesundheit, das nicht auf Funktionstüchtigkeit zielt, sondern auf Würde. Und um ein Verständnis von Therapie, das nicht auf Anpassung setzt, sondern auf Widerstand durch Beziehung.
So verstanden ist psychosoziale Begleitung nicht nur eine Praxis gegen das Verstummen, sondern auch gegen die moralische Erosion einer Welt, die Unrecht hinnimmt, solange es nicht vor der eigenen Haustür geschieht. „Niemand bleibt gesund, der alltägliche Gewalt legitimiert“, sagt Bisharat. Ihre Stimme ist eine Erinnerung daran, dass Menschlichkeit nicht nur eine Frage der Haltung ist, sondern auch eine der Praxis. Wir Deutschen sollten wissen, wovon sie spricht.
Titelbild: privat