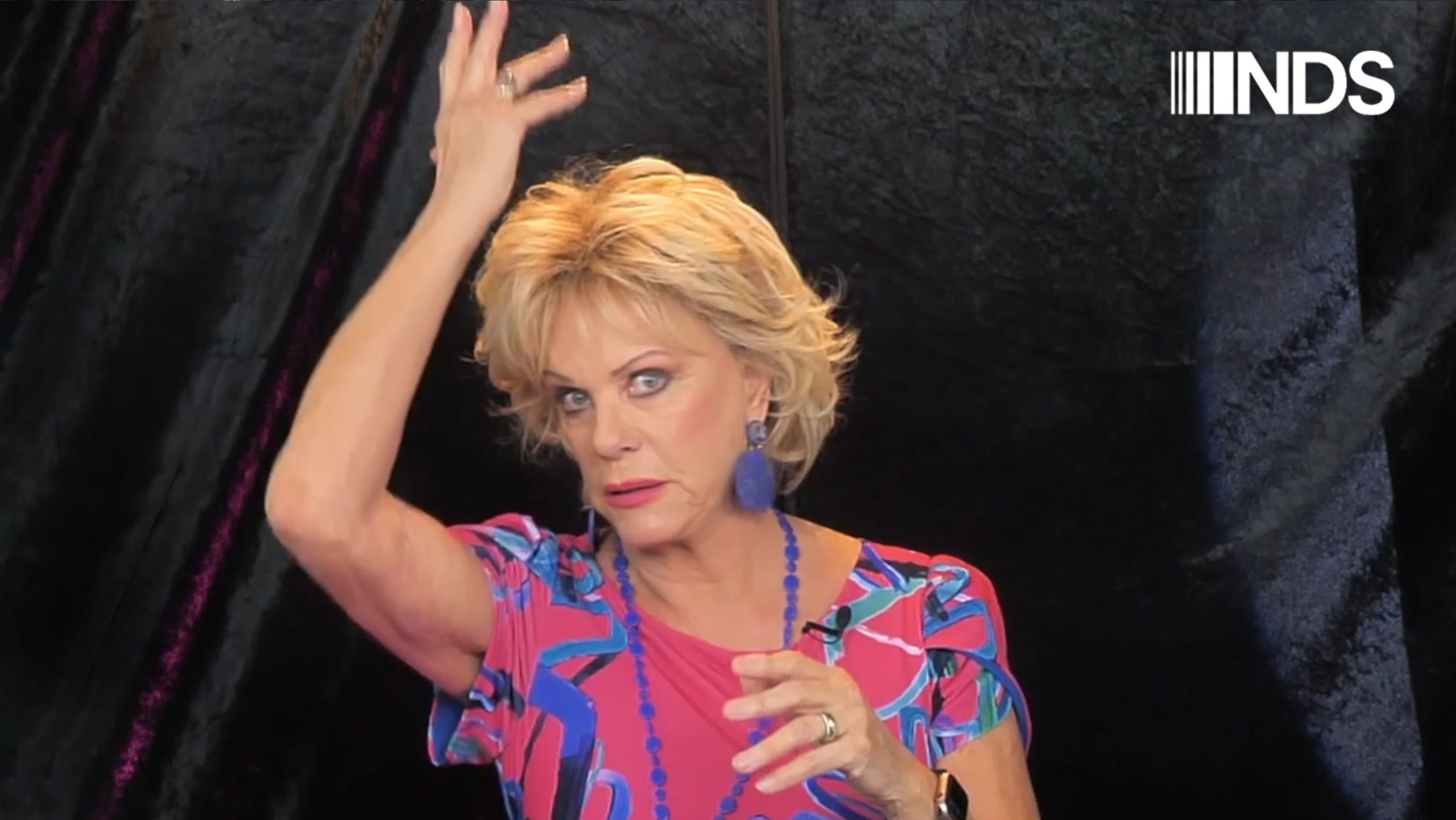Der Biologie-Professor Andreas Elepfandt ist ein Russland-Kenner der ganz besonderen Art. Er hat von 1975 bis 1976 14 Monate lang im Setschenow-Institut in Leningrad – heute St. Petersburg – in zwei Laboren bei der Erforschung von Heuschrecken und Wirbeltieren gearbeitet. Der Kalte Krieg klang gerade aus, und die von Willy Brandt begonnene Entspannungspolitik machte das möglich. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft mit Sitz in Bonn entsandte westdeutsche Wissenschaftler in sowjetische Institute. Der jetzt 82 Jahre alte Biologe hat die Stadt an der Newa im Juli dieses Jahres wieder besucht. Im Interview mit Ulrich Heyden (Moskau) berichtet Elepfandt über seine Eindrücke in Russland, damals und heute. Der Forscher, der nach seiner Pensionierung als Professor in mehreren Ländern außerhalb des westlichen Kulturkreises tätig war, plädiert für eine nüchterne und faire Sichtweise auf Russland.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Ulrich Heyden: Wie war Ihre Reise nach Sankt Petersburg?
Andreas Elepfandt: Von der westdeutschen Seite aus war es etwas umständlich. Reiseveranstalter haben die Tour nicht mehr angeboten, ich hab´ also den Flug selbst organisieren müssen. Ein Freund hat einen preiswerten Flug besorgt. Wir flogen von Berlin nach Tallin, von da nach Istanbul und von dort dann nach Sankt Petersburg. Zurück ging´s dann direkter. Da ging es von Sankt Petersburg nach Istanbul und von dort direkt nach Berlin.
In Sankt Petersburg habe ich das Hotel genommen, das ein Reiseveranstalter angeboten hat. Und das Irre war, dass man das von Deutschland aus buchen konnte. Der Betrag wurde von meinem Konto abgebucht. Auf meinem Kontoauszug habe ich gesehen, dass das über Nikosia gelaufen ist. Durch die Sanktionen werden die einfachen Leute gestört, aber nicht die Firmen. Die finden alle ihren Umweg.
Man muss nach Russland natürlich viel Geld mitnehmen, denn man kann ja dort nicht mit einer westlichen Karte bezahlen. Unser Reiseveranstalter hat mir dann eine Touristenführerin vermittelt, die uns dann auch sehr geholfen hat.
In Sankt Petersburg war es einfach nett, anders kann man es gar nicht sagen. Es war offen. Von der Erinnerung war es vor 50 Jahren eine etwas – ja, heruntergekommene – Stadt. Die Leute kämpften damals mit den Defiziten bei Lebensmitteln, Kleidung oder dergleichen mehr. Wenn man auf den Markt ging, dann schaute man, ob es da irgendetwas Besonderes gab.
Jetzt ist Sankt Petersburg eine wundervolle, schöne Stadt. Es gibt alles in den Läden. In unserer Nähe gab es auch Läden von Spar und Edeka. Den alten Markt, wo die Bauern früher ihre Waren verkauften, den gab es nicht mehr.
Sankt Petersburg ist jetzt wie eine westliche Großstadt, und dazu gibt es die herrlichen Paläste von damals. Sie sind jetzt alle wunderbar renoviert. Die Stadt ist heute mit der Stadt, die ich damals sah, nicht zu vergleichen.
Die Leute waren freundlich. Manche haben ja gemerkt, dass wir Ausländer sind. Ich war mit meiner Frau dort. Sie haben gefragt, woher wir kommen. Wir sagten, aus Deutschland. Sie waren neugierig. Es gab nirgendwo eine ablehnende Reaktion. Es war ganz anders als vor 50 Jahren. Damals war das Misstrauen noch sehr tief.
Wir machten fünf Tage das normale Touristenprogramm, welches auch sonst den deutschen Touristen angeboten wird. Anschließend sind wir noch vier Tage alleine herumgegangen. Wir haben mein altes Institut besucht und haben uns da nett mit ein paar Mitarbeitern unterhalten. Der Direktor hatte gerade keine Zeit, er bereitete eine Sibirien-Exkursion vor.
Was mir noch auffiel, war, dass die Frauen in der Stadt ihre Figur mit viel mehr Stolz gezeigt haben als bei uns – so, als ob sie zum Abendempfang gehen. Sie trugen hautenge Kleider bis zum Fußknöchel, geschlitzt bis auf den Oberschenkel und dergleichen mehr. Auch meiner Frau fiel das auf, es war nicht nur mein Männerblick.
Wir erlebten auch noch eine große Feier, Alye Parusa (Scharlachrote Segel). Das ist ein Fest aller Abiturienten von Sankt Petersburg. Das Fest basiert auf einer Geschichte aus dem 19. Jahrhundert. Da war ein Mädchen, das träumt, dass ihr Held eines Tages mit einem Segelschiff mit rotem Segel kommt und sie abholt. Und der Freund von ihr kam dann tatsächlich mit so einem Segelschiff. Das ist so ein Symbol, dass alle Träume wahr werden können.
Diese Feier gibt es jedes Jahr, und dann ist die ganze Innenstadt gesperrt. Da kommt kein normaler Mensch mehr durch. Wenn die Brücken über der Newa hochgezogen sind, kommt dann ein Segelschiff mit roten Segeln durchgefahren. Das kann man dann aber nur aus der Entfernung sehen, weil sich am rechten und linken Ufer der Newa alle Abiturienten versammelt haben. Wenn alle Abiturienten einer Stadt gemeinsam feiern, dann ist das ein Erlebnis, denn das sind Tausende in guter Stimmung.
Haben Sie etwas vom Krieg in der Ukraine mitbekommen?
Der ist ganz weit weg. Wir haben es einmal in den Nachrichten gesehen, aber das war dann eigentlich mehr ein Teil einer allgemeinen Beschreibung von Soldaten, die einen Gedenktag begingen. Der Krieg war fern, etwa so weit wie für uns der Krieg zwischen Kongo und Ruanda. Wir haben den Ukraine-Krieg von uns aus nicht angesprochen. Das Leben geht weiter, man freut sich und geht ins Theater.
In einer Kunstausstellung fiel uns auf, dass es das ganz Abstrakte, wie bei uns, nicht gab. Immer war auf den Bildern irgendwo ein Mensch zu sehen. Das entsprach der russischen humanen Freundlichkeit.
Wie waren die Reaktionen Ihrer Nachbarn und Freunde auf Ihre Russland-Reise? Waren die Leute überrascht, mussten Sie sich rechtfertigen, oder haben die Bekannten es ganz normal gefunden, dass Sie gefahren sind?
Meine Verwandten in Deutschland kennen mich und meine Auffassungen, also insofern war das für sie nichts Befremdliches. Einige fanden es toll, dass ich die Reise gemacht habe. Die Verwandtschaft hat gesagt, ja, dann fährt er eben nach Sankt Petersburg. Unter unseren Bekannten waren die Meinungen kaum negativ. Ich schreibe jedes Jahr einen Jahresbericht und alle, die den lesen, kennen meine Einstellung. Es gibt Leute, die mich weniger kannten, die haben sich ein bisschen gewundert.
Das ist das, was mich heute in unserer Bundesrepublik so irritiert. Kontroversen gab es ja auch zu Beginn der Bundesrepublik. Franz Josef Strauß und Herbert Wehner haben sich in Debatten ja nichts geschenkt. Aber es wurde als andere Meinung respektiert. Jetzt dagegen werden die Leute diffamiert. In den letzten Jahren gab es einen Verlust von Diskussionsfähigkeit. Das finde ich schlimm.
Intoleranz habe ich in Russland so nicht erlebt. Wir haben zweimal erlebt, dass Russen, nachdem sie mitbekommen hatten, dass wir aus Deutschland kamen, nachgefragt haben. Sie waren einfach neugierig. Ich habe nie ein schlechtes Wort über Deutschland gehört.
In Deutschland gibt es ja die Meinung, dass man einen Aggressor unterstützt, wenn man nach Russland fährt. Gab es so einen Vorwurf gegen Sie?
Ein Nachbar, den ich getroffen habe, meinte, Putin unterdrückt die Leute. Aber das war das einzige Mal, dass ich etwas in dieser Richtung gehört habe. Zwei Leute wollten nach der Reise einen genauen Bericht von mir hören, was ich in Russland erlebt habe. Also dieser Russenpopanz ist ja schon wirkmächtig. Das kann man nicht anders sagen.
Sie haben ja 1975 im damaligen Leningrad am Setschenow-Institut für Physiologie und Biochemie der Evolution gearbeitet. Setschenow war in der Sowjetunion ein führender Verhaltensforscher. Stimmt es, wie mir Russen erzählten, dass die Psychologie in der Sowjetunion eigentlich nur etwas für Militärs und Geheimdienstler war?
Nein. Ich arbeitete damals als Neurophysiologe. In der Kybernetik wurde behauptet, man könnte das menschliche Gehirn mit Regelkreisen analysieren. Da hat man einfache Systeme bei Insekten oder Schnecken untersucht. Ich habe meine Doktorarbeit über die Flügelbewegungen bei Grillen geschrieben. Da hoffte man, herauszubekommen, wie das alles funktioniert. Das waren nur zwei, drei Nervenzellen pro Muskel, insgesamt also zehn Nervenzellen.
Im Setschenow-Institut habe ich dann in einem Labor gearbeitet, das viel mit Wirbeltieren gemacht hat, aber die habe ich nie gesehen. In einem anderen Labor untersuchten wir die Windrezeptoren und das Hören bei Heuschrecken.
Damals gab es dann einen Umschwung. Man hat gesehen, dass eine einzelne Nervenzelle 10.000 Verbindungen zu anderen Nervenzellen hat. Damit war völlig klar: Das ist kein einfaches System.
Für mich war Folgendes spannend: Die Russen hatten eine andere Vorstellung vom Nervensystem der Insekten. Die hatten, was die Evolution betrifft, eine lineare Vorstellung, also dass sie sich immer weiter entwickelt. So ging man davon aus, dass auch Insekten ein vegetatives Nervensystem haben. Für uns im Westen war völlig klar, dass es das nicht gibt. Heute glauben auch die Russen nicht mehr an ihre alte These.
Am Setschenow-Institut gab es eine Dame mit dem Namen Plotnikowa. Die hat Zellen gefärbt und hat aufgrund ihrer Vorstellung, dass es bei Insekten ein vegetatives Nervensystem gibt, Neuronen gefunden.
Für mich war das damals eines von verschiedenen Schlüsselerlebnissen. Wie kann man mit einer falschen Vorstellung von Wissenschaft ein richtiges Ergebnis bekommen? Die Zellen gab‘s ja, die waren ja da. Zehn Jahre später haben die Amerikaner diese Zellen dann auch gefunden. Die haben sie dann bloß anders benannt: Neuromodulatoren. Die Russin Plotnikowa haben die Amerikaner natürlich nicht erwähnt.
Ich habe damals viel gelernt von der Natur als solcher und unserem Bild von der Natur. Unser Bild von Natur ist dann richtig, wenn es gute Vorhersagen ermöglicht. Wenn man falsche Erwartungen hat, findet man entweder gar nichts oder etwas anderes.
Nachdem mein Forschungsaufenthalt in Leningrad beendet war, ging die Zusammenarbeit mit Kollegen vom Setschenow-Institut weiter. Gemeinsam mit russischen Kollegen verfasste ich wissenschaftliche Publikationen. 1979 war ich dann noch mal an einem Institut in Leningrad.
Wie haben Sie sich mit den Russen damals verständigt? Haben Sie einen Russischkurs besucht? Oder haben Sie mit den Kollegen im Labor auf Englisch gesprochen?
Nein, Englisch wurde nicht gesprochen. Die Russen lernten damals Englisch nicht, um diese Sprache sprechen, sondern nur, um sie lesen zu können.
Mein Vater wurde in Russland geboren, musste aber nach der Revolution fliehen. Von daher gab es bei mir ein unterschwelliges Interesse an der russischen Sprache. An unserem altsprachlichen Gymnasium wurden viele Sprachen unterrichtet, aber kein Russisch. Als ich in der elften Klasse war, wurde bekannt, dass in der 9. Klasse ein Russischkurs angeboten wurde. Ich habe dann gefragt, ob ich da mitmachen kann, und es klappte.
Während des Studiums in München wurde ich dann aufmerksam auf einen kostenlosen Russischkurs für Naturwissenschaftler und Techniker. Später erfuhren wir, dass der Sprachkurs für die Personen bestimmt war, welche die Deutsche Forschungsgemeinschaft nach Russland schicken wollte. Die Bundesrepublik konnte bis dahin nur Slawisten nach Russland schicken, aber keine Naturwissenschaftler, denn denen fehlten die Sprachkenntnisse. Der Kurs hat dann wirklich geholfen. Wir lernten auch russische Alltagsredewendungen.
Mein Vater konnte mir nicht beim Russisch-Lernen helfen. Er konnte fließend Russisch. Aber als ich in der Schule begann, Russisch zu lernen und ihn fragte: ‚Heißt es so oder so?‘, musste er nachdenken, und dann fiel er aus.
Im Institut in Leningrad gab es mir gegenüber anfangs viel Misstrauen.
Man vermutete, dass Sie ein Spion sind?
Ja, man fragte sich, was will ein Kapitalist hier bei uns? Ich nehme an, die westliche Seite wird uns, die von der Bundesrepublik entsandten Wissenschaftler, genauso beobachtet haben. Ich halte es auch für berechtigt – in so einer Situation, wo einer auf die andere Seite geht, dass da beide Seiten gucken.
Ich hatte dann mal jemanden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefragt, was ich tun soll, wenn ich merke, dass da einer im Labor einen Bericht über mich schreibt. Da hat mein Gesprächspartner gesagt, „gar nichts. Erzählen Sie ihm so viel wie möglich. Dann wissen Sie, was in ihrer Akte steht.“
Weil ich in Leningrad mit Frau und Kind angereist war, haben wir eine Wohnung bekommen. Und na klar, da waren Mikrophone. Das wusste man und hat sich daran eigentlich auch nicht gestört. Die wussten ja nach einer gewissen Zeit, dass wir harmlos waren. In der Wohnung habe ich mit meiner Frau auch darüber geredet, dass ich Geld schwarz getauscht habe. Ich war ja gar nicht wichtig genug, dass sie mich da kaschen würden.
Die ersten drei Monate waren sie misstrauisch. Ein deutscher Freund aus Moskau hatte mich vorgewarnt und gesagt, dass es zurzeit keine Streichhölzer in Russland gibt. Also hatte ich Streichhölzer mitgenommen. Im Labor habe ich dann einen Bunsenbrenner mit einem Streichholz angezündet. Da hörte ich, wie hinter mir jemand zischelte: „Selbst Streichhölzer hat er mitgebracht.“
Der Laborchef hatte zu den Leuten gesagt: „Zu euch kommt einer aus Westdeutschland. Seid nett zu ihm, aber nicht zu nett.“ Da wussten alle Bescheid.
Nach drei Monaten wurde das Misstrauen weniger. Trotzdem haben die Menschen uns nicht alles erzählt, weil sie nicht wussten, ob wir uns verplappern. Als sie dann gemerkt haben, wir haben das System verstanden, da wurden die Menschen offener und haben uns etwas erzählt. Das war unsere schwerste Zeit, weil wir dann gehört haben, wie ein Onkel, den wir kannten – dass der nicht einfach vereist war, sondern, dass er abgeholt worden war. Da haben wir dann schon manchmal gezweifelt, wie man freiwillig in dieses Land fahren kann. Aber der Mensch gewöhnt sich an so vieles. Als wir drei Monate später ausreisten, waren wir traurig, dieses Land zu verlassen.
In Russland wollte ich den Sozialismus kennenlernen. Doch wir lernten völlig unerwartet eine ganz andere Gesellschaft kennen als bei uns. Diese Gesellschaft hatte mit Sozialismus etwas zu tun, sie war aber nicht durch den Sozialismus entstanden. Die Einstellungen der Menschen in Russland kommen von der Größe des Landes. Ich habe erst in Russland begriffen, was das heißt, „Moskau ist weit“. Erstens, du kannst sowieso nichts machen, und zweitens, die da oben können ja machen, was sie wollen, wir leben hier.
Das heißt aber nicht, dass die Sowjetbürger völlig apathisch waren. Sie haben ja ihren Alltag auch irgendwie gemeistert und abseits der offiziellen Wege vielleicht ihre Sachen durchgekriegt.
Nein, die Leute waren nicht apathisch. Beim Einkaufen hatte jeder sein Netz, und man guckte bei dem anderen nach, was der in seinem Netz hatte, und fragte nach: „Wo haben Sie denn das gekriegt?“ Man half sich im praktischen Leben. Einmal erlebte ich im Institut, wie jemand von Tür zu Tür ging und etwas rief. Eine halbe Stunde später war das Institut leer. Der Mann hatte erzählt, wo man etwas kaufen konnte.
Fritz Pleitgen, damals Auslandskorrespondent der ARD in Moskau, hat Sie – den Entsandten aus Westdeutschland – interviewt. Was hat er Sie damals gefragt?
Er kam mit russischen Kameraleuten in unsere Wohnung in Leningrad und befragte uns über die Lebensbedingungen und wie wir es in Russland finden. Wir hatten ja ein Baby mit dabei, und das war ja noch zusätzlich ungewöhnlich. Mein Sohn war zweieinhalb Monate alt. Das Interview wurde dann im deutschen Fernsehen gesendet. Einer der Professoren von der Universität, wo ich promoviert hatte, meinte: „Na ja, sie haben ja sehr vorsichtig geredet.“ Das kann sein, ich erinnere mich nicht genau.
Waren Sie 1968 durch die Studentenbewegung politisiert worden, oder waren Sie nur Wissenschaftler?
Es war etwas dazwischen. Dass ich nach Russland gegangen bin, hängt natürlich mit der Entspannungspolitik von Willy Brandt zusammen. Ich war offen und neugierig. 1968, als die Russen in die Tschechoslowakei einmarschiert waren, war ich bei einer Demonstration dabei. Die Demonstration fand statt vor der Russischen Botschaft in Bonn-Bad Godesberg. Ich hatte gemischte Gefühle, denn ich dachte, wenn die mich jetzt entdecken und ich kann deswegen nicht nach Russland, wäre das schlecht.
Die 1968er fand ich zu ideologisch. Ich war mehr auf einer praktischen Seite. In Köln, wo ich studiert und promoviert hatte, war ich in der Fachschaft. Ich hatte einen anderen Zugang. Andere Leute haben gegen den Numerus clausus demonstriert, wir waren eine Fachschaft von Doktoranten. Wir haben nachgerechnet und haben dem Ministerium gezeigt, dass unsere Fakultät 20 Studenten mehr aufnehmen konnte. Das hat uns bei den Professoren keine Sympathien eingebracht. Meine Aktivitäten in der Fachschaft führten dazu, dass ich erst viel später eine Professur bekam. Manche Professoren hielten mich für „zu links“.
Ich war am Sozialismus interessiert. Meine intensiven Bemühungen, nach der Promotion für etwa ein Jahr an ein Forschungslabor in der DDR zu gehen, blieben erfolglos. Das ging damals gar nicht, von beiden Seiten. Daher dann der Gang in die Sowjetunion, in der Hoffnung, dort mehr über Sozialismus zu lernen. Und wie schon gesagt, ich lernte dann weniger über den Sozialismus als über eine anders strukturierte Kultur, eben die russische. Diese Erfahrung, dass Kulturen strukturell verschieden sein können, mit anderen, beidseitig akzeptierten Beziehungen zwischen oben und unten, war für mich eine grundlegende neue Erfahrung, die mein weiteres Leben geprägt hat.
Natürlich war für meine Kölner Biologie-Professoren die Tatsache, dass ich, der schon in der Fachschaft „so links“ gewesen war, auch noch ausgerechnet in die Sowjetunion ging, ein Fanal. So jemand durfte nicht Professor werden! Mein Doktorvater war demgegenüber offener: Er kam sogar einmal, um mein Leningrader Institut zu besuchen und einen Fachvortrag zu halten. Er sprach Deutsch und ich übersetzte.
Ihr Vater wurde ja in Russland geboren. Konnten Sie von ihm die russische Sprache lernen?
Mein Vater wurde 1913, also vor der Revolution, in Sankt Petersburg geboren. Seine Eltern sind nach der Revolution geflüchtet, denn mein Großvater war Bankier. Als Hitler an die Macht kam, wollte mein Vater zur SA. Aber nach dem „Röhm-Putsch“ wollte er das dann nicht mehr. Von der Politik hat er sich immer ferngehalten.
Mein Vater war lange staatenlos. 1942 wurden dann auch die staatenlosen Deutschen zur Wehrmacht eingezogen. Dann hat er gesagt, dass er dann auch Deutscher werden wolle, was auch geschah.
Mein Vater hat dann an der Ostfront gegen die Russen gekämpft. Bei der Gefangennahme durch Soldaten der Roten Armee gab es ein paar heikle Szenen. Die Seite in seinem Wehrpass, in der seine Herkunft vermerkt war, fehlte. Mein Vater hatte sich einen anderen Geburtsort ausgedacht. Er kam dann in Sachsen in russische Kriegsgefangenschaft. Mein Vater hat sich immer irgendwie durchgewurschtelt.
Hat Ihr Vater den Angriff auf die Sowjetunion bereut?
In dieser Richtung habe ich nie etwas von ihm gehört. Nach dem Krieg ist er in den Westen gegangen. Seine Eltern lebten in Westberlin. Nach Westberlin ist er nur mit dem Flugzeug geflogen. Durch die DDR fahren, das wollte er nicht.
Sein stolzester Tag war, als die Russen ihren ersten Sputnik in den Weltraum geschickt haben. Er arbeitete damals beim NDR in Hamburg in der Senderüberwachung und hörte, was die Russen über den Sputnik-Start berichteten. Er hat das dann ins Deutsche übersetzt.
Die letzten beiden Lebensjahre meines Vaters waren für mich sehr schwierig. Ich studierte damals in Hamburg und war links angehaucht. Mein Vater aber war konservativ. Wenn ich spätabends vom Praktikum kam, regte er sich auf: „Was haben die Studenten da schon wieder gemacht.“ Es war nicht einfach und ich muss zugeben, ich war nicht ganz traurig, als mein Vater dann starb. Bei uns gab es eine strenge Art von Erziehung. Er war sehr fordernd. Wenn ich mit einer Zwei nach Hause kam, dann war seine Frage: „Warum ist es keine Eins?“ Erst als ich zur Promotion in Köln angenommen wurde, hat er gezeigt, dass er stolz auf mich war.
Wenn die deutschen Medien in den letzten Jahrzehnten mehr über den russischen Alltag und die russische Kultur berichtet hätten, wäre es dann schwieriger gewesen, Deutschland auf einen antirussischen Kurs zu bringen?
Es hängt zusammen mit unserer westlich-kolonialistischen Einstellung. Alle müssen so sein wie wir. Als ich nach meiner Pensionierung im Ausland an Universitäten unterrichten konnte – ich war in Südafrika, Kenia und Usbekistan –, habe ich bewusst Länder ausgewählt, die nicht zu unserem westlichen Kulturkreis gehören. Es geht darum, zu lernen und zu akzeptieren, dass andere Kulturen anders sind, auch strukturell und in sich trotzdem stimmig. Wir haben die Welt kolonialisiert und haben Völker ausgerottet, wie die Indianer in Nordamerika. Die Vielfalt der verschiedenen Kulturen zu akzeptieren ist ja bei uns gar nicht gängig. Insofern finde ich dieses BRICS-Projekt ganz spannend. Da kommen ja verschiedene Kulturen zusammen. Es ist ein anderer Ansatz, mit verschiedenen Kulturen im gegenseitigen Respekt zu leben. Das habe ich damals gelernt in Russland, das andere anders sein können und es trotzdem in sich stimmt.
Mein Hauptsatz ist: Frieden gibt es nur mit Russland und nicht gegen Russland. Die Entspannungspolitik hat Jahre gebraucht, aber sie hat dazu geführt, dass Deutschland wiedervereinigt wurde und die Ostblockstaaten frei wurden. Das war Friedenspolitik und nicht Kriegspolitik. Um den Frieden Bemühte, wie Matthias Platzeck oder wer auch sonst, dürfen nicht diskriminiert werden. Das finde ich wichtig.
Über den Interviewpartner: Andreas Elepfandt wurde 1943 in Berlin geboren. Er war Schüler am altsprachlichen Johanneum in Hamburg, studierte in München und Hamburg und promovierte in Köln in Zoologie. 1993 bis 2008 war er Professor für Sinnesbiologie an der Humboldt-Universität Berlin. Ab 2008, nach der Pensionierung, hatte er Lehraufträge an Universitäten in Südafrika, Kenia und Usbekistan. Er lebt seit den 1990er-Jahren nördlich von Berlin in Glienicke. Dort war er aktiv in der Glienicker Bürgerliste.
Titelbild: © Ulrich Heyden