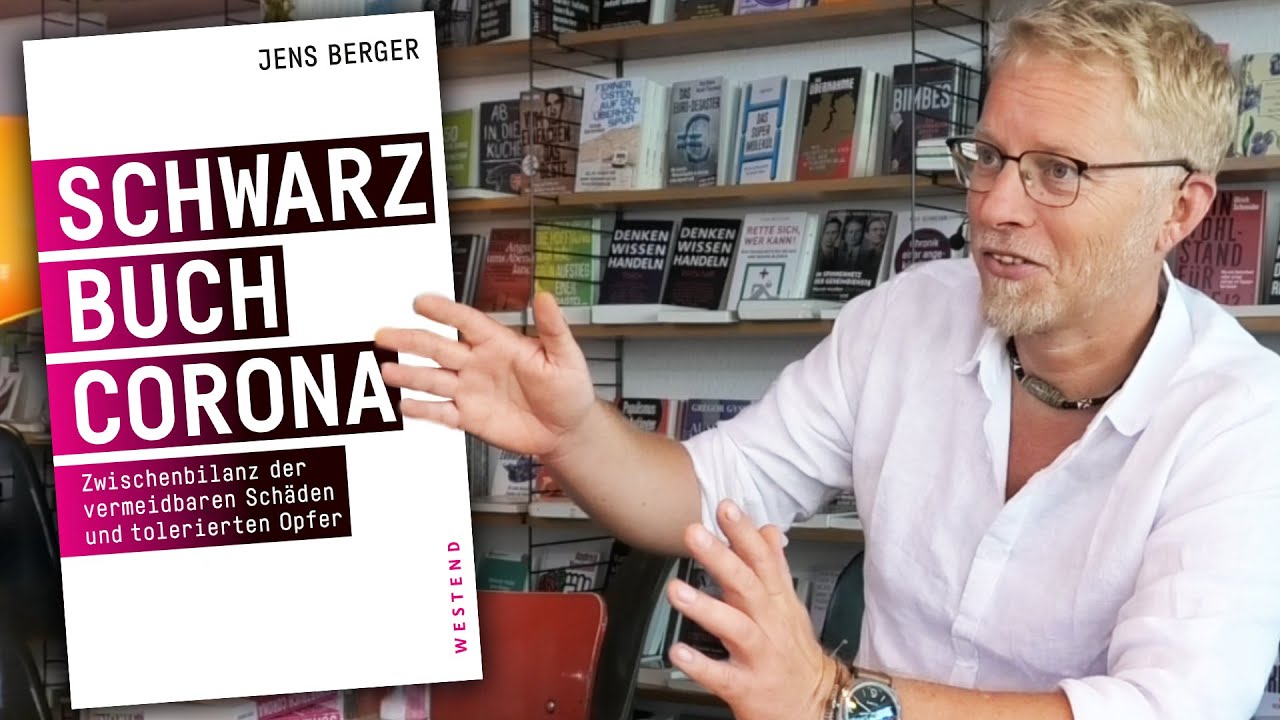Umbruchzeiten in der Weltpolitik sind außerordentliche Zeiten. Die bestehende Ordnung erodiert oder kollabiert, eine neue Ordnung erscheint am Horizont und bildet sich langsam heraus. Die Übergangsphase, das Interregnum, ist häufig sehr konfliktreich, mitunter kriegerisch: Die untergehende Macht will ihren absoluten oder auch nur relativen Niedergang nicht akzeptieren, die neuen Mächte im Werden hingegen fordern Mitsprache oder sogar Dominanz. Ob die Konflikte diplomatisch oder mit Blut und Eisen gelöst werden, ist immer offen gewesen. Von Alexander Neu.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Nun befindet sich die Welt seit einigen Jahren wieder in einem Interregnum. Epochenbrüche gehören zur menschlichen Geschichte wie ein Naturgesetz. Nur ist es dieses Mal ein besonderer Epochenbruch, der sich signifikant von vorangegangenen Brüchen unterscheidet: In den letzten 500 Jahren ist die Welt eine europäische Welt, ab dem 20. Jahrhundert mit den USA eine westliche Welt gewesen. Europa (im politischen, ökonomischen und kulturellen Sinne) hat die Welt dominiert und gestaltet: Kolonialismus, Ausbeutung, Krieg, aber auch Modernisierung in den Rest der Welt strukturierte den Globus zu einem auf Europa, den Westen ausgerichteten Globus.
Die Epochenbrüche der letzten 500 Jahre fanden in der europäischen Welt statt: der Fall Konstantinopels 1453, der 30-jährige Krieg mit den anschließenden, bis heute bedeutsamen Westfälischen Verträgen zu modernem Völkerrecht und staatlicher Souveränität 1648, der Kollaps der Monarchien zu Beginn des 20. Jahrhunderts (Osmanisches Reich, KuK-Monarchie und das deutsche Kaiserreich, Russisches Zarenreich und Oktoberrevolution sowie der Einstieg der USA als aufkommende Großmacht) als Ergebnisse des Ersten Weltkrieges; die Niederlage des Deutschen Reiches und Aufteilung Deutschlands als Folge des Zweiten Weltkrieges; das Aufwachsen der Sowjetunion zur zweiten Supermacht und die damit einhergehende Aufteilung Europas in Ost und West und der Welt in sowjetische und US-amerikanische Einflusszonen. Der Staffelstab der Macht und der Vorherrschaft wanderte also zwischen den europäischen, später den Großmächten der nördlichen Hemisphäre. Der Rest der Welt war bloße Verfügungsmasse.
Nun aber sind wir Zeitzeugen eines qualitativ anderen Epochenwandels: Der Westen und der – etwas vereinfacht formuliert – „Nichtwesten“ kämpfen um den Erhalt der alten bzw. der Struktur der neuen Weltordnung. Der Westen will seinen relativen Machtverlust nicht akzeptieren, der Rest der Welt die Globaldominanz des Westens nicht mehr. Die unipolare Weltordnung liegt in den letzten Zügen, die neuen Akteure stehen auf der Bühne und fordern multipolare Strukturen bzw. die Abbildung ihrer gewachsenen Macht in den internationalen Regierungsorganisationen, wie der UNO, dem IWF oder der Weltbank. Sofern ihnen dies nicht zugestanden wird – beispielsweise Reform des UN-Sicherheitsrates, in dem auch dem Globalen Süden permanente Sitze zugestanden werden –, bauen sie neue, eigene regionale und interregionale Foren, die die globalen Institutionen umgehen und zur Erosion dieser globalen internationalen Regierungsorganisationen führen. Die UNO befindet sich auf dem Wege in die Bedeutungslosigkeit. Eingeklemmt zwischen den alten Großmächten, die die UNO und das Völkerrecht mit der sogenannten „regelbasierten internationalen Ordnung“ zu ersetzen und den Rest der Welt darauf zu verpflichten versuchen, und den neuen, den aufkommenden Großmächten, die angesichts der Weigerung des Westens, die UNO zu reformieren, Parallelstrukturen in der Weltpolitik aufbauen und die westliche Ordnungsvorstellung sowie deren „regelbasierte internationale Ordnung“ ablehnen.
Zu den Parallelstrukturen des Nichtwestens gehören vor allem BRICSplus sowie die Shanghai Organisation für Zusammenarbeit.
Die USA als die westliche Führungsmacht hat das Potenzial und die Herausforderungen für den Westen und insbesondere für die USA angesichts dieser Entwicklungen erkannt. Der neue US-Präsident Donald Trump tut das, was Herrschende in Großmächten und untergehenden Großmächten tun: Sie versuchen, den Niedergang ihres Imperiums zu verhindern. Es war ein Irrtum der ersten Monate nach Amtsantritt, dass Trump es anders sehen könnte, dass er sich mit der aufkommenden neuen Weltordnung, der multipolaren Ordnung abfinden würde, dass er das Prinzip „primus inter pares“ („Erster unter Gleichen“) mittragen würde, in dem Einflusszonen nach Deals gemäß der jeweiligen Machtpotenziale der Konkurrenten aufgeteilt werden würden. Er betrachtet diese Herausforderungen für die USA nicht anders als das übrige US-Establishment.
Es ist nur anders – direkter und ehrlicher; nicht in ideologische Worthülsen „Demokratien gegen Autokratien/Diktaturen“, „Gut“ gegen „Böse“, „Garten gegen Dschungel“ verpackt, sondern rein pragmatisch, rein machtpolitisch im Sinne der Denkschule des Realismus. Auch in der im Jahre 1992 bekannt gewordenen sogenannten Wolfowitz-Doktrin, benannt nach dem Neocon Paul Wolfowitz, die das Denken der US-Neocons (eine außenpolitische Denkschule) reflektiert und deren Einfluss sich tatsächlich auf beide Lager, die Republikaner und die Demokraten erstreckt, wird gefordert, die alleinige US-Vorherrschaft in der Weltpolitik mit allen Mitteln und somit auch jenseits völkerrechtlicher Restriktionen zu verteidigen. Dieser Ansatz gilt offensichtlich parteiübergreifend in den USA als Leitfaden US-amerikanischer Außen-, Sicherheits- und Geopolitik. Und auch Donald Trump denkt in diese Richtung. Er kämpft nicht für den Westen, zumindest nicht in erster Linie, sondern für die USA, gemäß seinen Losungen „America first“ und „Make America Great Again“.
Derzeit kämpft Trump seinen Krieg in erster Linie als Handels- und Sanktionskrieg – selbst gegen seine Verbündeten im westlichen Lager – gegen den Rest der Welt. Insbesondere die EU und die BRICS-Staaten sind in seinem Fokus.
Im Folgenden sollen die Maßnahmen der USA als Globalakteur im Abwehrkampf gegen ihren relativen Machtverlust sowohl mit Blick auf die „Freunde“ und die „Feinde“ skizziert werden.
BRICSplus
Die BRICSplus-Gruppierung ist zwar keine formale internationale Regierungsorganisation, verfügt also nicht über eigene feste Organisationsstrukturen und einen entsprechenden institutionellen Standort. Ihre Bedeutung auch als „nur“ kooperierende Staatengruppe ist dennoch nicht zu unterschätzen. Die abwechselnd in den Hauptstädten der Teilnehmerstaaten jährlich stattfindenden Gipfeltreffen sind ein wichtiger Hinweis darauf, dass die Regierungen diesem Staatenbündnis eine hohe politische Relevanz beimessen.
Dieses Jahr fand das Gipfeltreffen unter der brasilianischen Präsidentschaft in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro im Juli statt, also vor einem Monat.
Als Gründungsmitglieder gelten Brasilien (B), Russland (R), Indien (I), China (C), die 2006 die BRIC schufen. Südafrika stieß 2010 hinzu. Mit dem „S“ für Südafrika wurde der Name auf BRICS erweitert. Mit der nächsten Erweiterung (Ägypten, Äthiopien, Indonesien, der Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate) wurde darauf verzichtet, das Alphabet weiter zu strapazieren. Es heißt nun einfach BRICSplus. Der Status von Saudi-Arabien ist nicht eindeutig erkennbar. Zwar ist auf der BRICS-Homepage Saudi-Arabien als Vollmitglied aufgeführt, jedoch gibt es unterschiedliche Informationen über den tatsächlichen Status des Landes.
Hinzu kommen eine Vielzahl von BRICS-Partnerstaaten. Dieses Format der Partnerstaaten kann als eine Vorstufe zur Vollmitgliedschaft oder auch nur als eine Anbindung an die BRICS interpretiert werden.
Die BRICSplus-Staaten repräsentieren rund 50 Prozent (unter Einschluss der Partnerländer rund 56 Prozent) der Weltbevölkerung. Der Anteil der BRICSplus-Vollmitglieder am weltweiten Bruttoinlandsprodukt soll rund 41 Prozent (unter Einschluss der Partnerländer rund 44 Prozent) betragen.
Das BRICSplus-Bündnis richtet sich nach eigenen Angaben gegen keine anderen Staaten(-gruppen), betont jedoch die Wahrung der Souveränität seiner Staaten und den Anspruch auf eine selbstbestimmte Entwicklung – auch und vor allem unabhängig westlicher Interventionen und Einflüsse. Im Westen wurde das BRICSplus-Gebilde lange Zeit als irrelevant ignoriert. Zu heterogen seien die jeweiligen nationalen Interessen, als dass sie gebündelt werden und sodann eine Gefahr für die westliche Hegemonie darstellen könnten. Man setzte weithin auf die alte Methode des „Teile und Herrsche“ im Umgang mit den nichtwestlichen Staaten. Tatsächlich jedoch scheint mittlerweile der Wille zur Unabhängigkeit, tatsächlicher politischer und ökonomischer Souveränität der nichtwestlichen Staaten schwerer zu wiegen als ihre ansonsten heterogenen Interessenlagen. Es bedurfte offensichtlich einer Staaten-Avantgarde – also die BRICS-Staaten –, die nun sukzessive immer mehr Staaten anzieht. Seit rund zwei Jahren beobachten Politik und Mainstreammedien im Westen dann doch mit Argusaugen die Entwicklung der BRICSplus unter dem Aspekt der Bedrohung der westlichen Globaldominanz – Stichwort: Ersetzung der unipolaren hin zur multipolaren Weltordnung.
BRICSplus – Der „Krieg“ beginnt
Den offiziellen Startschuss zum Kampf gegen BRICSplus feuerte US-Präsident Donald Trump angesichts des im Juli stattgefundenen BRICSplus-Gipfels in Brasilien. So berichtet CNN folgendes Statement von Donald Trump:
„,Jedes Land, das sich der antiamerikanischen Politik der BRICS anschließe´, werde sich diesen Zöllen ‚ohne Ausnahme‘ stellen müssen, schrieb Trump am Sonntag in den sozialen Medien, als sich die Staats- und Regierungschefs der Gruppe zu einem jährlichen Gipfeltreffen in Rio de Janeiro trafen.“
(„,Any country aligning themselves with the Anti-American policies of BRICS´ will face those duties with ,no exceptions´, Trump wrote on social media Sunday, as leaders from the group met for an annual summit in Rio de Janeiro.“)
Trumps Unmut trifft vor allem die im Raum stehende Abwendung der BRICS-Staaten vom US-Dollar als Welthandelswährung. Den bilateralen oder multilateralen Handel ohne Nutzung des US-Dollars, also die Nutzung der nationalen Währungen der Handelspartner und erst recht eine eigene BRICSplus-Handelswährung betrachtet Donald Trump – und wohl nicht nur er – als „anti-amerikanische Politik“.
Drago Bosnic, unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst, konnte zu dieser Thematik einen kritischen Artikel auf der „Gemeinsamen Homepage der Außenministerien der BRICS-Mitgliederstaaten“ veröffentlichen, womit seinem Beitrag zumindest ein halboffizieller Charakter zugestanden werden kann:
„Der von den USA angeführte politische Westen ist eine Bedrohung für jedes auch nur annähernd souveräne Land auf diesem Planeten. Egal, wie viele Zugeständnisse ein Land macht, es wird nie genug sein, denn der aggressivste Machtpol der Menschheitsgeschichte verlangt nichts als blinden Gehorsam. Wenn dies bedeutet, dass Länder (oder ganze Ländergruppen, wie die EU/NATO zeigt) ihre grundlegendsten nationalen Interessen opfern müssen, um die USA zufriedenzustellen, dann ist das nach der geopolitischen Logik Washingtons, ‚so sei es´“.
(„The US-led political West is a threat to every remotely sovereign nation on the planet. No matter how many concessions a country makes, it’ll never be enough, as the most aggressive power pole in human history wants nothing but blind obedience. According to Washington DC’s geopolitical logic, if this means that countries (or entire groups of countries, as evidenced by the EU/NATO) need to sacrifice their most basic national interests to satisfy the US, then “so be it”.“)
Interessant an der Formulierung Bosnics sind zwei Aspekte: Erstens die Interpretation, nach der der Westen als Bedrohung für jegliche Unabhängigkeit nichtwestlicher Staaten und somit als Gefahr auch für das UNO-Völkerrecht betrachtet wird, denn die staatliche Souveränität ist ein Grundstein der UNO-Charta; und zweitens, dass selbst im Westen eine starre Hierarchie besteht, indem der Autor den USA attestiert, selbst die EU und die NATO als Objekte US-amerikanischer Interessenpolitik zu betrachten.
Und tatsächlich scheint sich eine zunehmende Anzahl nichtwestlicher Staaten – angesichts seines politischen Missbrauchs (grundlegend für die Anwendung von Sanktionen gegen Drittstaaten, beispielsweis Ausschluss aus dem SWIFT-System oder Sperrung des Zugangs zum US-Dollar für den Handel) für außenpolitische und außenwirtschaftliche Interessen der USA – vom US-Dollar als faktische Welthandelswährung zu verabschieden. So schreibt ein anderer Autor auf der oben genannten BRICSplus-Homepage:
„Ende einer Ära? Welt bewegt sich jenseits des Dollars. Mehr als 90 Länder haben einen historischen Bruch mit dem US-Dollar in ihrem internationalen Handel eingeleitet.“
(„End of an Era? World Moves Beyond the Dollar. More than 90 countries have initiated a historic break with the US dollar in their international trade.“)
Nach jetzigem Stand ist kein Einknicken der BRICSplus-Staaten angesichts der Erpressungsversuche Donald Trumps zu erkennen. Das Machtbewusstsein in der BRICSplus-Gemeinschaft ist größer, als es die USA und die Europäer erwartet haben. Der Stellvertreterkrieg in der Ukraine und seine geopolitischen Hintergründe (NATO-Osterweiterung) wie auch die Tragödie im Nahen Osten, insbesondere Gaza, und deren geopolitische Intentionen haben dem Nichtwesten die letzten Illusionen über eine faire und vertrauenswürdige Partnerschaft auf Augenhöhe mit dem Westen genommen. Die Narrative zwischen dem Westen und dem Nichtwesten über die Weltpolitik fallen immer weiter auseinander.
EU-US-Handelsabkommen
Dass die USA auch ihre Verbündeten nicht mit Samthandschuhen anfassen, davon konnte sich die Öffentlichkeit EU-Europas jüngst bei einem Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen überzeugen.
Das Treffen fand ganz nach den Vorlieben Trumps weder in offiziellen Räumen in Washington oder Brüssel statt, sondern so nebenbei auf einem Golfplatz in Schottland – würde man es zynisch formulieren, dann zwischen zwei Schlägen Trumps auf dem Rasen. Jedenfalls war das Ergebnis ganz nach dem Geschmack Donald Trumps. Und die Kommissionspräsidentin feierte das Ergebnis als ein „gutes Abkommen“ – ja, für die USA, nicht jedoch für die EU und ihre Wirtschaft. Das Ergebnis ist in einem Fact Sheet des Weißen Hauses zusammengefasst.
Das Online-Medium T-Online hat eine Presseschau zu den Bewertungen diverser Mainstreammedien im EU-Raum zusammengestellt. Diese gelangen ganz überwiegend zu einem vernichtenden Urteil hinsichtlich des von der Kommissionspräsidentin proklamierten „guten Abkommens“.
Schaut man sich das Ergebnis an, so könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Kommissionspräsidentin der EU überhaupt kein Interesse an einer starken EU hat, einer EU, die einen eigenständigen Machtpol in der sich herausbildenden multipolaren Weltordnung darstellen könnte. Was ist mit der „strategischen Autonomie“, die die EU unbedingt umsetzten wollte? Was bleibt übrig von der harten Positionierung der Europäer gegen Donald Trump zu Beginn seiner Amtszeit im Vergleich zum Verhalten und Handeln der letzten Wochen? Man überschlug sich geradezu mit Forderungen nach einem unabhängigen und selbstständigen Europa. Und jetzt?
Offensichtlich hat man nach den ersten Anti-Trump-Empörungsrunden und den verlautbarten hochtrabenden Zielen europäischer Eigenständigkeit dann doch kalte Füße bekommen. Man konnte sich in EU-Brüssel und ein paar europäischen Hauptstädten dann doch nicht dazu durchringen, EU-Europa zum eigenständigen Akteur in der internationalen Politik zu machen. Stattdessen entschied die EU-Kommission, sämtliche Handlungs- und Kooperationsoptionen jenseits der transatlantischen Orientierung freiwillig, ja geradezu mit Eifer zu kappen, sodass nur noch die USA als Partner verbleiben und sich EU-Europa somit bewusst und zielgerichtet in eine alternativlose Abhängigkeit zu den USA manövriert.
Die transatlantische Ideologie ist offenbar zu fest in den Köpfen und Seelen der europäischen Politikentscheider verankert, als dass man in alternativen Kategorien zu denken in der Lage ist. Vielmehr kamen die EU-Eliten zu dem Ergebnis: Die transatlantische Orientierung Europas habe einen Preis, den man (also der europäische Steuerzahler) halt zahlen müsse, den die EU in Wirklichkeit die Steuerzahler zahlen lassen will, aber es nicht müsste. Diese fortgesetzte einseitige Orientierung auf die USA macht EU-Europa zu einem freiwilligen Anhängsel. Der Preis hierfür wird weiter steigen. Donald Trump konnte ohne Probleme auf dem Golfplatz seine Ziele durchsetzen – was ihm zeigt, wie willensschwach die EU ist, und somit seinen Appetit auf weitergehende Unterwerfungen noch steigern dürfte.
Bereits auf dem NATO-Gipfel Ende Juni war der Kuschelkurs der europäischen NATO-Staaten gegenüber Trump von beeindruckender Peinlichkeit – angeführt von ihrem Generalsekretär Mark Rutte, der Trump als „Daddy“ bezeichnete. Und Ursula von der Leyen setzte dieses Trauerspiel auf dem Golfplatz fort.
Welchen weltpolitischen Status wird oder kann EU-Europa angesichts dieses unterwürfigen Politikansatzes erringen?
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird EU-Europa kein eigenständiger Globalakteur werden, da es nicht im Interesse der politikbestimmenden europäischen Transatlantiker liegt. Das für EU-Europa mögliche Spektrum bewegt sich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit im dienenden Bereich den USA gegenüber. Es beginnt beim klassischen „bandwagoning“, das heißt, sich den USA zu unterwerfen in der Hoffnung, im Windschatten des großen Bruders zu segeln, etwas vom Kuchen abzubekommen. Und es endet bei der weitgehenden Selbstaufgabe EU-Europas, um die globale Vormachtstellung der USA zu unterstützen, was eine weitgehend irrationale Denke bedeutet.
Dass US-Präsidenten, und nicht nur Donald Trump, „America first“ denken und danach handeln, ist das eine. Dass aber die EU-Europäer diesen Ansatz mit begeisterter Selbstaufgabe ihrer selbst mittragen, ist schon etwas anderes. Zumal die EU sich weder demographisch (EU = 450 Millionen Einwohner und USA = 340 Millionen Einwohner) noch hinsichtlich der BIP-Daten (EU 17,94 Billionen Euro und die USA 25,27 Billionen Euro im Jahr 2024) unterordnen muss. Im Gegenteil wäre die EU bei einem Handelsvolumen von 1,68 Billionen Euro (Stand 2024) mit den USA durchaus in der Lage, den US-Sanktions- und Zolldrohungen ebenso schmerzhafte Maßnahmen entgegenzusetzen. Warum die Kommissionspräsidentin dies nicht tut, mag an ihrer transatlantischen Ideologisierung liegen. Nur, hier geht es nicht um ihre transatlantischen Überzeugungen und ihr persönlichen Empfindungen, sondern um den europäischen Wohlstand, die Lebensqualität der Menschen in EU-Europa – schlichtweg um die Zukunft EU-Europas in einer neuen Weltordnung. Zumindest scheint den neuen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil eine Vorahnung dessen zu ereilen, was das „gute Abkommen“ so alles bedeuten könnte:
So berichtet der Deutschlandfunk:
„Zum Auftakt seines Antrittsbesuchs in Washington hat Bundesfinanzminister Klingbeil die Europäer aufgerufen, Lehren aus dem Handelsstreit mit den USA zu ziehen. Der SPD-Politiker sagte im DLF, die Auseinandersetzung habe deutlich gemacht, wie abhängig die EU in zentralen wirtschaftlichen Fragen sei.“
Ob Lars Klingbeil jedoch die Machtfrage gegen den Kanzler Friedrich Merz im Hinblick auf die Ratifikation des „guten Abkommens“ stellen wird, ist eher unwahrscheinlich.
Wie unabhängiges, die nationalen Interessen verteidigendes Handeln geht, das zeigt derzeit Indien, ein BRICSplus-Staat: Indien verweigert sich sehr selbstbewusst den Erpressungen Donald Trumps, künftig kein Öl mehr aus Russland zu beziehen. So zitiert die „Tagesschau“ die indische Reaktion:
„Indien wies die US-Kritik als “ungerechtfertigt und unvernünftig” zurück. Wie jede große Volkswirtschaft werde Indien alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um seine nationalen Interessen und seine wirtschaftliche Sicherheit zu schützen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums.“
Bleibt zu hoffen, dass die EU-Mitgliedsstaaten dem Beispiel Indiens folgen, mithin ihre nationalen Interessen wiederentdecken und das „gute Abkommen“ nicht ratifizieren. Ich bin da aber nicht sonderlich optimistisch. Und ob sich Donald Trump lediglich mit der vollständigen Unterordnung EU-Europas unter „America first“ zufriedengeben wird oder das sich andienende EU-Europa letztlich sogar für „America first“ opfern wird, ist fraglich. Ein anderer Globalakteur, der chinesische Staatschef Xi Jinping, äußert hierzu seine Zweifel, wie er auf X kundtat:
„Die Vereinigten Staaten kümmern sich nicht um ihre Verbündeten; sie verfolgen nur ihre eigenen Interessen. Und wenn sie sehen, dass das Verlassen eines Partners diesen Interessen dient, zögern sie nicht, ihn zu opfern und in die Hölle zu schicken“
(„The United States does not care about its allies; it only pursues its own interests. And when it sees that abandoning a partner serves those interests, it does not hesitate to sacrifice them and send them to hell.“)
Damit liegt Xi auf der klaren analytischen Linie mit dem kürzlich verstorbenen US-Strategen Henry Kissinger, dem folgende Aussage zur US-Außenpolitik nachgesagt wird:
„Es kann gefährlich sein, Amerikas Feind zu sein; aber Amerikas Freund zu sein, ist verhängnisvoll.“
(„It may be dangerous to be America’s enemy, but to be America’s friend is fatal.“)
Fazit
Während George Bush Junior nach dem Terrorangriff am 11. September 2001die Welt mit den Worten „entweder man ist mit uns oder mit den Terroristen“ (häufig auch übersetzt „gegen uns“) dichotomisierte, dabei aber noch ein – selbstverständlich unter US-Führung – „Wir-gegen-die-Terroristen“ suggerierte, geht Donald Trump noch einen Schritt weiter, was sich wie folgt benennen ließe: „Entweder man unterwirft sich uns oder ist gegen uns.“
Mit anderen Worten: Sollte dieses „gute“ Unterwerfungsabkommen in Kraft treten, dann brauchen wir in der EU nicht mehr über den Machtfaktor EU-Europa in einer multipolaren Weltstruktur zu diskutieren, sondern vielmehr über den sozio-ökonomischen Niedergang des europäischen Kontinents – inklusive des wahrscheinlichen faktischen Zerfalls der europäischen Integration, da einzelne Mitgliedssaaten ihr Heil in der Flucht suchen, also sich außen- und außenwirtschaftspolitisch neu orientieren werden. Die neue Weltordnung findet ohne EU-Europa als mitgestaltendes Subjekt statt.
An den beiden Beispielen – BRICSplus und EU-Europa – wird deutlich, wie die verschiedenen Politikverständnisse (ideologiegesteuert oder pragmatischer Realismus) über Wohl und Wehe eines Landes oder eines Staatenbundes entscheiden können. Die Eliten EU-Europas haben sich gegen eine interessengeleitete, multivektorale Außen- und Außenwirtschaftspolitik entschieden. Dafür werden wir einen hohen Preis zahlen.
Titelbild: Shutterstock / ElNino