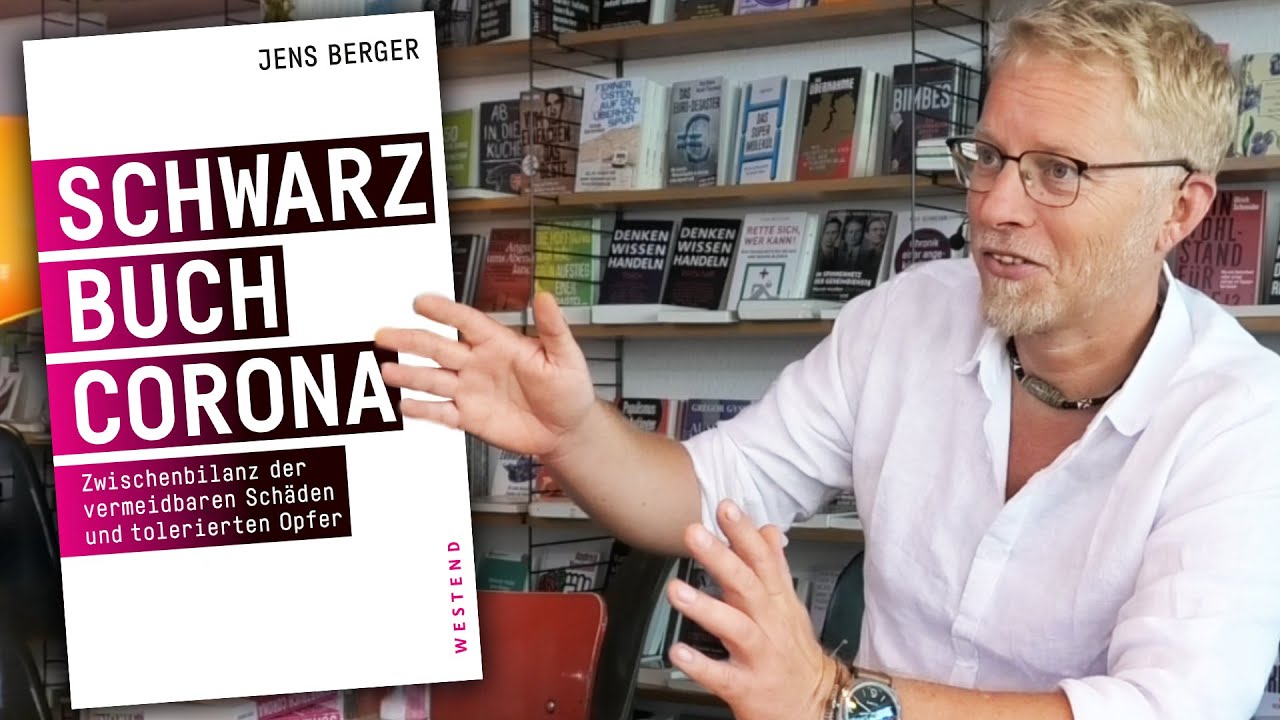Trotz des brutalen Kaufkraftverlusts und einer Reihe von Korruptionsskandalen führten die Zwischenwahlen in Argentinien zu einem überwältigenden Sieg für La Libertad Avanza (Die Freiheit schreitet voran, LLA), die Partei von Javier Milei. Und jetzt? Von Florencia Oroz.
Die Ergebnisse der Zwischenwahlen in Argentinien brachten einen überwältigenden Sieg für Mileis Partei, die auf nationaler Ebene mit mehr als 40 Prozent der Stimmen gewann.
Für diejenigen von uns, die sich vor nur 50 Tagen über die Ergebnisse der Parlamentswahlen in der Provinz Buenos Aires (eine Provinz, die fast 40 Prozent der nationalen Wählerschaft ausmacht) gefreut hatten, war die Nachricht ein Schlag ins Gesicht. Die Enttäuschung ist groß, nicht nur unter denen, die mit voller Überzeugung ihre Hoffnungen auf Fuerza Patria[1] gesetzt hatten, sondern auch unter Leuten wie uns, die sich über die damaligen Ergebnisse gefreut hatten. Nicht so sehr wegen ihrer positiven Bedeutung, sondern wegen ihrer negativen Aussagekraft: der lang ersehnte Beginn des Niedergangs der Liberalen und der Beginn der Auswirkungen der von der Regierung Milei verursachten Wirtschaftskatastrophe auf die Wahlurnen.
Aber nein. Am 26. Oktober gelang es dem Peronismus nicht nur nicht, etwas von diesem Sieg auf Provinzebene auf die nationale Ebene zu übertragen. Er verlor sogar in demselben Gebiet, in dem er vor knapp zwei Monaten einen „Kantersieg” errungen hatte. Knapp, aber dennoch verloren. Ein wirklich spektakuläres Comeback von La Libertad Avanza: Innerhalb weniger Wochen konnte die Partei mehr als 13 Punkte gutmachen, vor allem aufgrund der gestiegenen Wahlbeteiligung, die bei den Wahlen am 7. September bei etwas mehr als 61 Prozent lag, am 26. Oktober jedoch knapp über 68 Prozent betrug.
Nun, abgesehen von der leichten Erholung der Wahlbeteiligung in der Provinz Buenos Aires und von dem für viele entmutigenden Anblick der violett gefärbten Landkarte, ist das herausragende Ergebnis des 26. Oktobers Resultat des Einbruchs der allgemeinen Wahlbeteiligung auf nationaler Ebene. Seit der Rückkehr zur Demokratie im Jahr 1983 ist die Wahlbeteiligung einem anhaltenden Abwärtstrend unterworfen. Man könnte sagen, dass Zwischenwahlen immer weniger Menschen anziehen als Präsidentschaftswahlen, und das ist auch richtig. Aber selbst wenn man nur die Parlamentswahlen betrachtet, ist der Einbruch bemerkenswert: Zum ersten Mal in den letzten 40 Jahren lag die Wahlbeteiligung unter 70 Prozent. Die Daten dieser letzten Wahl zeigen, dass nur 68 Prozent der Wahlberechtigten an den Urnen erschienen sind. Mit anderen Worten hat sich jeder Dritte entschieden, nicht an einer obligatorischen Wahl teilzunehmen. Diese Zahlen sollten mehrere Alarmglocken läuten lassen.
Für viele sind die 40 Prozent von La Libertad Avanza unerklärlich. Seit zwei Jahren verfolgt die Regierung von Javier Milei eine Politik der Inflationsbekämpfung, indem sie Löhne und Renten als Anker nutzt. Die Regierungspartei behauptet, dass es keinen Spielraum für Lohnvereinbarungen gibt, die über ein Prozent pro Monat hinausgehen. Eine Zahl, die darauf abzielt, die Inflationserwartungen nach unten zu korrigieren und zu verhindern, dass der Verteilungskampf eine aufwärts gerichtete Preisspirale auslöst. Angesichts einer massiven Abwertung zu Beginn der Amtszeit und einer monatlichen Inflation, die im Durchschnitt doppelt so hoch ist wie die Obergrenze für Lohnerhöhungen, sinkt die Kaufkraft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jedoch rapide.
Die Situation der Rentnerinnen und Rentner ist noch schlimmer. Während der Wert ihres Warenkorbs auf etwa 1,5 Millionen Pesos (knapp 900 Euro) geschätzt wird, beträgt die Mindestrente nicht einmal ein Drittel dieses Betrags, nämlich 396.000 Pesos (inklusive Bonus zwischen 240 und 250 Euro). Dieses Szenario wird noch katastrophaler, wenn man bedenkt, dass die Hälfte der Rentnerinnen und Rentner des Landes die Mindestrente bezieht. Jeden Mittwoch versammelt sich der Koordinierungsausschuss der Rentner vor dem Nationalkongress, um eine Anpassung ihrer Bezüge zu fordern, und die Antwort der Regierung Milei war bisher ausnahmslos Repression.
Hinzu kommt die Haushaltskrise der Universitäten und des öffentlichen Gesundheitswesens, Sektoren, die Anfang Oktober, kurz vor Ende des Wahlkampfs, einen wichtigen Sieg errungen hatten, als der Kongress auf die Erklärung des Notstands in beiden Bereichen bestand und das Veto des Präsidenten ablehnte.
Der systematische Finanzierungsentzug im öffentlichen Sektor hatte in den letzten Monaten zudem eine weitere Folge: einen alarmierenden Anstieg der Zahl der Frauenmorde. Nach Angaben der Organisation „Ahora que sí nos ven“ (Jetzt, da sie uns wirklich sehen)[2] gab es im Jahr 2025 bisher 178 Frauenmorde, also einen alle 36 Stunden. In den zwei Wochen vor den Wahlen erlangten vier Fälle besondere öffentliche Aufmerksamkeit, sodass das Thema sogar in den großen Medien behandelt wurde. Wie das Observatorio argumentiert, schüren die Abschaffung und Aushöhlung der meisten Präventionsprogramme sowie die Förderung von Hassreden, Leugnung und Frauenfeindlichkeit durch den Staat selbst patriarchale Gewalt und führen zu einem zunehmend feindseligen Klima für Frauen und Dissidenten. Trotz der Schwere der Lage wurde das Thema in den Wahlkampfreden kaum angesprochen.
Doch damit war die Liste der Probleme für La Libertad Avanza, die sowohl bei den eigenen Anhängern als auch bei Außenstehenden Zweifel an ihrem Wahlerfolg aufkommen ließen, noch nicht zu Ende. Vom Skandal um den Betrug mit der Kryptowährung $LIBRA im Februar über die Korruptionsvorwürfe gegen Mileis Schwester Karina und andere hochrangige Regierungsbeamte – die im August beschuldigt wurden, illegale Provisionen für Pharmaverträge (die berühmten „drei Prozent”) verlangt zu haben – bis hin zu verschiedenen anderen Vorfällen schien es zahlreiche Gründe für eine Wahlniederlage der Partei des Präsidenten zu geben. Die jüngste Affäre um Luis Espert, der als Spitzenkandidat von La Libertad Avanza in der Provinz Buenos Aires für die Wahlen im Oktober antreten sollte, aber wegen des Verdachts auf Verbindungen zum Drogenhandel seine Kandidatur zurückziehen musste, war das i-Tüpfelchen für einen Wahlkampf, der mehr Hindernisse als erwartet mit sich brachte.
Die Schwächung der Figur Milei und die Abnutzung seines Wirtschaftsmodells, wie Delfina Rossi in Jacobin erklärt, führten in den letzten Wochen zu einer allgemeinen Flucht aus argentinischen Anleihen und Märkten, was wiederum zu einer Beschleunigung der Abwertung des Wechselkurses führte. Vor diesem Hintergrund und in dem Wissen, dass eine abrupte Abwertung so wenige Tage vor den Wahlen völlig undurchführbar war, beschloss die nationale Regierung, sich an die Vereinigten Staaten zu wenden. Die bedingte Unterstützung von Donald Trump („Wenn Milei nicht gewinnt, werden wir nicht großzügig zu Argentinien sein”) veranlasste nicht wenige Menschen – darunter auch mich – zu der Annahme, dass eine derart massive Einmischung in die lokale Politik für die Regierung nach hinten losgehen würde.
Angesichts der Ergebnisse vom 26. Oktober haben wir uns jedoch geirrt. Nicht nur scheinen die Erwartungen, die durch das US-Rettungspaket geweckt wurden, jegliche Bestrebungen nach Souveränität übertrumpft zu haben. Auch die Folgen der Korruptionsskandale und der anhaltende Kaufkraftverlust seit dem Amtsantritt der neuen Regierung im Dezember 2023 scheinen die politische Konstellation im Wahlgeschehen nicht neu geordnet zu haben, wie wir angenommen hatten. Nicht einmal die Ankündigung einer Arbeitsmarktreform, die unter anderem die Abschaffung der Abfindungen bei Entlassungen und eine „Dynamisierung” des Achtstundentags durch eine mögliche Verlängerung auf zwölf Stunden vorsieht, konnte die Wählerschaft beeindrucken und ihre Präferenzen ändern. Ist Argentinien nun unwiderruflich rechtsgerichtet? Oder sind die Menschen aus unerklärlichen Gründen entschlossen, gegen ihr eigenes Überleben zu stimmen?
Ich glaube weder noch, auch wenn uns die Verzweiflung manchmal dazu verleitet, solche Fragen zu stellen. Vielmehr scheint es mir, dass wir die in der argentinischen Gesellschaft verbreitete Enttäuschung über die Politik unterschätzen, ebenso wie die Tiefe des Überdrusses und das weit verbreitete Gefühl, dass „alles so schlecht ist”, dass nur extreme Maßnahmen Abhilfe schaffen können, selbst wenn dies Opfer in der Gegenwart mit sich bringt. Um die Ursachen dieses Phänomens zu ergründen, reicht es jedoch nicht aus, nur die Situation des letzten Jahres zu betrachten. Es ist notwendig, eine mittelfristige Betrachtung vorzunehmen, die in die Analyse nicht nur wirtschaftliche Dynamiken und ideologische Definitionen einbezieht, sondern auch kulturelle und soziale Prozesse, die in den Statistiken weniger offensichtlich, aber für die Gestaltung der sozialen Stimmungen ebenso wichtig wie die erstgenannten sind.
Über die wiederholte Unfähigkeit des Peronismus, sich nicht nur formal, sondern auch effektiv und nachhaltig zu den Wahlen zu vereinigen und die internen Streitigkeiten zu überwinden, in denen er seit der Regierung von Alberto Fernández versunken ist, wurde bereits viel geschrieben. Das alles werde ich hier nicht wiederholen. Ich möchte nur anmerken, dass von den „neuen Liedern”, zu deren Komposition Axel Kicillof – meiner Meinung nach zu Recht – im Oktober 2023, vor dem Sieg Mileis, aufgerufen hatte, noch keines erklungen ist. Abgesehen vom Willen (oder der kühnen Äußerung?) des Gouverneurs der Provinz Buenos Aires scheint es keine ehrliche Bilanz über die Reichweite und Grenzen der Erfahrungen des Kirchnerismus in der Regierung, die tieferen Ursachen seiner Niederlage im Jahr 2015 oder die Gründe zu geben, warum es ihm seitdem – und sogar schon vorher – nicht gelungen ist, eine dauerhafte Hegemonie wiederaufzubauen.
Welche Politik verfolgten die verschiedenen Organisationen, die sich mit dem Kirchnerismus in einer seiner Varianten identifizierten (mehr oder weniger „cristinistisch”, um es kurz und bündig zu sagen), um den Teil der Gesellschaft zurückzugewinnen, der einst von dem eingeschlagenen Kurs überzeugt war und beispielsweise den historischen Sieg von 2011 mit 54 Prozent der Stimmen ermöglichte? Grob gesagt basierte die Strategie des Kirchnerismus – zumindest in seinen Mainstream-Varianten – während der bisherigen Amtszeit von Milei auf zwei Säulen: erstens auf der systematischen Wiederholung eines Diskurses, der dazu aufrief, die Vorzüge der Jahre der Kirchner-Regierung „zurückzuholen”, die Kennzahlen der „gewonnenen Dekade” „wiederherzustellen” und die Erfahrungen der Regierungen von Néstor und – vor allem – Cristina „neu aufzulegen”. Mit anderen Worten: ein Diskurs, der immer wieder auf diesen „nostalgischen Peronismus” anspielte, den es laut Kicillof zu überwinden galt.
Da es keine ernsthafte Bilanz über die Erinnerung oder die Bedeutung der Jahre der Kirchner-Regierungen gibt – die zusehends in die Vergangenheit rücken –, klingt ein Diskurs, der im Wesentlichen auf die Vorzüge der Vergangenheit verweist, immer hohler. Würde man eine ehrliche Bilanz ziehen, würde man wahrscheinlich feststellen, dass der Kampf um diese Erzählung, der Streit um den Wert, den diese Jahre seit dem Ende der Ära 2015 im kollektiven Gedächtnis der argentinischen Gesellschaft haben, weitgehend verloren ist. Nicht unter den Anhängern des Kirchnerismus selbst, die immer noch zwischen einem Viertel und einem Drittel der Wählerschaft ausmachen, wohl aber gegenüber dem berühmten „dritten Drittel”. Weiterhin auf dieser Linie zu beharren, bedeutet daher, immer wieder über denselben Stein zu stolpern. Je früher man diese Tatsache anerkennt, desto größer sind die Chancen, aus der Sackgasse herauszukommen.
Die andere Säule, auf der die Strategie des Kirchnerismus in diesen fast zwei Jahren libertärer Regierung beruhte, war das Beharren auf dem institutionellen Weg als wichtigstes Instrument der Auseinandersetzung. Mit anderen Worten: Die größten Hoffnungen, den Kurs der Regierung zu ändern, wurden in die parlamentarische Arbeit gesetzt. Die Mobilisierung, wenn sie denn mit Nachdruck stattfand, wurde als Unterstützung oder Druckmittel für einen Kampf eingesetzt, der hinter den Türen des Kongresses ausgetragen wurde.
Der transformative Charakter des Protests und vor allem der Organisation von unten als zentrale Strategie des politischen Kampfes fehlte weitgehend in den Plänen. Die Politik wird so immer mehr – selbst unter denen, die behaupten, das Gegenteil zu vertreten – zu einer delegativen Angelegenheit, fast zu einer Frage des „Glaubens”, wodurch die Einflusskraft der von unten organisierten Bevölkerung entwertet wird, einfach weil die Menschen nicht dazu aufgerufen werden, sich von unten zu organisieren, sondern lediglich zu „unterstützen”. Angesichts der Ergebnisse vom 26. Oktober stellt sich die Frage, wie es nun weitergehen soll, da der Kongress, der zuvor gespalten und in jeder Abstimmung noch umkämpft war, nun praktisch verloren ist.
Der allgemeine Eindruck ist, dass die Verbreitung des Anti-Kirchner-Diskurses in weiten Teilen der Gesellschaft immer wieder unterschätzt wird. Und spiegelbildlich dazu werden die Vorzüge des „gewonnenen Jahrzehnts” überbewertet. Ja, es stimmt, dass heute die „glücklichere” wirtschaftliche Lage (aus einem Zeitraum, der deutlich kürzer als ein Jahrzehnt war) vermisst wird. Vermisst werden auch die Kulturpolitik und die Ausweitung der Rechte, die heute nicht nur fehlen, sondern im Begriff sind, rückgängig gemacht zu werden, wenn dies nicht bereits geschehen ist. Aber diese Jahre haben auch die Grundlagen des neoliberalen Modells nicht erschüttert. Als das internationale Umfeld nicht mehr vorteilhaft war und der zu verteilende Kuchen kleiner wurde, wurde die Gelegenheit für eine strukturelle Veränderung der Verteilung des Reichtums im Land verpasst.
Der Schlag ins Gesicht, den die Ergebnisse der Wahlen am 26. Oktober bedeuteten, muss überwunden werden, denn es bleibt nichts anderes übrig. Aber wenn wir nicht nur überleben, sondern auch um die Subjektivität kämpfen und einen Konsens darüber schaffen wollen, dass eine gerechtere Gesellschaft (wie auch immer sie heißen mag) möglich und notwendig ist, müssen wir auch eine offene Debatte über unsere jüngste Geschichte führen und den Mut aufbringen, über den Possibilismus hinauszugehen. Die argentinische Gesellschaft ist nicht über Nacht rechtsgerichtet geworden und hat auch nicht plötzlich beschlossen, dass sie lieber schlechter leben möchte. Die argentinische Gesellschaft ist allgemein desillusioniert und sieht zunehmend keine Möglichkeit mehr, eine Zukunft zu erkennen. Das Problem ist, dass die einzige politische Option, die dieses Gefühl aufgreift und einen Neuanfang vorschlägt, die extreme Rechte ist. Aus Gründen des bloßen Überlebens ist es an der Zeit, eine eigene Option zu entwickeln.
Übersetzung: Hans Weber, Amerika21
Über die Autorin: Florencia Oroz hat einen Master-Abschluss in argentinischer und lateinamerikanischer Geschichte der Universität Buenos Aires, ist Dozentin und Redaktionskoordinatorin der Revista Jacobin.
Dieser Artikel ist Teil der Reihe „Die Lage Lateinamerikas und die Wahlen in Argentinien 2025″, einer Zusammenarbeit zwischen der Zeitschrift Jacobin und der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Titelbild: Joshua Sukoff / Shutterstock
Stimmen aus Argentinien: Das Urteil des Obersten Gerichtshofs und das Ende der Demokratie
Vereinte Nationen warnen vor wachsender staatlicher Repression in Argentinien
[«1] Fuerza Patria (FP), früher Unión por la Patria (UxP), ist die progressive, peronistische politische Koalition, der die ehemalige Präsidentin Cristina Kirchner angehört (Anmerkung des Übersetzers).
[«2] Die Beobachtungsstelle „Ahora que sí nos ven” ist eine argentinische zivilgesellschaftliche Organisation, die sich gegen geschlechtsspezifische Gewalt einsetzt (A. d. Ü).